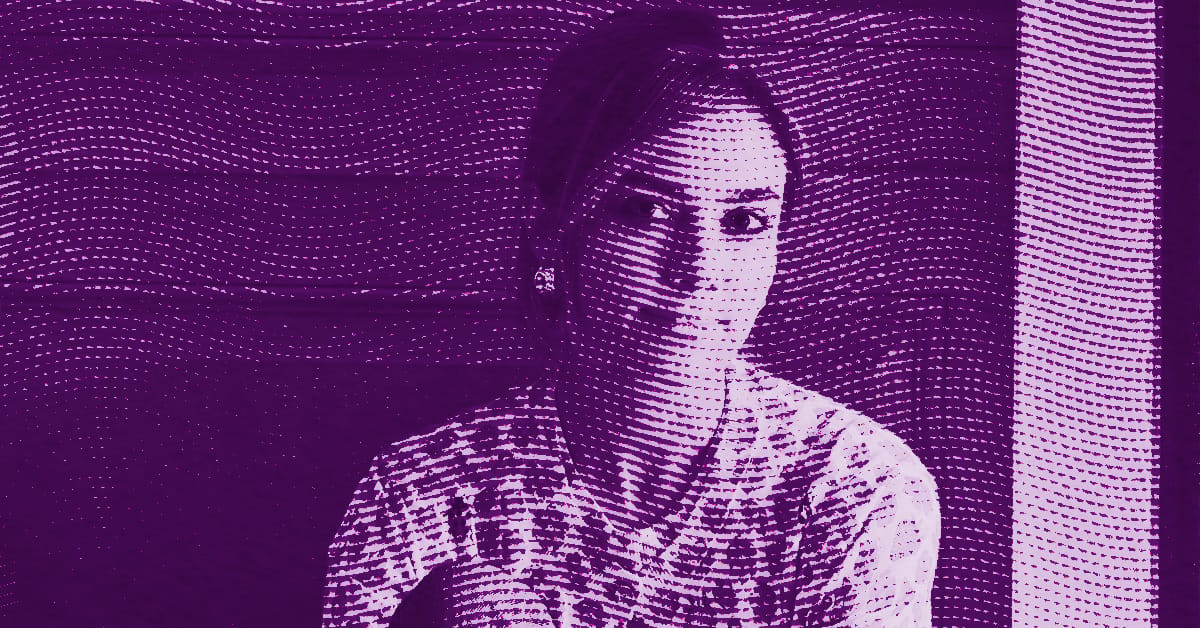Hört mir gut zu, ihr Snobs. Während ihr euch vor denselben konzeptuellen Malern begeistert, die seit vierzig Jahren Langeweile recyceln, hat eine junge Frau aus Calgary etwas Wesentliches über unsere Zeit verstanden: Schönheit verzeiht nichts. Anna Weyant, geboren 1995, malt junge Frauen, die wie Porzellanpuppen aussehen und in Situationen erschreckender Banalität gefangen sind. Und dabei erweckt sie Gespenster, die wir lieber ruhen lassen würden.
Ihr Werdegang scheint streng vorgezeichnet: Rhode Island School of Design, dann die Akademie der Schönen Künste in China in Hangzhou, bevor sie nach New York zieht, wo sie als Atelierassistentin arbeitet und gleichzeitig ihre eigene Praxis entwickelt. Nichts Spektakuläres, außer dass sich Sammler bereits bei ihrer ersten Einzelausstellung 2019 bei 56 Henry, einer Galerie am Lower East Side, stürzen. Drei Jahre später wird sie Teil von Gagosian und ist damit die jüngste Künstlerin, die von dieser legendären Galerie vertreten wird. Eines ihrer Gemälde, Falling Woman, erreicht 1,5 Millionen Euro bei Sotheby’s Auktion im Jahr 2022. Der Markt hat gesprochen, doch was mich interessiert, ist das, was ihre Gemälde flüstern.
Der Körper, der stört
Anna Weyant arbeitet im Herzen dessen, was Julia Kristeva in ihrem grundlegenden Werk Powers of Horror: An Essay on Abjection, veröffentlicht 1980 [1], als Abjektion bezeichnet hat. Das Abjekte, so Kristeva, ist weder Subjekt noch Objekt, sondern jene verschwommene Zone, in der Grenzen zusammenbrechen, in der das Vertraute monströs wird. Schauen Sie sich Two Eileens (2022) an: zwei Versionen derselben jungen Frau, eine lächelnd, die andere nachdenklich, gekleidet in ein zerknittertes Nachthemd, aneinandergedrückt vor einem pechschwarzen Hintergrund. Diese Verdopplung ist nicht einfach nur narrativ oder surrealistisch. Sie materialisiert die Trennung zwischen Ich und dem Anderen, jenen Urbruch, den wir aufbauen, um unsere Identität zu konstruieren, wie Kristeva beschreibt.
Kristeva schreibt, dass das Abjekte den Moment markiert, in dem wir uns von der Mutter getrennt haben und begonnen haben, eine Grenze zwischen Ich und Anderen zu erkennen. Bei Weyant hat diese Trennung nie wirklich stattgefunden. Ihre jungen Frauen scheinen in diesem präobjektiven Zustand gefangen, in jenem archaischen Raum, in dem Identität fließend und gefährlich instabil bleibt. In Falling Woman (2020) fällt die Protagonistin rückwärts eine Treppe hinab, den Mund weit geöffnet, die Brüste hervortretend. Fällt sie, lacht sie, schreit sie oder genießt sie? Das Bild verweigert eine eindeutige Interpretation. Es schwankt zwischen Komik und Tragik, zwischen erlittenem Gewalt und gewählter Freiheit.
Diese Zweideutigkeit ist kein Fehler, sondern die Signatur des Abjekten, wie Kristeva es versteht. Das Abjekte, schreibt sie, ist vor allem Ambiguität. Es bricht nicht radikal mit dem, was das Subjekt bedroht, sondern erkennt eine ständige Gefahr an. Die Figuren Weyants leben in diesem Zustand permanenter und sanfter Bedrohung. Sie sind nie sicher, aber sie fliehen auch nicht. Sie verweilen, aufgehängt in häuslichen Innenräumen, die goldene Gefängnisse ähneln.
Nehmen Sie Lily (2021), dieses Stillleben, das eine weiße Lilie und einen Revolver, der mit einem goldenen Band umwickelt ist, nebeneinanderstellt. Das abjektierteste Objekt schlechthin, das Todesinstrument, schmückt sich mit den Attributen der Verführung. Es wird zum Geschenk, zur Gabe, zum Versprechen. Kristeva betont, dass das Abjekt uns gleichermaßen anzieht und abstößt. Weyants Revolver, wie ein Geburtstagsgeschenk mit Band verpackt, verkörpert diese abstoßende Faszination perfekt. Er verwandelt Gewalt in Ornament, den Tod in ein Stillleben.
Weyants Farbpalette verstärkt dieses Gefühl häuslicher Abjektion. Ihre dunklen Grüntöne, ihre staubigen Rosatöne, ihre tiefen Schwarztöne erinnern an die Sepiatöne alter Fotografien, aber auch an den speziellen Farbton kranker Haut, eines Körpers, der zu zerfallen beginnt. Kristeva verbindet das Abjekt mit der Materie des Todes, mit dieser traumatischen Konfrontation mit unserer eigenen Endlichkeit. Die Leiche, schreibt sie, gesehen ohne Gott und außerhalb der Wissenschaft, stellt die höchste Abjektion dar. Es ist der Tod, der das Leben infiziert.
Die jungen Frauen in Weyants Werken besitzen genau diese leichenhafte Qualität. Ihre Haut wirkt wie Porzellan, glatt und kalt wie die von Puppen, die zu lange gelebt haben. Sie sind schön auf die Weise, wie holländische Stillleben des 17. Jahrhunderts schön sind, mit einer Schönheit, die bereits nach Verwesung riecht. In Venus (2022) stehen sich zwei Bilder der Tennisspielerin Venus Williams gegenüber, dargestellt in tiefen Brauntönen. Die eine blickt zu uns, die andere wendet sich ab. Die Verdopplung erzeugt Unbehagen, ein Gefühl unheimlicher Fremdheit.
Diese Fremdheit entsteht gerade deshalb, weil Weyant sich weigert, ihre Motive in reine Objektivierung ruhen zu lassen. Sie widerstehen der Reduzierung auf bloße Objekte der Begierde oder ästhetischen Betrachtung. Kristeva stellt fest, dass das Abjekt sich der Assimilation widersetzt, dass es dem Symbolischen unzulänglich bleibt. Die Figuren von Weyant bewohnen diesen Raum des Widerstands. Sie schauen uns an, ohne uns wirklich zu sehen, verloren in ihren eigenen Gedanken, ihren eigenen kleinen Dramen.
Die Künstlerin sagte in einem Interview: “Ich denke, dass wir empfindsamer oder beschützender gegenüber den Teilen von uns selbst sind, die wir zu verbergen versuchen, den Stellen, an denen wir Scham empfinden, vielleicht in Wut, Trauer, Kontrollverlust. Es gibt eine Intimität, eine Zärtlichkeit oder Feinfühligkeit dort, wo wir am monströsesten sind” [2]. Dieser Satz fasst das Projekt, das in ihrem Gemälde wirkt, perfekt zusammen. Die Monstrosität ist nicht äußerlich, spektakulär, gothic im traditionellen Sinne. Sie ist intim, häuslich und versteckt in den Falten der Normalität.
Emma (2022) illustriert diese sanfte Monstrosität. Eine junge Frau in einem schwarzen Overall sitzt, während eine andere, halb sichtbare Figur ihr über die Haare streichelt. Die sitzende Frau hat nur ein Auge. Diese Verstümmelung jedoch erzeugt nicht den erwarteten Schrecken. Die Umarmung suggeriert vielmehr eine schwesterliche Liebe, eine Zärtlichkeit, die Mängel akzeptiert und umarmt. Kristeva würde vielleicht schreiben, dass dieses Bild die Phobie, jene primitive Reaktion auf das Abjekt, ablehnt und stattdessen eine fast gelassene Akzeptanz des Unvollständigen anbietet.
Weyants Stillleben funktionieren nach derselben Logik. It Must Have Been Love (2022) zeigt zwei Vasen mit Blumen auf einem Esstisch aus verschiedenen Blickwinkeln. Die Blumen, von ihren Wurzeln getrennt, sind bereits tot, aber noch nicht verwelkt. Sie befinden sich in diesem liminalen Raum, dieser Schwelle zwischen Leben und Tod, die Kristeva als das bevorzugte Gebiet des Abjekts identifiziert. Das Stillleben, nature morte auf Französisch, still life auf Englisch, trägt diesen Widerspruch in sich. Es hält das Leben an, um es besser zu betrachten, und schafft einen Moment eingefrorener Schönheit.
Weyant treibt diese Logik in einigen Werken noch weiter, indem sie die Blumen buchstäblich köpft oder sie beim Verwelken zeigt. Die Künstlerin verwandelt das Stillleben in eine botanische Tatortszene. Die Gewalt wird formal, ästhetisch, fast abstrakt. Aber sie bleibt Gewalt. Kristeva stellt fest, dass primitive Gesellschaften einen bestimmten Bereich ihrer Kultur markierten, um ihn aus der bedrohlichen Welt der Tiere oder der Animalität zurückzuziehen, die als Vertreter von Sex und Mord vorgestellt wurden. Weyant bringt diese verdrängten Elemente in den zivilisiertesten häuslichen Raum zurück: den Speisesaal, das Wohnzimmer, das Schlafzimmer.
Ihre Verwendung von Hell-Dunkel erinnert an die holländischen Meister des 17. Jahrhunderts, Rembrandt, Frans Hals und Judith Leyster, aber die Bedeutung hat sich geändert. Bei den Holländern kam das Licht oft von Gott, es offenbarte die göttliche Wahrheit in der materiellen Welt. Bei Weyant isoliert das Licht die Motive in schwarzen Leerräumen, trennt sie von jedem beruhigenden Kontext. Es ist ein theatralisches, fast filmisches Licht, das dramatisiert ohne zu erklären. Es erzeugt mehr Geheimnis als Klarheit.
Dieser theatralische Ansatz verstärkt den Effekt der Abjektion. Kristeva spricht vom Abjekt als dem, was Identität, System, Ordnung stört. Das, was Grenzen, Positionen, Regeln nicht respektiert. Weyants Gemälde verstören gerade deshalb, weil sie sich weigern, sich den Erwartungen zu fügen. Sie ähneln klassischer figurativer Malerei, sie übernehmen die Codes der konventionellen Schönheit, lassen jedoch etwas Unrichtiges, Unpassendes, leicht Übelkeitserregendes durchscheinen. Die Pistole mit ihrem Band. Die junge Frau, die fällt. Die Doppelgänger, die nicht existieren sollten.
Die Künstlerin schafft, was wir eine “Mittelklasse-Abjektion” nennen könnten. Kein spritzendes Blut, keine brüllenden Monster. Nur gut gekleidete junge Frauen in gepflegten Innenräumen, und doch stimmt etwas nicht. Dieser Ansatz ist unendlich verstörender als expliziter Horror. Er suggeriert, dass das Abjekte sich nicht am Rand der Gesellschaft verbirgt, sondern im Zentrum unseres täglichen Lebens. In unseren Häusern, unseren Beziehungen, unseren Körpern.
Kristeva verbindet das Abjekte ebenso mit Lust wie mit Angst. Weyants Gemälde spielen ständig mit dieser Grenze zwischen Vergnügen und Unbehagen, zwischen Anziehung und Abstoßung. Head (2020), diese Nahaufnahme einer gewölbten Brust, die auf einen Fellationsakt hinweist, illustriert diese Ambivalenz perfekt. Das Bild ist zugleich erotisch und unangenehm, verführerisch und leicht absurd. Es reduziert den weiblichen Körper auf ein Fragment, doch dieses Fragment widersteht der totalen Objektivierung durch seine Fremdartigkeit selbst.
Die weibliche Gotik
Die andere Tradition, die Anna Weyants Arbeit durchdringt, ist die des weiblichen Gothic, jenes literarische Subgenre, das im 18. Jahrhundert mit Ann Radcliffe, Clara Reeve und Mary Wollstonecraft entstand. Diese Autorinnen nutzten den Rahmen des Gothic-Romans mit seinen unheimlichen Schlössern, geheimen Gängen und verfolgten Heldinnen, um die weibliche Existenz in einer patriarchalischen Gesellschaft zu erforschen. Weyant verlegt diese Tradition in das zeitgenössische Amerika der Mittelschicht und ersetzt Schlösser durch Vorstadthäuser und aristokratische Tyrannen durch heimtückische soziale Konventionen.
Die Künstlerin erwähnte ihre Faszination für die illustrierten Madeline-Bücher, diese Geschichten eines kleinen französischen Waisenmädchens in einem Pariser Internat. Die Bücher von Ludwig Bemelmans, die ab 1939 veröffentlicht wurden, zeigen eine oberflächlich charmante, aber grundlegend düstere Welt. Madeline lebt ohne Eltern, unterzieht sich einer Blinddarmoperation und trotzt den Gefahren mit beunruhigender Unbekümmertheit. Weyant besaß als Kind die Madeline-Puppen und basierte ihre erste Gemäldeserie auf diesen Figuren. Sie fragte sich: Was würde passieren, wenn diese Puppen ein wenig erwachsen würden, wenn sie in die Jugendzeit mit all ihrer Verwirrung und ihren Traumata eintreten würden?
Diese Frage ordnet sie direkt in die Tradition der weiblichen Gothic-Literatur ein. Wie viele Literaturkritiker beobachtet haben, konzentriert sich der feminine Gothic auf den Übergang von der Jugend zum Erwachsensein, auf den gefährlichen Moment, in dem das junge Mädchen seinen Eintritt in eine von Männern dominierte Welt aushandeln muss. Die Heldinnen von Radcliffe, Charlotte Brontë und Emily Brontë bewegen sich in häuslichen Räumen, die zu Gefängnissen werden, Orten der Gefahr statt der Sicherheit. Weyants Figuren bewohnen ähnliche Räume.
Girl Crying at a Party fängt dieses Gefühl sozialer Entfremdung, das der feminine Gothic immer erforscht hat, perfekt ein. Die traditionelle Gothic-Heldin fühlt sich immer leicht verstimmt, nie ganz an ihrem Platz in den sie umgebenden sozialen Strukturen. Sie blickt auf die Welt mit einer Mischung aus Faszination und Entsetzen. Die jungen Frauen bei Weyant tragen denselben Blick. Sie sind physisch anwesend, aber mental abwesend, verloren in ihren eigenen Tagträumen oder Albträumen.
Die Künstlerin erklärte, sie sei besessen von der Zeit der Adoleszenz, von jener dramatischen und traumatischen Phase zwischen Kindheit und Erwachsenenalter [3]. Der feminine Gothic hat diese Grenzzeit immer bevorzugt. Charlotte Brontës Jane Eyre beginnt als missbrauchtes Waisenkind und endet als verheiratete Frau, doch das Herz des Romans liegt in jenem Zwischenbereich von Unsicherheit und Verwandlung. Catherine aus Wuthering Heights von Emily Brontë schwankt zwischen zwei Identitäten, unfähig, sich zwischen Natur und Kultur, Wildheit und Zivilisation zu entscheiden.
Weyant malt postmoderne Gothic-Heldinnen, die diese Konflikte verinnerlicht haben. Sie fliehen nicht vor Spukschlössern, sondern vor ihren eigenen Erwartungen und Begierden. Loose Screw (2020) zeigt eine weibliche Figur in Silhouette, mit weit offenem Mund, was ein Schrei oder ein Lachen sein könnte. Der Titel deutet an, dass etwas nicht stimmt, dass die Maschinerie der normativen Weiblichkeit einen Konstruktionsfehler hat.
Der feminine Gothic hat das Übernatürliche immer als Metapher für die Zwänge verwendet, die Frauen auferlegt werden. Geister repräsentieren die unterdrückten Stimmen, Doppelgänger symbolisieren fragmentierte Identitäten, Schlösser verkörpern patriarchalische Strukturen. Weyant braucht keine wörtlichen Geister, weil ihre Figuren schon gespenstisch sind. Ihre porzellanartige Haut, ihre erstarrten Posen, ihr abwesender Blick machen sie zu Wesen, die auf halbem Weg zwischen Leben und Tod sind.
Diese gespenstische Qualität wird durch ihre Technik verstärkt. Weyant malt in dünnen, glatten Schichten und schafft Oberflächen, die fast zu perfekt sind. Ihre Figuren wirken lackiert, versiegelt unter einer transparenten Schutzschicht. Diese Technik erinnert an die viktorianischen Miniaturmaler, die Porträts kürzlich Verstorbener malten und die Toten in kostbare bewahrenswerte Objekte verwandelten. Die jungen Frauen bei Weyant besitzen diese erhaltene Qualität, als wären sie im Moment ihrer größten Schönheit präpariert worden.
Das Motiv der Puppe durchzieht ihr gesamtes Werk und stellt eine direkte Verbindung zur gotischen Tradition dar. Puppen in der gotischen Literatur sind immer beunruhigend. Sie repräsentieren die Menschheit, die von ihrem Inhalt entleert ist, die Form ohne das Wesen. Freud analysierte die Puppe als Beispiel für das Unheimlich, diese unheimliche Fremdheit, die auftaucht, wenn das Vertraute plötzlich bedrohlich wird. Eine Puppe ähnelt einem Menschen, ist aber keiner. Sie bewohnt diesen zwielichtigen Raum zwischen belebt und unbelebt.
Weyant hat buchstäblich mit Puppen gearbeitet, sie fotografiert und gemalt. Aber selbst ihre lebenden Modelle nehmen Puppeneigenschaften an. Ihre runden Gesichter, die großen Augen, die statischen Posen erinnern eher an Figuren als an Personen. Man versteht, dass die Künstlerin von diesen Merkmalen angezogen wird, der Rundheit, der Unbeweglichkeit, der künstlichen Perfektion. So schafft sie gotische Heldinnen, die ihre eigenen Gefängnisse sind. Sie sind nicht in Schlössern eingesperrt, sondern in ihren eigenen Körpern, in den Konventionen weiblicher Schönheit.
Summertime (2021) zeigt eine Frau, deren Kopf und Oberkörper auf einem Tisch neben einer Blumenvase ruhen. Die Komposition suggeriert, dass sie selbst Teil des Stillebens ist, dass sie zu einem dekorativen Objekt geworden ist wie die Blumen. Diese Objektivierung ist eine zentrale Sorge des weiblichen Gothic seit seinen Anfängen. Die Heldinnen Radcliffes laufen ständig Gefahr, zu Objekten verwandelt zu werden: zwangsverheiratet, eingesperrt oder wegen ihres Erbes ermordet.
Weyant aktualisiert diese Gefahren für das Instagram-Zeitalter. Ihre jungen Frauen sind nicht durch habgierige Barone bedroht, sondern durch den Druck, sich als perfekte Bilder darzustellen. Sie müssen sich in Puppen verwandeln, in Betrachtungsobjekte. Die Gefahr kommt ebenso von innen wie von außen. Bite (2020) zeigt eine junge Frau mit Sonnenbrille, die in den Arm eines Mannes zu beißen scheint. Es ist ein Moment der Rebellion, eine gotische Heldin, die angreift, statt zu fliehen.
Diese Dimension des Widerstands unterscheidet den weiblichen Gothic vom männlichen Gothic. Bei Matthew Lewis oder Horace Walpole sind die Heldinnen oft nur Opfer. Bei Radcliffe und ihren Erbinnen entwickeln sie Überlebensstrategien, mal subtil, mal dramatisch. Auch Weyants Figuren leisten Widerstand, aber schräg. Sie weigern sich, für die Kamera zu lächeln, sie blicken weg, sie fallen beim Treppensteigen mit ihrem Champagnerglas in der Hand.
Der weibliche Gothic erforscht auch Sexualität auf eine Art, wie es der realistische Roman damals nicht konnte. Der Schleier des Übernatürlichen ermöglichte es, sonst unaussprechliche Wünsche und Ängste anzusprechen. Weyant nutzt den Schleier der formalen Fremdheit für einen ähnlichen Effekt. Eileen (2022) zeigt eine junge Frau, die die Arme hinter dem Kopf hebt und ihr weißes Oberteil hochzieht, um ihre Unterhose zu zeigen. Die Geste ist zugleich unschuldig und sexuell aufgeladen, spontan und inszeniert.
Die Künstlerin sprach über ihr Interesse an vintage Playboy, nicht wegen seines expliziten erotischen Inhalts, sondern wegen seiner synthetischen Ästhetik und düsteren Atmosphäre. Sie liebt große blonde Haare und “wirklich große knubbelige Brüste”, behandelt sie aber mit Ironie, die verhindert, dass sie rein objektivierend werden. Ihre Frauen posieren nicht zum männlichen Vergnügen. Sie sind gefangen in ihren eigenen inneren Welten, gleichgültig dem Blick des Betrachters gegenüber.
Diese Gleichgültigkeit ist wichtig. Radcliffes gotische Heldinnen werden ständig überwacht, beobachtet und bespitzelt. Sie finden Freiheit nur in Momenten, in denen sie der Überwachung entkommen. Weyants Figuren scheinen diese Überwachung internalisiert zu haben; wir sehen sie, aber sie sehen uns nicht. Sie sind zugleich exponiert und zurückgezogen, sichtbar und unzugänglich. Diese Spannung erzeugt ein produktives Unbehagen. Wir sind Voyeurinnen einer Intimität, die uns ausschließt.
Haus Außenansicht (2023) zeigt ein dreistöckiges Holzhaus, scheinbar leer, auf eine klaustrophobische Weise beleuchtet, die eine starke psychologische Spannung erzeugt. Das Bild erinnert sofort an das Haus von Norman Bates in Psycho von Alfred Hitchcock oder das Anwesen der Schwestern Blackwood in We Have Always Lived in the Castle von Shirley Jackson. Weyant bestätigt diese Bezüge und nennt Jackson und Hitchcock als Einflüsse. Das gotische Haus ist eine eigenständige Figur, ein Raum, der die Traumata seiner Bewohnerinnen enthält und ausdrückt.
Der Titel ihrer ersten Einzelausstellung, “Welcome to the Dollhouse”, bezog sich sowohl auf ihre Gemälde von Puppenhäusern als auch auf den Film von Todd Solondz über die Grausamkeiten der Jugend. Die Ausstellung zeigte Miniaturinnenräume, bewohnt von jungen Frauen in Not. Das Puppenhaus fungiert als domestizierte Version des gothischen Schlosses, ein geschlossener, kontrollierter Raum, in dem Dramen im kleinen Maßstab stattfinden. Wie die Literaturkritikerin Susan Stewart bemerkte, ist das Puppenhaus die vollendetste Miniatur, die im Kleinen das Spannungsverhältnis zwischen innerer und äußerer Sphäre, zwischen Außenseite und Innenseite darstellt.
Weyant verwandelt ihre Leinwände in psychologische Puppenhäuser. Ihre schwarzen Hintergründe eliminieren jeden äußeren Kontext und schaffen rein innere Räume, in denen die Figuren in ihren eigenen Welten schweben. Diese Ausklammerung des sozialen Kontexts ist typisch für den weiblichen Gothic. Die normale Gesellschaft verschwindet, und die Heldin ist allein mit ihren Peinigerinnen oder ihren eigenen inneren Dämonen. Sophie (2022) zeigt eine junge Frau, die im Dunkeln steht und lächelt. Ihr heiterer Ausdruck steht in solch starkem Kontrast zum schwarzen Hintergrund, dass er eher beunruhigend als beruhigend wirkt.
Die moralische Mehrdeutigkeit des weiblichen Gothic durchdringt ebenfalls Weyants Werk. In Radcliffes Romanen wissen wir bis zum Ende nie wirklich, wer gut und wer böse ist. Die Erscheinungen täuschen ständig. Ebenso widerstehen Weyants Figuren einer einfachen moralischen Deutung. Sind sie Opfer oder Komplizinnen? Unschuldig oder berechnend? Zerbrechlich oder gefährlich? Die Künstlerin weigert sich, eine Entscheidung zu treffen. Sie hält ihre Figuren in einem Zustand produktiver Ambiguität.
Diese Ambiguität erstreckt sich auf ihre Stillleben. Drawing for Lily (2021) zeigt eine elegante Vase, einen Cremetopf mit einem Löffel und einen Revolver mit einem um den Abzug und Lauf gewickelten Band. Unschuldige Haushaltsgegenstände stehen neben dem Todesinstrument. Der Kritiker John Elderfield bemerkte, dass diese Zeichnung das richtige Gleichgewicht zwischen Ruhe und Unbehagen findet, im Gegensatz zu den statischeren Stillleben der Ausstellung. Gewöhnliche Gegenstände werden Träger diffuser Bedrohungen.
Der weibliche Gothic ist Meisterin dieser Verwandlung des Gewöhnlichen in Bedrohliches. Das tägliche häusliche Leben erweist sich als voller verborgener Gefahren. Die Heldinnen von Charlotte Brontë müssen Gefahren in Salons und Speisesälen ebenso wie in geheimen Durchgängen meistern. Weyant aktualisiert diese Wahrheit für das 21. Jahrhundert. Ihre jungen Frauen bewegen sich in einer scheinbar sicheren Welt, gepflegte Häuser, ordentliche Kleidung und frische Blumen, doch diese Welt enthält unterschwellige Gewalttaten.
Die Künstlerin beschreibt ihre Stillleben als ihren “Glücksort”, einen Zufluchtsort, an dem sie nach der Natur malen kann [4]. Doch diese glücklichen Räume werden vom Fremden und Bedrohlichen durchdrungen. Diese Durchdringung erinnert an die zentrale Strategie des weiblichen Gothic: zu zeigen, wie Strukturen, die Frauen schützen sollen, wie Ehe, Familie und Haus, zu Fallen werden können. Weyants Blumen sind abgeschnitten, sterbend, manchmal enthauptet. Die häusliche Schönheit verdeckt die Gewalt.
Ihre Farbpalette trägt zu dieser gotischen Atmosphäre bei. Dunkle Grüntöne, schmutzige Gelbtöne und verblasste Rosatöne rufen verfallene viktorianische Innenräume, verschimmelte Wandteppiche und zeitgeschwärzte Porträts hervor. Diese Farben tragen die Last der Geschichte und deuten darauf hin, dass zeitgenössische häusliche Räume von den vorherigen Frauengenerationen, die dort lebten und litten, heimgesucht werden. Der weibliche Gothic wird stets von toten Müttern, verrückten Tanten und verschwundenen Schwestern heimgesucht. Weyant malt ihre Erbinnen.
Ihre glatte und perfektionierte Technik schafft ein visuelles Paradoxon. Die Bilder gleichen Luxuswerbungen, jener eisigen Perfektion hochwertiger Modemagazine. Doch der Inhalt untergräbt diese Perfektion. Eine junge Frau, die fällt. Sterbende Blumen. Mit Bändern umwickelte Revolver. Weyant nutzt die Ästhetik der Kommerzialisierung, um gerade diese zu kritisieren. Ihre gotischen Heldinnen sind nicht in Schlössern gefangen, sondern in Bildern, Erwartungen und vorgeschriebenen Rollen.
Existieren in einem Raum der Ungewissheit
Anna Weyant schafft eine neue Form gotischer Malerei für das Zeitalter der sozialen Netzwerke. Ihre Heldinnen bewohnen einen Zwischenraum, weder ganz lebendig noch tot, weder völlig unschuldig noch vollständig korrumpiert, weder offen Opfer noch eindeutig mächtig. Sie existieren im Dazwischen, diesem Bereich der Ungewissheit, den unsere Zeit besonders schwer erträgt. Wir wollen klare Urteile oder definitive Interpretationen. Weyant weigert sich, uns diese zu geben.
Dieser Widerstand gegen Gewissheit ist ihr radikalster Akt. In einer Welt voller sofort entschlüsselbarer Bilder bleiben ihre Gemälde undurchsichtig. Sie erfordern Zeit, Aufmerksamkeit und den Willen, Ambiguität zu akzeptieren. Sie bedienen sich der Sprache konventioneller Schönheit, sprechen aber einen seltsamen Dialekt. Sie sehen aus wie Puppen, denken aber wie Menschen. Sie bewohnen häusliche Innenräume, träumen aber vielleicht von Flucht.
Ihr Gebrauch der niederländischen Maltradition ist keine simple postmoderne Zitierung. Es ist eine Behauptung des Rechts, langsam und sorgfältig zu malen, mit einer Detailgenauigkeit, die anachronistisch erscheinen mag. In einer Welt digitaler Sofortbilder setzt sie die Geduld von Öl auf Leinwand, aufeinanderfolgenden Lasuren und schrittweiser Illusionsbildung entgegen. Diese Langsamkeit ist selbst eine Form des Widerstands.
Doch sie verfällt nicht in Nostalgie. Ihre Themen sind entschieden zeitgenössisch, junge Frauen in moderner Unterwäsche, aktuelle Gegenstände, Referenzen an Popkultur. Sie malt ihre Zeit und nutzt gleichzeitig Werkzeuge der Vergangenheit. Diese produktive Spannung erzeugt einen großen Teil der Kraft ihrer Arbeit. Sie beweist, dass figurative Malerei immer noch etwas Dringendes über unsere gegenwärtige Lage zu sagen hat.
Ihre Jugend versetzt sie in eine einzigartige Position. Sie gehört zur Generation, die mit Instagram aufgewachsen ist und die innere Gewissheit hat, unter dem Druck zu stehen, sich als perfektes Bild darzustellen. Aber sie hat auch ernsthaft Kunstgeschichte studiert und sich in malerischen Traditionen vertieft. So kann sie die Bildkultur von innen heraus kritisieren und zeitlose visuelle Strategien mobilisieren.
Die Kritiker, die ihr vorwerfen, auf Nummer sicher zu gehen, verfehlen das Wesentliche. Es stimmt, dass ihre Gemälde formal nicht gewaltsam experimentell sind. Sie brechen die Darstellung nicht, fragmentieren den Raum nicht, schreien ihre Modernität nicht heraus. Aber genau diese formale Zurückhaltung ermöglicht es ihrem eigenartigen Inhalt, sich einzuschleichen. Wenn die Bilder offen verstörender wären, könnten wir sie leicht ablehnen. Ihre oberflächliche Schönheit zieht uns an und fängt uns dann ein.
Weyant arbeitet in der Tradition von Malerinnen, die visuelle Verführung nutzen, um unbequeme Botschaften zu übermitteln. John Currin, den sie als großen Einfluss nennt, tut dasselbe. Lisa Yuskavage auch. Aber sie bringt ihre eigene Sensibilität, ihren eigenen Blick als junge Frau ein, die die Rituale der Weiblichkeit mit einer Mischung aus Zärtlichkeit und Schrecken betrachtet. Sie malt von innen heraus das Erlebnis, das sie darstellt, und das macht den Unterschied aus.
Die Zukunft wird zeigen, ob sie diese produktive Spannung aufrechterhalten kann, ob sie das Abscheuliche und das Gotische weiterhin malen kann, ohne in Wiederholungen oder Selbstgefälligkeit zu verfallen. Für den Moment hat sie mit weniger als einem Jahrzehnt beruflicher Laufbahn bereits ein Werk geschaffen, das Aufmerksamkeit und Analyse verdient. Sie hat einen einzigartigen Weg durch das Minenfeld der zeitgenössischen Figürlichen Malerei gefunden.
Ihre Gemälde erinnern uns daran, dass Schönheit gefährlich sein kann, dass häusliche Innenräume Gewalt verbergen, dass junge Frauen, die wie Puppen aussehen, komplexe und dunkle Gedanken haben. Sie erinnern uns auch daran, dass Malerei, diese alte und geduldige Kunst, uns immer noch überraschen, verstören und dazu zwingen kann, genauer hinzusehen, was wir bereits zu kennen glaubten. Anna Weyant malt Oberflächen, die durchdrungen werden wollen, Erscheinungen, die Abgründe verbergen.
- Julia Kristeva, Mächte des Grauens. Essay über die Abjektion, Paris, Éditions du Seuil, 1980.
- Ayanna Dozier, “Anna Weyants unheimliche Gemälde hauchen der weiblichen Porträtmalerei neues Leben ein”, Artsy, 20. Dezember 2022
- Sasha Bogojev, “Anna Weyant heißt uns im Puppenhaus willkommen”, Juxtapoz Magazine, Januar 2020
- John Elderfield, “Verführerische Nachahmung: zu Anna Weyants Stillleben”, Gagosian Quarterly, 17. August 2023