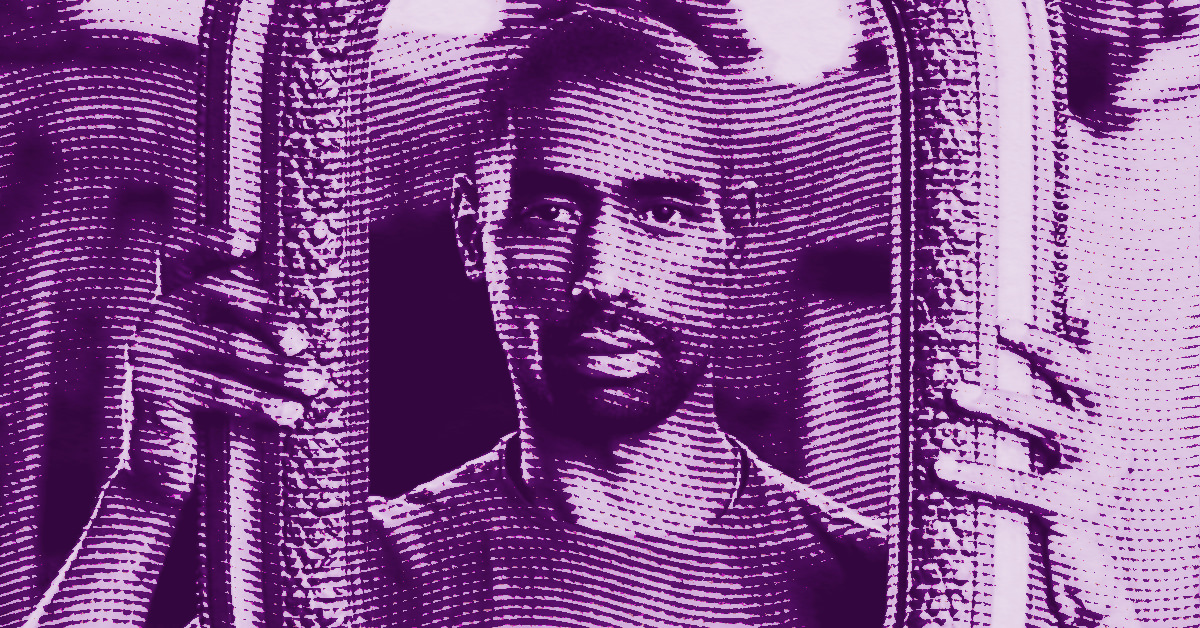Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch mit euren ästhetischen Gewissheiten und euren binären Klassifizierungen brüstet, bringt ein Mann, der am Rande von Brasília geboren wurde, stillschweigend die Codes der zeitgenössischen Darstellung durcheinander. Antonio Obá, Sohn eines Gashändlers und einer Köchin, geboren 1983 in Ceilândia, sucht nicht danach, dem internationalen Kunstmarkt zu gefallen. Er sucht danach, die verletzten Körper mit ihrer Erinnerung zu versöhnen. Und glaubt mir, dieses Ziel ist alle eure Spekulationen über den letzten New Yorker Genie-Moment wert.
Ausgebildet in den visuellen Künsten nach einem kurzen Abstecher in die Werbung, hat Obá zwanzig Jahre lang Zeichenunterricht gegeben, bevor er sich ganz seiner künstlerischen Praxis widmete. Dieser Werdegang ist nicht zufällig: Er zeugt von Geduld, einer langsamen Reife und einer Ablehnung hastiger Karriereschritte. Preisträger des PIPA-Preises 2017, vertreten in den Sammlungen der Tate Modern, der Pinault-Stiftung und des Museo Reina Sofía, schafft der brasilianische Künstler ein Werk, in dem Malerei, Skulptur, Installation und Performance in seltener Intensität miteinander in Dialog treten. Was jedoch sofort ins Auge fällt, ist seine Fähigkeit, gleichzeitig historisches Leid und spirituelle Hoffnung zu beschwören, ohne jemals in billigen Pathos zu verfallen.
Capoeira als Grammatik des Widerstands
Um Antonio Obás Herangehensweise zu verstehen, muss man zunächst erfassen, was Capoeira in der afro-brasilianischen Vorstellung bedeutet. Diese als Tanz getarnte Kampfkunst ist eine der brillantesten Erfindungen des sklavenkämpferischen Widerstands. Die geketteten Körper der Sklaven konnten eine Kampfsprache schaffen, die der Kontrolle der Herren entging, indem sie sich unter dem Anschein einer einfachen festlichen Choreographie verbarg. Diese grundlegende Zweideutigkeit, diese Fähigkeit, Unterdrückung in eine schöpferische Bewegung zu verwandeln, durchdringt die gesamte Praxis Obás.
Capoeira ist in seinem Werk nicht nur eine kulturelle Referenz: Sie bildet das strukturelle Prinzip. Wie die Capoeiristas, die sich im Kreis bewegen, ohne sich je zu berühren, und dabei eine ständige Spannung zwischen potenziellem Angriff und strategischem Rückzug aufrechterhalten, baut Obá seine Bilder in einem fragilen Gleichgewicht zwischen Gewalt und Anmut auf. Seine schlafenden oder wie verzaubert wirkenden Figuren verkörpern diese Schwebe, diesen Moment vor der Bewegung, in dem alle Möglichkeiten offenbleiben. Sind sie tot, träumen sie oder meditieren sie? Der Künstler weigert sich zu entscheiden und hält den Betrachter in dieser fruchtbaren Ungewissheit, die gerade die roda, diesen Capoeira-Kreis, auszeichnet.
Der Tanzhistoriker könnte darin eine Aneignung der Codes der zeitgenössischen Performance sehen. Das würde jedoch das Wesentliche verfehlen: Obá performt nicht für den westlichen White Cube, er aktualisiert eine Tradition des körperlichen Widerstands, die bis zu den Ladeluken der Sklavenschiffe zurückreicht. Als er 2016 diese skandalöse Performance realisiert, bei der er eine Skulptur der Jungfrau Maria aus weißem Wachs abschabt und seinen Körper mit diesem Pulver bedeckt, geht es ihm nicht um provozierende Effekthascherei. Er vollbringt eine spirituelle Capoeira-Geste: das Bild kolonialer Herrschaft in eine identitäre Verzierung zu verwandeln, das Symbol religiöser Unterdrückung in ein Material der körperlichen Aneignung zurückzudrehen.
Diese Performance löste in Brasilien derart viel Hass aus, dass er sich mehrere Monate nach Brüssel ins Exil begeben musste. Doch auch hier drängt sich der Vergleich mit der Capoeira auf: Ausweichen ist kein Fliehen, sondern eine taktische Neuorientierung. Der schwarze Körper lernt sehr früh, zwischen den Schlägen zu navigieren, die Gewalt vorauszusehen und seine Bewegungen zu kalkulieren, um zu überleben. Obá wandelt diese historische Notwendigkeit in eine künstlerische Methode um. Seine Werke sind niemals frontal: sie umrunden, deuten an, verlagern. Sie tanzen um ihr Thema herum, anstatt es direkt zu konfrontieren.
In seinen jüngsten Gemälden scheinen die Figuren in einem unbestimmten Raum zu schweben, ihre Körper mit jener Präzision gezeichnet, die jahrelange Beobachtung und akademische Zeichnungspraxis verrät. Doch diese technische Meisterschaft wird sofort durch die Einführung störender Elemente unterwandert: búzios (Kaurischnecken) anstelle der Augen, entblößte Baumzweige, die an die Hängungen von Sklaven erinnern, symbolische Tiere wie Krähen oder Affen. Diese Einbrüche brechen die klassische Harmonie der Komposition auf und bringen eine Dissonanz hinein, die an die Schläge des Berimbau erinnert, jenes brasilianische Monochordinstrument, das den Rhythmus einer Capoeira-Roda bestimmt. Der Blick kann sich nicht ausruhen: er muss sich ständig anpassen, vorwegnehmen, interpretieren.
Diese Ästhetik permanenter Spannung findet ihren vollendetsten Ausdruck in den Installationen von Obá. Seine Oratorien, bestehend aus Ex-Voto, Messingglocken und Fundstücken, schaffen Räume, in denen das Sakrale sich nie vollständig zeigt. Wie in der Capoeira, wo die Finte ein integraler Bestandteil des Spiels ist, versprechen diese Installationen eine spirituelle Offenbarung, die sie niemals ganz geben. Der Besucher muss seine Beziehung zum Werk aushandeln, seine eigene Position finden, seine eigene Ginga-Bewegung vollziehen, jenes charakteristische Schwanken der Capoeira, das den Körper in permanentem Alarmzustand hält.
Der kritische Synkretismus und die malerische Tradition
Obá auf seine brasilianische Herkunft zu reduzieren, wäre ihm gegenüber eine Beleidigung. Dieser Künstler kennt die Geschichte der westlichen Malerei perfekt und führt mit ihr einen Dialog auf Augenhöhe. Seine großen Leinwände rufen die Codes der italienischen Renaissance, die Caravaggioschen Hell-Dunkel-Kontraste, die monumentalen Kompositionen der europäischen religiösen Malerei ins Gedächtnis. Nur dass er statt blonder, blauäugiger Heiligen schwarze und gemischtrassige Körper darstellt, die mit einer Spiritualität aufgeladen sind, die sich weigert, sich zwischen dem Katholizismus seiner Eltern und den yoruba-Traditionen seiner Vorfahren zu entscheiden.
Was manche faul “Synkretismus” nennen, praktiziert Obá als eine Kritik in der Praxis. Seine Gemälde verschmelzen nicht naiv verschiedene spirituelle Traditionen: Sie legen die historischen Gewalttaten offen, die diese Verschmelzung notwendig gemacht haben. Wenn er einen jungen Mann darstellt, der steht, die Haare mit Popcorn bedeckt, mit einer Taube und einem Nest in Form eines Heiligenscheins, legt er nicht einfach die christliche Ikonographie des Heiligen Geistes über die Referenz an den Gott Omoulou, eine Yoruba-Gottheit, die mit Epidemien und Friedhöfen verbunden ist. Er zeigt, wie die schwarzen Körper der Brasilianer ihr Überleben verhandeln mussten, indem sie die Zeichen des Kolonisators annahmen und gleichzeitig heimlich ihre eigenen Glaubensvorstellungen bewahrten.
Der Künstler selbst hat es mit seltener Präzision ausgedrückt: “Die Erde bearbeiten, ernten, Pflanzen am Geruch, am Namen, an der Zeichnung ihrer Blätter erkennen, Tiere sehen, ausgebüxte Hühner fangen, bei der Hausarbeit helfen, Mais reiben, um Pamonha zu machen, still durch das Buschland gehen… ich habe schon an anderen Gelegenheiten gesagt, dass ich ein bisschen rustikal bin und natürlich trage ich diese Aspekte fast wie ein immaterielles Erbe, das mich mit den verstorbenen Wesen verbindet” [1]. Dieses “immaterielle Erbe”, von dem er spricht, ist keine folkloristische Nostalgie: Es ist eine Arbeitsmethode, eine Art, die Malerei zu nähern, wie man eine Pflanze nähert, durch Berührung, Geruch, körperliche Intuition statt durch abstrakte Konzepte.
Obá wählt übrigens seine Farben aus der Palette der brasilianischen Landhäuser: diese verblassten Gelb-, Rosa-, Blau- und Grüntöne, die durch Mischen von Wasser, Kalk und Kreidepulver entstehen. Diese volkstümlichen Farbtöne, die die Zeit unregelmäßig gemacht hat, tragen eine kollektive Erinnerung in sich. Sie verankern seine Figuren in einer historischen Kontinuität, die das Individuum übersteigt und ganze Gemeinschaften berührt. Diese Aufmerksamkeit für Baumaterialien, für Pigmente des täglichen Lebens, offenbart einen Künstler, der die modernistische Trennung zwischen hoher Kunst und Volkskultur ablehnt.
Die weißen Spitzen, die seine schwarzen Figuren umschließen, sind keine bloßen dekorativen Ornamente. Sie rufen Todesgewänder hervor, die Leichentücher von Körpern, die bei der Überquerung des Atlantiks verschwunden sind, jene Millionen Afrikaner, deren Körper die Fische des Ozeans ernährt haben. Die Búzios, die manchmal die Augen seiner Figuren ersetzen, sind nicht nur Wahrschalmuscheln: Sie wurden auch als Zahlungsmittel verwendet und erinnern daran, dass schwarze Körper lange nach ihrem Handelswert bewertet wurden. Jedes ikonographische Element bei Obá funktioniert auf mehreren Ebenen, verweigert eine eindeutige Lesart und verlangt vom Betrachter, unter die Oberfläche zu graben.
Diese semiotische Komplexität ist kein Selbstzweck. Sie entspricht der Realität einer brasilianischen Identität, die auf Schichten von Gewalt, erzwungener Vermischung, kultureller Aneignung und hartnäckigem Widerstand aufgebaut ist. Obá versucht nicht, diese Fäden zu entwirren: Er präsentiert sie in ihrem Gewirr, in ihrer produktiven Verwirrung. Seine Gemälde sind geschichtete Anhäufungen, in denen jede Bedeutungsschicht gleichzeitig eine andere überdeckt und enthüllt.
Im Gegensatz zu Künstlern, die sich auf eine phantasierte afrikanische Authentizität oder eine vollständige Assimilation an westliche Normen berufen, nimmt Obá seine Zwischenstellung voll an. Er hat die europäische Kunstgeschichte studiert, beherrscht die akademischen Techniken des Zeichnens und Malens, kennt die Regeln der klassischen Komposition. Aber statt sie gehorsam anzuwenden, verwendet er sie zweckentfremdet, um Geschichten zu erzählen, die diese Tradition nie hören wollte. Er benutzt die Grammatik des Meisters, um die Sprache des Sklaven zu sprechen.
In einem kürzlichen Interview erklärte Obá: “Poesie hat kein Ende. Wenn sie eines hätte, wären wir Wesen, deren Sprache tot ist” [2]. Dieser Satz fasst seinen künstlerischen Ansatz perfekt zusammen: die Ablehnung eines endgültigen Sinnes, das Werk offen für vielfältige Interpretationen zu halten, dieses Lebenskraftpotenzial zu bewahren, das jede wahre Schöpfung auszeichnet. Seine Gemälde übermitteln keine endgültige Botschaft, sie stellen Fragen, die jeder Betrachter gemäß seiner eigenen Erfahrung, seiner eigenen Geschichte lösen muss.
Eine politische Intimität
Was Antonio Obá von so vielen zeitgenössischen Künstlern unterscheidet, die Rassenfragen instrumentalisieren, um sich eine Marktlegitimität zu verschaffen, ist die Fähigkeit, das Werk in einer Intimitätsebene zu halten und dabei eine unbestreitbare politische Ladung zu tragen. Seine Bilder schreien ihr Engagement nicht heraus: sie flüstern es, deuten es an, verkörpern es in diskreten Gesten, die gerade deshalb umso eindrucksvoller sind.
Schauen Sie sich dieses Gemälde an, in dem ein vierjähriges Mädchen, das von der Polizei in einer Favela getötet wurde, den heiligen Antonius in einer Familienszene ersetzt, die von einem Kinderfoto des Künstlers inspiriert ist. Dieser Austausch erzeugt einen schwindelerregenden Zeitsprung: die Unschuld der Kindheit prallt auf Polizeigewalt, die intime Sphäre persönlicher Erinnerung lädt sich mit einer kollektiven traumatischen Erinnerung auf, die religiöse Ikonographie offenbart ihre Ohnmacht angesichts sozialer Ungerechtigkeit. All das ohne ein erklärendes Wort, ohne einen Slogan, ohne jene militante Großspurigkeit, die viele engagierte Werke schwächt.
Obá arbeitet im Cerrado, jener Savannenregion im zentral-westlichen Brasilien, fernab der künstlerischen Metropolen. Diese geografische Wahl ist kein Zufall: sie zeugt von einer Ablehnung der Zentralität, vom Willen, vom Rand aus zu denken. Zwanzig Jahre lang unterrichtete er bildende Kunst für benachteiligte Jugendliche, vermittelte technisches Wissen und entwickelte zugleich seine eigene künstlerische Forschung. Diese Geduld, diese Treue zu einem Territorium und einer Gemeinschaft liest man in jedem Werk. Nichts ist überstürzt, nichts wird der Dringlichkeit der Anerkennung geopfert.
Die Körper, die er darstellt, tragen Spuren dieser Zeitdauer. Sie sind nie in spektakulärer Aktion: sie schlafen, träumen, meditieren oder warten. Diese scheinbare Bewegungslosigkeit verbirgt eine gewaltige innere Spannung. Wie jene Pflanzen des Cerrado, die erst immense Wurzeln unter der Erde ausbilden, bevor sie den kleinsten sichtbaren Trieb hervorbringen, scheinen Obás Figuren ihre Energie aus unsichtbaren Tiefen zu ziehen. Sie verkörpern einen Widerstand, der sich nicht über Machtdemonstration vollzieht, sondern über Ausdauer, Belastbarkeit, die Fähigkeit, Zeit zu durchqueren, ohne sich selbst zu verleugnen.
Der Künstler mythologisiert den schwarzen Körper nicht. Er zeigt ihn in seiner Komplexität, seinen Widersprüchen und Schattenzonen. Seine verkleideten Selbstporträts, denn viele seiner männlichen Figuren ähneln ihm, verfallen niemals in Narzissmus. Sie hinterfragen vielmehr, was es bedeutet, in einem schwarzen Körper im zeitgenössischen Brasilien zu leben, einem Körper, der zugleich fetischisiert und verachtet, erotisiert und kriminalisiert wird, in Fußballstadien gefeiert und in den Favelas erschossen. Obá malt diese identitäre Schizophrenie mit einer Klarheit, die jegliche einfache Trostversprechung ablehnt.
Deshalb verdient sein Werk mehr als die reduktiven Deutungen, die ihm manchmal angedichtet werden. Obá ist weder ein einfacher Ethnograph seiner eigenen Kultur, noch ein geschickter Identitätsunternehmer, der seine Differenz auf dem globalen Kunstmarkt auszuhandeln weiß. Er ist ein Künstler im vollen Sinne des Wortes: jemand, der Formen erfindet, die eine Welterfahrung enthalten und ausdrücken können, die sich nicht auf bestehende Kategorien reduzieren lässt. Jemand, der sich weigert, zwischen Tradition und Moderne, zwischen Lokalem und Universellem, zwischen Engagement und Poesie zu wählen.
Seine jüngsten Werke, die 2024 im Centre d’Art Contemporain de Genève und 2025 im Grand Palais ausgestellt werden, bestätigen diese besondere Entwicklung. Sie zeigen einen Künstler, der seine Forschung vertieft, ohne sich zu wiederholen, der neue Wege erkundet und dennoch seinen grundlegenden Anliegen treu bleibt. Die Reife seiner Linie, die Raffinesse seiner Kompositionen und der Reichtum seiner kulturellen Referenzen zeugen von einem Schöpfer, der in seine volle Kraft eingetreten ist.
Und doch lebt und arbeitet Obá trotz internationaler Anerkennung (die Fondation Pinault, die Tate Modern, Biennalen) weiterhin in Brasília. Diese Ablehnung der freiwilligen Exilierung, die Hartnäckigkeit, in seiner Heimat verwurzelt zu bleiben, sagt Wesentliches über sein Verständnis von Kunst aus. Für ihn ist Schaffen keine Aktivität, die losgelöst stattfindet, im neutralisierten und klimatisierten Raum internationaler Institutionen. Es ist eine Geste, die in einer bestimmten Geografie, einer besonderen Geschichte, einem Netzwerk konkreter Beziehungen verankert ist.
Die neuen Generationen brasilianischer Künstler erkennen ihn als einen Älteren an, der Wege eröffnet hat, ohne sie aufzuzwingen, der gezeigt hat, dass es möglich ist, einen Platz in der globalen Kunstwelt zu erobern, ohne seine Einzigartigkeit aufzugeben. Diese diskrete, fast unsichtbare Weitergabe ist vielleicht der politischste Aspekt seiner Arbeit. In einem Land, in dem soziale und rassische Ungleichheiten tiefgreifend bleiben, in dem der Zugang zur künstlerischen Bildung ein Klassenprivileg ist, verkörpert Obá die Möglichkeit eines anderen Werdegangs.
Ja, Sie können weiterhin über seinen Marktwert spekulieren, seine Gemälde wie exotische Trophäen sammeln oder sie auf ihre dekorative Dimension reduzieren. Oder Sie können zulassen, dass Sie die Komplexität dessen, was sie bieten, herausfordert. Sie können das Unbehagen eines Werks akzeptieren, das Sie nicht beruhigt, das seine Schlüssel nicht sofort preisgibt, das verlangt, dass Sie die Bewegung auf es zu machen, anstatt umgekehrt. Genau das tun große Künstler: Sie geben uns nicht, was wir erwarten, sie zwingen uns, unsere Erwartungen neu zu konfigurieren.
Antonio Obá gehört zu jener seltenen Reihe von Schöpfern, die die biografische Notwendigkeit in ästhetische Notwendigkeit verwandeln, die ihre marginale Position nicht als Handicap verstehen, das es zu kompensieren gilt, sondern als einzigartige Perspektive, von der aus die Welt betrachtet wird. Sein Werk plädiert nicht, fordert nicht und entschuldigt sich nicht: Es existiert einfach, kraftvoll, unbestreitbar. Und genau diese souveräne Präsenz, diese Ablehnung des Flehens ebenso wie der spektakulären Konfrontation, macht es zu einem wesentlichen Beitrag zur zeitgenössischen Kunst.
- Zitat von Antonio Obá, Mendes Wood DM, São Paulo, verfügbar auf der Website der Galerie Mendes Wood DM.
- Antonio Obá, Interview mit Nicolas Trembley, Numéro Magazine, Februar 2025.