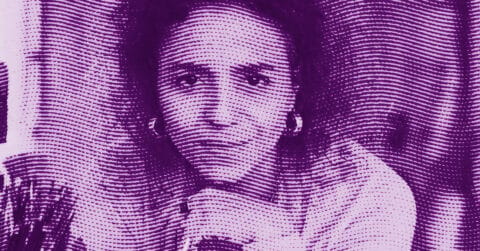Hört mir gut zu, ihr Snobs, es ist Zeit, über Ayako Rokkaku (geboren 1982 in Chiba, Japan) zu sprechen, diese Künstlerin, die mit ihren acrylbemalten Händen die asiatischen Auktionen sprengt.
Während oft jeder künstlerische Schritt berechnet und jeder Pinselstrich von Kuratoren in schwarzen Anzügen bei lauwarmem Champagner bis zur Erschöpfung theoretisiert wird, kommt Rokkaku barfuß, die Hände voller Farbe, und schleudert dem Kunstmarkt ihre viszerale Sicht der Schöpfung entgegen. Sie malt direkt mit den Fingern, ohne Vorzeichnung, als wolle sie sagen: “Eure Theorien über Kunst? Die wasche ich mit Acrylfarbe von mir.”
Das erste Merkmal ihrer Arbeit ist dieser körperliche, fast primitive Ansatz der Malerei. Sie benutzt keine Pinsel, die zu bürgerlich, zu konventionell sind. Nein, sie taucht ihre Hände direkt in die Farbe, wie ein Kind, das die taktile Freude am Schaffen entdeckt. Diese Methode erinnert an die Action Paintings von Jackson Pollock, jedoch ohne die männliche Mystifikation à la Greenberg. Rokkaku verwandelt den Akt des Malens in eine Performance, bei der der ganze Körper an der Schöpfung teilnimmt. Es ist Yves Klein ohne Blau, Ana Mendieta ohne Blut, eine Form von Body Art, die farbige Spuren statt dramatischer Abdrücke hinterlässt.
Dieser körperliche Ansatz der Malerei spiegelt die phänomenologische Philosophie von Maurice Merleau-Ponty wider. In “Das Auge und der Geist” (1964) schrieb er: “Der Maler bringt seinen Körper mit… Indem der Maler seinen Körper der Welt leiht, verwandelt er die Welt in Malerei”. Rokkaku verkörpert diese Idee wortwörtlich. Ihre Finger werden zu direkten Erweiterungen ihres schöpferischen Bewusstseins und löschen die traditionelle Distanz zwischen der Künstlerin und ihrem Werk aus, die der Pinsel vorgibt. Es ist eine Rückkehr zu dem, was Walter Benjamin als die taktile Erfahrung der Kunst bezeichnete, bevor die mechanische Reproduktion alles sterilisiert hat.
Das zweite Merkmal ihres Werks liegt in ihrem einzigartigen visuellen Universum, bevölkert von weiblichen Figuren mit übergroßen Augen und verlängerten Gliedmaßen, die in abstrakten Räumen mit leuchtenden Farben schweben. Diese Figuren, oft als “kawaii” (niedlich auf Japanisch) beschrieben, sind in Wirklichkeit viel komplexer. In ihnen liegt eine verstörende Fremdheit, die Freud hätte freuen können. Diese Mädchen mit manchmal leerem, manchmal vorwurfsvollen Blick sind Bewohner einer Welt, in der Unschuld neben existenzieller Beklemmung existiert.
Ihre Werke erinnern an das, was Gaston Bachelard in “Die Poetik der Tagträumerei” (1960) als “kosmische Kindheit” beschrieb, einen Zustand, in dem die Grenzen zwischen Realem und Imaginärem verschwimmen. Im Gegensatz zur traditionellen Kindheitsdarstellung sind Roktakus Figuren jedoch nicht einfach nur niedlich oder beruhigend. Sie besitzen eine beunruhigende Ambivalenz, die sie näher an die beklemmenden Puppen von Hans Bellmer bringt als an kommerzielle Manga-Figuren.
Diese Dualität zwischen scheinbarer Naivität und zugrunde liegender Komplexität macht Rokkaku zu einer besonders relevanten Künstlerin in unserer Zeit von Spannungen zwischen Authentizität und Künstlichkeit. Ihre Werke sind so gefragt geworden, dass ihre Leinwände jetzt mehrere hunderttausend Euro erzielen und sie somit die sechstwertvollste japanische Künstlerin aller Zeiten ist. Nicht schlecht für jemanden, der damit angefangen hat, auf in den Parks von Tokio gesammeltem Karton zu malen.
Der kommerzielle Erfolg könnte als Verrat an der ursprünglichen Spontaneität ihres Ansatzes angesehen werden. Doch Rokkaku bewahrt eine bemerkenswerte Integrität in ihrer Praxis. Ob sie auf einer sieben Meter großen Leinwand oder auf einem Stück Karton malt, sie behält denselben direkten, physischen, fast primitiven Zugang zur Schöpfung bei. Sie setzt ihre Live-Mal-Performances fort und verwandelt den kreativen Akt in ein öffentliches Spektakel, entmystifiziert den künstlerischen Prozess und theatralisiert ihn zugleich.
Ihre jüngste Arbeit hat sich auf Skulptur ausgeweitet, insbesondere in Bronze und Glas, was beweist, dass ihre magischen Finger die Materie in all ihren Formen formen können. In diesen dreidimensionalen Werken finden sich dieselben Spannungen zwischen “kawaii” und Unheimlichem, zwischen der Spontaneität der Geste und der Dauerhaftigkeit des Materials. Ihre Glas-Skulpturen, die in Murano geschaffen wurden, sind besonders faszinierend, als hätten ihre gemalten Figuren plötzlich im realen Raum Gestalt angenommen, eingefroren in ihrer Bewegung durch die Umwandlung geschmolzenen Glases.
Der Werdegang von Rokkaku ist eine meisterhafte Ohrfeige für all jene, die glauben, dass Kunst heutzutage zwangsläufig konzeptuell, distanziert und intellektualisiert sein muss. Sie beweist, dass es noch möglich ist, eine kunstvolle, direkte und emotional aufgeladene Kunst zu schaffen, ohne sich der Bequemlichkeit oder Selbstgefälligkeit hinzugeben. Ihr wachsender Erfolg, besonders in Asien, wo ihre Werke Rekordpreise erzielen, zeigt, dass es immer noch ein Publikum für Kunst gibt, die sowohl das Herz als auch den Geist anspricht. Rokkaku erinnert daran, dass Schöpfung noch ein Akt reiner Freude, Entdeckung und uneingeschränkter Erkundung sein kann. Sie ist der lebende Beweis dafür, dass Unschuld, wenn sie von einer starken künstlerischen Vision und unbestreitbarer technischer Meisterschaft getragen wird, eine revolutionäre Kraft sein kann.
Ihre Werke erinnern uns an das, was Paul Klee in seiner “Theorie der modernen Kunst” schrieb: “Kunst reproduziert nicht das Sichtbare, sie macht sichtbar.” Rokkaku macht eine innere Welt sichtbar, in der Freude und Sorge, Unschuld und Bewusstsein, Spontaneität und Kontrolle in einem zerbrechlichen und faszinierenden Gleichgewicht koexistieren. Sie lädt uns ein, unsere eigenen Hände in die Materie unserer Träume zu tauchen, jene kreative Freiheit wiederzufinden, die wir alle als Kinder kannten, bevor uns die Welt lehrte, sauber und ordentlich zu bleiben.
Sie ist zu einer unverzichtbaren Künstlerin der zeitgenössischen Szene geworden, die in renommierten Institutionen wie dem Long Museum in Shanghai oder der Kunsthal in Rotterdam ausstellt. Bemerkenswert ist, dass sie es geschafft hat, den Kern ihrer künstlerischen Herangehensweise trotz kommerziellem Erfolg zu bewahren. Sie malt weiterhin mit ihren Händen, schafft Live-Performances und erweitert die Grenzen ihrer Kunst, während sie ihrer ursprünglichen Vision treu bleibt.
Wenn einige Kritiker in ihrer Arbeit lediglich eine Erweiterung der japanischen “Kawaii”-Kultur sehen, haben sie nicht genau genug hingeschaut. Ihre Werke sind durchzogen von einer ständigen Spannung zwischen Charmantem und Beunruhigendem, Spontanem und Beherrschtem, Kindlichem und Tief Ernstem. Genau diese Komplexität macht ihre Kunst zu mehr als nur einem Ausdruck der japanischen Popkultur.
Ihr Werdegang ist umso bemerkenswerter, da sie Autodidaktin ist. Während die Abschlüsse großer Schulen oft als Eintrittskarte dienen, hat sie sich allein durch die Kraft ihrer Vision und Praxis durchgesetzt. Sie könnte nahezu das verkörpern, was Dubuffet in der Art Brut suchte: eine Schöpfung frei von jeglicher kultureller Konditionierung, obwohl ihre Arbeit paradoxerweise tief in der zeitgenössischen visuellen Kultur verwurzelt ist.
Rokkaku pendelt zwischen Berlin, Porto und Tokio, schafft eine Kunst, die kulturelle Grenzen transzendiert und zugleich tief persönlich bleibt. Sie repräsentiert eine neue Generation globaler Künstlerinnen, die in ihren kulturellen Wurzeln schöpfen und gleichzeitig eine universelle visuelle Sprache schaffen. Ihr wachsender Erfolg zeugt von einem Durst nach Aufrichtigkeit und Authentizität in einem intellektuellen Umfeld, das oft von Haltung dominiert wird.
Es ist faszinierend zu sehen, wie sie es geschafft hat, etwas, das nur eine originelle Technik hätte sein können, mit den Fingern zu malen, in eine echte künstlerische Signatur zu verwandeln. Dieser taktile Ansatz in der Malerei ist eine Philosophie der Schöpfung, die den Körper und den Instinkt ins Zentrum des künstlerischen Prozesses stellt. Rokkaku erinnert uns daran, dass Kunst noch immer eine direkte, leidenschaftliche und emotional aufgeladene Erfahrung sein kann. Sie beweist, dass Einfachheit kein Feind der Tiefe ist und dass Spontaneität mit technischer Meisterschaft koexistieren kann.
Ihr kommerzieller Erfolg könnte als eine Form der Vereinnahmung durch den Kunstmarkt gesehen werden, aber er zeugt auch von einem echten Durst nach einer Kunst, die direkt die Emotionen anspricht und nicht durch endlose Seiten kritischer Theorie erklärt werden muss, um geschätzt zu werden. In unserer oft abgeschotteten und elitären Kunstszene ist das eine frische Brise.