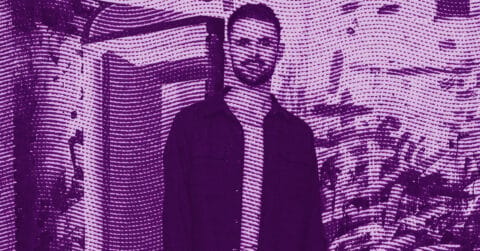Hört mir gut zu, ihr Snobs: Bianca Bondi gehört nicht zu denen, die euch gleichgültig lassen. Diese südafrikanisch-italienische Künstlerin, geboren 1986, entfaltet seit mehr als einem Jahrzehnt ein Universum, in dem lebendige Materie mit dem Unsichtbaren in Dialog tritt, in dem verkohlte Schränke neben Salzkristallen stehen, in dem die Architektur der Erinnerung sich mit den Überresten antiker Zivilisationen vermischt. Stipendiatin der Villa Medici im Jahr 2024 und Finalistin des Marcel-Duchamp-Preises 2025, etabliert sich Bondi als unverzichtbare Figur der zeitgenössischen Kunst, nicht trotz, sondern gerade wegen der ruhigen Unverschämtheit ihrer Praxis. Denn dort, wo andere versuchen würden, die Natur zu zähmen, gibt sie ihr ihre Rechte zurück; dort, wo manche die Zeit einfrieren wollen, feiert sie deren unabwendbaren Lauf.
Architektur als Theater der Abwesenheit
Bondis Arbeit entfaltet sich vor allem in einer Meditation über das Wohnen, über jene Strukturen, die wir bauen, um uns vor der Welt zu schützen und die schließlich die Spuren unseres flüchtigen Daseins tragen. Ihre Installation Silent House, präsentiert im Musée d’Art Moderne de Paris, veranschaulicht diese Reflexion eindrucksvoll: ein ganzes Haus, das seiner Bewohner beraubt, aber von deren geisterhafter Präsenz erfüllt ist. Dieses Haus ist nicht einfach ein verlassenes häusliches Umfeld; es ist eine sensible Kartografie einer verlorenen Intimität, eine topografische Erfassung dessen, was nach dem Weggang bleibt. Abgenutzte Möbel, eine freistehende Badewanne, der rostige Metallbettgestell formen eine Geographie der Verlassenheit, die nichts Mitleiderregendes hat. Im Gegenteil, diese Objekte strahlen eine paradoxe Würde aus, die der stillen Zeugen, die die Körper und Seelen haben ziehen sehen.
Die Künstlerin beschränkt sich nicht darauf, Möbel in einem Ausstellungsraum zu arrangieren. Sie organisiert eine wahre architektonische Dramaturgie, in der jedes Element eine genaue Rolle in der Narration der Abwesenheit spielt. Der verkohlte Schrank, senkrecht an der Wand befestigt, ist nicht mehr einfach ein Aufbewahrungsmöbel, sondern wird zum Tor in ein unbestimmtes Anderswo, zum verkohlten Reliquienschrein einer Erinnerung, die nicht erlischt. Dieser Akt der Vertikalisierung verwandelt die horizontale Nutzung des Wohnens in eine nahezu religiöse Erhebung und suggeriert, dass Architektur nie nur funktional, sondern immer symbolisch ist. Bondi selbst sagt: “Ich habe es immer geliebt, die Altäre zu betrachten, diese Räume, die für etwas Größeres als wir, für die Götter, gedacht sind”[1]. Diese Aussage erleuchtet ihre gesamte Praxis: jede Installation wird zu einem säkularen Altar, gewidmet den geheimnisvollen Kräften, die die Materie beseelen.
Architektur bei Bondi ist niemals statisch. Sie ist Prozess, Metamorphose und Zersetzung. Die Salzteiche, die sie in ihre Installationen integriert, funktionieren wie chemische Uhren, die den Lauf der Zeit nicht durch das Bewegen der Zeiger, sondern durch die langsame Kristallisation des Salzes auf den Oberflächen anzeigen. Salz, ein wiederkehrendes Material in ihrem Werk, besitzt diese doppelte Eigenschaft, gleichzeitig Konservierungsmittel und Korrosionsmittel zu sein. Es bewahrt und zerstört gleichzeitig, wie das menschliche Gedächtnis, das das verzerrt, was es zu bewahren vorgibt. In Silent House überzieht das Salz allmählich die Gegenstände mit einer weißen Schicht, als ob das Haus selbst seine eigene Bestattungsmaterie, seinen eigenen mineralischen Leichentuch ausscheidet.
Diese Aufmerksamkeit für Schränke, Vitrinen, Korpusse offenbart eine Obsession für die Architektur des Intimen, diese Mikro-Räumlichkeiten der Aufbewahrung, in denen sich unser Verhältnis zu den Gegenständen konzentriert. Bondi sammelt alte Möbel, besonders diese pharmazeutischen Schränke, bei denen man nicht mehr weiß, ob sie Gewürze oder Medikamente, Heilmittel oder Gifte enthielten. Diese semiologische Unentschiedenheit gefällt ihr: Sie verwischt die Grenzen zwischen Pflege und Gefahr, zwischen Küche und Labor, zwischen Häuslichkeit und Wissenschaft. Die Schränke werden dann zu Echokammern, in denen alle möglichen Geschichten der Gegenstände mitschwingen, die sie beherbergt haben. Ihre Aura, um ein von Bondi geschickt verwendetes Konzept aufzugreifen, stammt nicht von ihrer formalen Schönheit, sondern von ihrer Fähigkeit, stumme Zeugen wiederholter Gesten zu sein, von Händen, die im Halbdunkel nach einer Flasche suchten.
Das Haus nach Bondi ist niemals in sich geschlossen. Es fließt über, es dehnt sich aus, es kontaminiert den Ausstellungsraum. Die Installationen schaffen Innenlandschaften, in denen die Besucherin nicht mehr genau weiß, ob sie ein Zimmer, einen Garten oder ein Heiligtum betritt. Diese Vermischung der Gattungen ist beabsichtigt: Sie zielt darauf ab, die ursprüngliche Erfahrung des Wohnens nachzubilden, bevor sich Architektur in getrennte Räume und getrennte Funktionen kodifizierte. Wenn Bondi drei Tonnen Salz auf den Boden aufträgt, schafft sie keinen bloßen visuellen Effekt; sie verwandelt den Boden in einen mineralischen Strand, in eine häusliche Wüste, in die der Fuß einsinkt wie in chemischen Schnee. Der Boden wird instabil, beunruhigend, und diese physische Instabilität wird durch eine zeitliche Instabilität ergänzt: Sind wir vor oder nach der Katastrophe? In einem Raum in Ruinen oder in Entstehung?
Der italienische Architekt Carlo Scarpa sagte, dass “Architektur die Kunst ist, Ruinen zu bauen”. Bondi scheint diese Maxime wörtlich zu nehmen: Sie baut zeitgenössische Ruinen, Räume, die bereits Spuren ihrer zukünftigen Zersetzung in sich tragen. Aber diese Ruinen sind nicht melancholisch. Sie vibrieren mit einer besonderen Energie, der der andauernden Metamorphosen, der chemischen Prozesse, die die Materialien langsam verwandeln. Feuchtigkeit dringt ein, Kupfer überzieht sich mit Grünspan, Pflanzen trocknen aus und regenerieren sich dann. Das Haus lebt, im buchstäblichsten Sinne, und dieses autonome Leben der Materialien entzieht sich teilweise der Kontrolle der Künstlerin. Bondi gibt das gern zu: “Die Materialien leben ihr eigenes Leben. Ich sage gern, dass ich die Bedingungen schaffe, in denen ich eine Vorstellung davon habe, was passieren wird, aber dann machen die Materialien ihr eigenes Ding” [2].
Die Schichten der Geschichte und die vergessenen Rituale
Wenn die häusliche Architektur Bondi den räumlichen Rahmen für ihre Installationen bietet, so schenkt ihr die alte Geschichte die notwendige zeitliche Tiefe zur Ausarbeitung ihrer persönlichen Mythologien. Die Künstlerin begnügt sich nicht damit, sich auf die Vergangenheit zu beziehen; sie ruft sie herbei, belebt sie neu, lässt sie mit der Gegenwart in einem nichtlinearen Zeitverlauf in Dialog treten, in dem das pharaonische Ägypten der imperialen Rom und dem post-apartheid Südafrika begegnet. Diese historische Polyphonie ist nie umsonst: Sie erfüllt das Bedürfnis, die künstlerische Praxis in eine lange Genealogie einzuordnen, die die zeitgenössischen Moden übersteigt und sich in die Dauer der Zivilisationen einschreibt.
Der Aufenthalt in der Villa Medici hat diese Meditation über die Geschichte intensiviert. Rom, mit seinen archäologischen Schichten und seinen architektonischen Zeugnissen, bot ein ideales Terrain für eine Künstlerin, die sich mit Lebens- und Todeszyklen beschäftigt. Bondi entwickelte dort ein Projekt des “Rewildings” des Bosco, dieses geheimnisvollen Eichenwalds der französischen Akademie in Rom. Das Konzept des Rewildings, entlehnt aus der Naturschutzbiologie, erhält bei ihr eine symbolische Dimension: Es geht nicht nur darum, die Natur sich selbst zurückzugeben, sondern darum, die zeitgenössischen künstlerischen Praktiken mit alten Ritualen zu verbinden, die nach und nach vergessen oder unterdrückt wurden. Die verwaisten Bienenstöcke, die sie durch das Aufstellen eines Retabels aus dem 19. Jahrhundert, das mit Pheromonen und antiken Essenzen beschichtet ist, reaktiviert hat, zeugen von diesem Willen, Brücken zwischen den Epochen, zwischen spirituellen Praktiken und Ökologie zu schlagen.
Die römischen Amphoren, die sie in ihre Installationen integriert, sind keine bloßen klassischen Referenzen. Sie fungieren als symbolische Behälter, die Jahrtausende überdauert haben und nacheinander Wein, Öl, Honig, Parfüms getragen haben. Diese Gefäße zeugen von einer Zivilisation, die Flüssigkeiten, Essenzen und Substanzen eine große Bedeutung beimaß. Bondi reaktiviert diese Aufmerksamkeit für flüssige Materialien, indem sie ihre eigenen, im Laufe der Zeit sich verändernden Farb-Lösungen schafft. Das Blau wird zu Flieder, das Flieder tendiert ins Purpur, in einer langsamen Chromatik, die sowohl an antike Färbemittel als auch an chemische Laborreaktionen erinnert. Diese Farbbecken sind nicht bloße Dekorationselemente: Sie sind biologische Uhren, die den Zeitverlauf auf molekularer Ebene markieren.
Das alte Ägypten stellt eine weitere wichtige Referenz in Bondis Arbeit dar, besonders durch die Verwendung von Amarant. Diese Pflanze, die sie „wegen ihrer Rolle in den Begräbniszeremonien des antiken Ägypten und ihrer ästhetischen Qualitäten” schätzt, verkörpert die Kontinuität zwischen rituellen Praktiken und zeitgenössischer Sensibilität. Die Amarante fallen und fließen wie Tränen und schaffen eine pflanzliche Poesie der Melancholie, die daran erinnert, dass Schönheit oft im Verfall und der Vergänglichkeit liegt. Indem Bondi Pflanzen mit historischer Symbolkraft wählt, lehnt sie die sterile Neutralität mancher zeitgenössischer künstlerischer Praktiken ab und übernimmt voll und ganz die spirituelle und kultische Dimension ihrer Arbeit.
Salz, wieder einmal, besitzt eine erhebliche historische und anthropologische Dimension. Seit der Antike zur Konservierung von Lebensmitteln verwendet, in allen Religionen und spirituellen Praktiken als Mittel der Reinigung und des Schutzes präsent, durchquert Salz die Zivilisationen wie ein roter Faden. Bondi nutzt diese symbolische Allgegenwart und verbindet sie mit ihren zeitgenössischen chemischen Eigenschaften: Natriumchlorid als Konservierungsmittel, aber auch als korrosives Mittel, das verändert und transformiert. In ihren Installationen ist Salz niemals unschuldig; es trägt die ganze Geschichte der Körper in sich, die es konserviert hat, der Wunden, die es desinfiziert hat, der Bündnisse, die es besiegelt hat. Wenn sie ein Walskelett mit Harz aus Salzkristallen überzieht, illustriert sie nicht nur einen natürlichen Prozess; sie reaktiviert ein archaisches Begräbnisritual, bei dem das Meer zurücknimmt, was ihm gehört.
Geschichte ist bei Bondi niemals akademisch oder distanziert. Sie verkörpert sich in konkreten Gesten: einen Schrank verbrennen, um ihn zu reinigen, ein Kruzifix mit Bienenwachs bestreichen, um es zu einem heidnischen Reliquiar zu verwandeln, einheimische Pflanzen setzen, um das Werk im Territorium zu verankern. Diese Gesten gehören zu einem universellen anthropologischen Repertoire, das in allen Kulturen zu finden ist: Feuer als Mittel der Transformation und Regeneration, Wachs als heilige Materie, produziert von Bienen, Pflanzen als Vermittler zwischen der Welt der Lebenden und der Toten. Indem sie diese Elemente mobilisiert, macht Bondi keinen Folklore- oder Exotismus-Einsatz: sie reaktiviert uraltes Wissen, das von der modernen Rationalität marginalisiert wurde, aber weiterhin auf der tiefsten Ebene unseres kollektiven Psychismus resoniert.
Die Praxis der Wicca-Magie, die sie seit ihrer Kindheit beansprucht, ist in ihrem Ansatz nicht nebensächlich. Sie erklärt: “Ich denke, es ist meine Magie-Praxis, die mir ermöglicht hat, die Kunst zu entdecken, die dann eine Erweiterung der Magie wurde und die Führung übernahm. Aber heute spüre ich das Bedürfnis, die Magie in die Kunst zurückzubringen” [3]. Diese Erklärung könnte naiv oder provokativ erscheinen, wenn sie nicht durch eine rigorose Praxis und ein profundes Materialwissen untermauert wäre. Bondi spielt nicht die Hexe: Sie wendet auf die zeitgenössische Kunst Methodologien an, die aus spirituellen Traditionen stammen, welche den Objekten und Substanzen eine Handlungskraft zuschreiben. Dieser Ansatz bringt sie paradoxerweise bestimmten neueren philosophischen Theorien nahe, insbesondere denen von Bruno Latour zu den “aktanten Objekten”, obwohl Bondi diese Schlussfolgerungen auf einem radikal anderen Weg erreicht, dem des sinnlichen Erlebens statt der theoretischen Spekulation [4].
Geschichte ist nach Bondi also niemals eine Kulisse noch ein Reservoir gelehrter Referenzen. Sie ist eine lebendige, durchlässige Materie, die weiterhin auf die Gegenwart wirkt. Alte Zivilisationen sind nicht verschwunden: Sie bestehen in unseren täglichen Gesten fort, in unserer Beziehung zu den Objekten, in unseren unbewussten Ritualen. Indem sie römische Amphoren mit Apothekerschränken des 19. Jahrhunderts und zeitgenössischen Pflanzen in Dialog treten lässt, lehnt Bondi die Linearität des Fortschritts ab, um eine zyklische und geschichtete Zeitvision vorzuschlagen, in der Vergangenheit und Gegenwart koexistieren und sich gegenseitig beeinflussen.
Hin zu einer Poetik der Instabilität
Was bei Bondi beeindruckt, jenseits der unbestreitbaren Schönheit ihrer Installationen, ist die Ablehnung der totalen Kontrolle. In einer Kunstwelt, die oft von Kontrolle und technischer Perfektion besessen ist, akzeptiert sie die Unvorhersehbarkeit der von ihr initiierten Prozesse. Diese Demut gegenüber den Materialien, diese Akzeptanz, dass das Werk ein autonomes Leben besitzt, das seinem Schöpfer teilweise entgleitet, stellt vielleicht ihren radikalsten Beitrag zur zeitgenössischen Kunst dar. Sicherlich erbt sie von der italienischen Arte Povera diese Aufmerksamkeit für einfache Materialien und den Willen, das Material für sich selbst sprechen zu lassen, aber sie fügt eine zeitliche und spirituelle Dimension hinzu, die ihr eigen ist. Während die Künstler der Arte Povera oft mit inerten Materialien arbeiteten, bevorzugt Bondi lebendige, organische, flüchtige Substanzen, die sich vor unseren Augen verwandeln.
Diese konstitutive Instabilität ihres Werkes hinterfragt unsere Beziehung zu Beständigkeit und Erhaltung. In einem Kunstsystem, das traditionell das Werk als stabiles Objekt wertschätzt, das Jahrhunderte überdauern soll, schlägt Bondi Werke vor, die sich verändern, verfallen, sich regenerieren. Sie existieren weniger als feste Objekte denn als laufende Prozesse, als Übergangszustände eines Materials in ständiger Metamorphose. Dieser Ansatz wirft natürlich pragmatische Fragen für Sammler und Institutionen auf, reflektiert aber auch eine tiefgreifende philosophische Sicht auf die Natur des Seins selbst: Alles ist Fluss, alles ist Verwandlung, und den Wunsch, das Leben in dauerhafte Formen einzufrieren, ist eine tödliche Illusion.
Die Aufmerksamkeit, die Bondi den endemischen Pflanzen schenkt, zeugt von einem ökologischen Bewusstsein, das sich nicht auf Reden beschränkt, sondern sich in der Praxis verkörpert. Indem sie systematisch lokale Pflanzen in ihren Installationen verwendet, verankert sie ihre Arbeit im Territorium, in dem sie sich entfaltet, und lehnt den abstrakten Universalismus mancher zeitgenössischer künstlerischer Praktiken ab. Jede Installation wird so zur Feier der lokalen Biodiversität, eine Hommage an die spezifischen Ökosysteme, die den wahren Reichtum der Welt angesichts der globalen Uniformierung darstellen. Dieser Ansatz hallt heute besonders wider, in einer Zeit, in der die ökologischen Krise uns zwingt, unsere Wohn- und Produktionsweisen zu überdenken.
Bondi steht an der Schnittstelle mehrerer Traditionen und Einflüsse. Ihr biografischer Werdegang, geboren in Johannesburg, ausgebildet in Südafrika und dann in Frankreich, wohnhaft in Italien, macht sie zu einer transkulturellen Künstlerin, die singuläre Zugehörigkeiten ablehnt. Diese identitäre Vielheit spiegelt sich in ihrem Werk wider, das gleichzeitig afrikanische, europäische und universelle Traditionen beschwört, ohne sich jemals auf eine davon zu beschränken. Sie verkörpert jene Künstlergeneration, für die nationale Grenzen durchlässig geworden sind und die ihr plastisches Vokabular aus bewusst übernommenen und neu aneigneten Entlehnungen gestalten.
Ihre Nominierung für den Prix Marcel-Duchamp, neben Eva Nielsen, Lionel Sabatté und Xie Lei, bestätigt eine bemerkenswerte Aufstiegskarriere. Aber über die institutionelle Anerkennung hinaus ist es bei Bondi die Kohärenz einer Vision, die sich seit mehr als einem Jahrzehnt mit seltener Konstanz behauptet. Von der mit Salz bedeckten Küche, die auf der Biennale von Lyon 2019 gezeigt wurde, bis zu Silent House, ausgestellt im Musée d’Art Moderne de Paris im Jahr 2025, finden sich dieselben Obsessionen: die häusliche Architektur als Bühne des Fehlens, organische Materialien als Umwandlungsagenten, die alte Geschichte als symbolischer Speicher, Spiritualität als Erkenntnisweise der Welt.
Manche könnten Bondi eine Form von Esoterik vorwerfen, die an Obskurantismus grenzt. Das wäre eine Unterschätzung der Strenge ihres Ansatzes und der Präzision ihrer Arbeit mit den Materialien. Wenn sie sich allmählich von den Kooperationen mit Wissenschaftlern löst, so liegt das genau daran, dass die wissenschaftliche Terminologie und die experimentelle Methodik nicht ihrer intuitiven Art entsprechen, chemische Prozesse zu erfassen. Doch diese Intuition ist kein Unwissen: Sie entspringt einem im Laufe der Jahre angesammelten sensiblen Wissen, einer engen Vertrautheit mit dem Verhalten von Salz, Wachs und Pflanzen. Hier könnte man von einer volkstümlichen Wissenschaft sprechen, von handwerklichem Können, das nicht durch akademische Protokolle vermittelt wird, aber dennoch in seiner Anwendung streng ist.
Die Frage der Wiederverzauberung der Welt, die bei Bondi zentral ist, beruht nicht auf einer regressiven Nostalgie für ein mythisches Goldzeitalter, in dem die Menschheit in Harmonie mit der Natur lebte. Vielmehr geht es darum anzuerkennen, dass die moderne instrumentelle Rationalität, trotz all ihrer unbestreitbaren Vorzüge, unser sensibles Verhältnis zur Welt verarmt hat, indem sie die Gegenstände auf ihren bloßen Gebrauchswert reduzierte. Alltägliche Gegenstände wieder zu verzaubern bedeutet, ihnen jene symbolische Tiefe zurückzugeben, jene Fähigkeit, über ihre unmittelbare Funktion hinaus Sinn zu tragen. Ein Schrank ist niemals nur ein Schrank: Er ist auch das Gefäß für Kleidung, die unsere Haut berührt hat, für Gerüche, die sich angesammelt haben, für Geheimnisse, die darin verborgen wurden. Bondi erinnert uns an diese offensichtliche Tatsache, die wir dazu neigen zu vergessen.
Am Ende dieses Wegs durch das Werk von Bianca Bondi drängt sich eine klare Erkenntnis auf: Wir haben es mit einer bedeutenden Künstlerin zu tun, deren Arbeit sich in den kommenden Jahren weiter entfalten und uns überraschen wird. Ihre Installation Silent House ist kein Endpunkt, sondern eine Etappe in einer fortwährenden Vertiefung der Recherche. Dieses stille Haus spricht dennoch eindrücklich von unserer zeitgenössischen Lage: Wir bewohnen Orte, die uns überdauern werden, wir manipulieren Gegenstände, die die Spuren unseres Daseins tragen werden, wir gehören einer historischen Kette an, die uns vorausgeht und uns unendlich übersteigt. Angesichts dieses ausgeprägten Bewusstseins unserer Endlichkeit bietet Bondi weder leichten Trost noch selbstgefällige Verzweiflung an. Sie lädt uns schlicht ein, aufmerksam die langsamen Metamorphosen um uns herum zu beobachten, die Instabilität als grundlegende Bedingung des Daseins zu akzeptieren und die paradoxe Schönheit zu feiern, die aus Prozessen der Verwandlung und des Zerfalls entsteht. Vielleicht ist das letztlich der tiefere Sinn ihrer Arbeit: uns zu lehren, die Ruine nicht als Ende, sondern als Versprechen zu betrachten, das einer möglichen Regeneration aus den Trümmern. In einer Welt, die sich mit beunruhigender Hast ihrer eigenen Zerstörung nähert, hallt diese Lektion von Demut und Resilienz mit besonderer Dringlichkeit wider.
- Centre Pompidou, “Wenn Magie auf Kunst trifft; das faszinierende Universum von Bianca Bondi”, Pompidou+, 2025.
- Art Basel, “Marcel-Duchamp-Preis 2025: Bianca Bondi”, September 2025.
- Ebd.
- CRAC Occitanie, “Ausstellungen Alexandra Bircken & Bianca Bondi”, Sète, 2022.