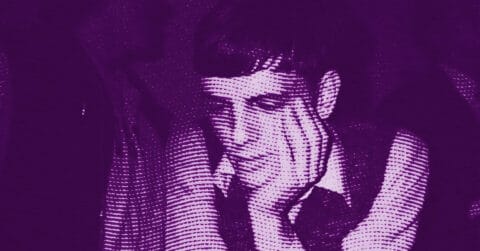Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch vor den letzten konzeptuellen Installationen begeistert, wo drei Kartoffeln mit einer blinkenden Neonröhre dialogisieren, malt ein Mann. Er malt wirklich, mit Öl, Leinwand, Zeit und Stille. Bilal Hamdad, geboren 1987 in Sidi Bel Abbès, bittet weder um euren Segen noch um eure Nachsicht. Er beschränkt sich darauf, das Paris einzufangen, das ihr durchquert, ohne es zu sehen, die Gesichter, denen ihr begegnet, ohne sie anzuschauen, die Momente, die ihr sofort nach ihrem Erleben löscht. Sein Pinsel ist kein Reproduktionswerkzeug, sondern ein Skalpell, das das unsichtbare Jetzt unserer Metropolen seziert.
Hamdads Malerei stört, weil sie die Leichtfertigkeiten des konventionellen Diskurses ablehnt. Man möchte ihn gern in den bequemen Käfig des “Hyperrealismus” sperren, jene Sammelkategorie, die vom Denken entbindet. Doch er ist viel mehr als das. Betrachtet seine Gemälde genau: Die Körper lösen sich im Schatten auf, die Gesichter werden zu Gespenstern hinter den Scheiben, die malerische Materie pulsiert und vibriert fernab aller dienenden Imitation. Hamdad kopiert nicht die Realität, er setzt sie aus Dutzenden Fotografien neu zusammen, um eine Wahrheit zu extrahieren, die das eilfertige Auge nicht erfassen kann. Seine großen Kompositionen, zwei Meter oder mehr, zwingen uns zu verlangsamen, zu verweilen, die Unbequemlichkeit der Kontemplation zu akzeptieren.
Die urbane Hermeneutik
Hamdads Vorgehen findet eine besondere Resonanz in den Gedanken des deutschen Soziologen Siegfried Kracauer, einer bedeutenden intellektuellen Figur der Weimarer Republik. Kracauer entwickelte das, was er eine Hermeneutik der Oberfläche nannte, eine Analysemethode, die davon ausgeht, dass “der Platz, den eine Epoche im historischen Prozess einnimmt, relevanter durch die Analyse ihrer diskreten oberflächlichen Erscheinungen bestimmt wird als durch die Urteile, die sie über sich selbst fällt” [1]. Dieser Ansatz steht im radikalen Gegensatz zu großen abstrakten theoretischen Synthesen und bevorzugt die sorgfältige Beobachtung scheinbar unbedeutender Details des städtischen Lebens. Kino, Architektur, Bewegungen in der U-Bahn, Körperhaltungen: alles wird zum Material soziologischen Verstehens.
Hamdad verfährt genau so. Seine Gemälde suchen nicht, vordefinierte Konzepte von Einsamkeit oder zeitgenössischer Entfremdung zu illustrieren. Der Künstler selbst präzisiert: Er definiert niemals ein Thema, bevor er eine Leinwand beginnt; er startet aus dem Wunsch zu malen, nicht aus einem Diskurs. Seine Werke bilden ein visuelles Archiv der Oberflächenerscheinungen unserer Epoche: der Gesundheitsschutzmaske, dem Mobiltelefon, dem WLAN-Piktogramm, dem Maisverkäufer vor Barbès-Rochechouart. Diese Elemente sind keine künstlich hinzugefügten Symbole, sondern authentische Spuren eines bestimmten historischen Moments. So wie Kracauer die Berliner Hotellobbys oder Varieté- Vorstellungen durchmustert hat, um die tiefen Strukturen der kapitalistischen Moderne zu erkennen, untersucht Hamdad die U-Bahn-Stationen und Rolltreppenausgänge, um die zeitgenössischen Konfigurationen des urbanen Daseins zu offenbaren.
Die Station Arts et Métiers in Le Mirage, mit ihren kupfernen Wänden, die an den Nautilus erinnern, wird so mehr als nur ein einfaches Dekor. Sie verkörpert jene Nicht-Orte, die der Anthropologe Marc Augé theorisiert hat, austauschbare Räume der Übermoderne, in denen das Individuum anonym bleibt. Aber Hamdad geht weiter: Durch das Spiel der Reflexionen auf den Metalloberflächen vervielfacht er die Blickwinkel und offenbart, was die direkte Beobachtung verbirgt. Die Passantin zeigt sich im Profil, maskiert, von ihrem Bildschirm absorbiert. Diese Vervielfachung des Sichtbaren durch das Sichtbare selbst stellt eine Mise en abyme der soziologischen Methode von Kracauer dar. Die reflektierenden Oberflächen lügen nicht; sie zeigen das, was der gewohnte Blick nicht mehr beachtet.
Die Methode von Hamdad teilt mit der von Kracauer eine obsessive Aufmerksamkeit für die Rhythmen und Gesten des urbanen Alltags. In Escale II oder L’Attente werden die Personen in diesen Momenten zeitlicher Suspension erfasst, die typisch für die städtische Erfahrung sind: man wartet, man ist auf dem Weg, man existiert im Zwischenzustand. Diese leeren Augenblicke, die die klassische Philosophie als unwürdig für Aufmerksamkeit ansehen würde, werden bei Hamdad zu sozialen Offenbarungen von größter Bedeutung. Sie legen die Beziehungen des Individuums zum öffentlichen Raum, Rückzugs- oder Anwesenheitsstrategien sowie Mikroverhalten offen, die das kollektive Leben strukturieren, ohne je Gegenstand expliziter Bewusstheit zu sein.
Rive droite, dieses riesige Wandbild am Ausgang der Metro Barbès-Rochechouart, treibt diese Logik auf die Spitze. Hamdad entfaltet hier eine wahrhaft soziologische Stichprobe der zeitgenössischen Metropole: den afrikanischen Verkäufer, die eiligen Passanten, die gelbwestigen Agenten, das Händchen haltende Paar. Jedes Detail zählt, jede Präsenz spricht. Die Gedenktafel, die an das Attentat des Obersts Fabien gegen den Nazi-Besatzer erinnert, bleibt mit Graffiti beschmiert, als hätte das kollektive Gedächtnis vor der Dringlichkeit der Gegenwart kapituliert. Diese Gegenüberstellung von Erinnerung und Aktualität, von Historischem und Alltäglichem, ist genau das, was Kracauer als Analyse der “diskreten Oberflächenmanifestationen” bezeichnete. Die Epoche offenbart sich in dem, was sie vernachlässigt, ebenso wie in dem, was sie feiert.
Die Poetik des Flüchtigen
Das Werk von Hamdad ruft ebenfalls, eher aus innerer Notwendigkeit als aus kultureller Eitelkeit, das poetische Universum von Charles Baudelaire hervor. Der Dichter der Fleurs du mal war der erste, der die Moderne als Erfahrung des Flüchtigen, des Vorübergehenden und des Kontingenten theoretisierte. Sein Sonett “À une passante”, das häufig im Zusammenhang mit Hamdad zitiert wird, fasst diese Ästhetik des Moments zusammen: “Ein Blitz… dann die Nacht! Flüchtige Schönheit / Deren Blick mich plötzlich wiedergeboren hat / Werde ich dich nicht mehr sehen außer in der Ewigkeit?” [2]. Diese abgebrochene Begegnung, diese Präsenz, die auftaucht und vergeht, strukturiert ebenso die Baudelaire-Poesie wie die Malerei Hamdads.
Le Mirage ist das eindrucksvollste Beispiel dafür. Die Frau mit dem Rücken zur Kamera in der Metro, durch ihre Reflexionen enthüllt, verkörpert perfekt jene baudelairianische “flüchtige Schönheit”. Für den Betrachter existiert sie nur in diesem schwebenden Moment, diesem kurzgeschlossenen Zeitraum, in dem sich das Sichtbare verdoppelt und zugleich entzieht. Man wird sie nie wiedersehen, und doch bleibt sie auf der Leinwand eingefangen, in ihrer Flucht selbst verewigt. Diese baudelairianische Dialektik von Flüchtigkeit und Ewigkeit durchzieht das gesamte Werk von Hamdad. Seine Figuren sind immer im Transit, nie wirklich da, schon anderswo in ihrem Kopf oder auf ihrem Bildschirm. Sie leben in jener spezifisch modernen Zeit, die Baudelaire als erster benannte: eine gegenstandlose Gegenwart, zerrissen zwischen Erinnerung und Erwartung.
Das baudelairianische Konzept des „Malers des modernen Lebens” beleuchtet ebenfalls Hamdads Vorgehensweise. Baudelaire lobte Constantin Guys für seine Fähigkeit, „das Flüchtige, das Vorübergehende, das Zufällige, die Hälfte der Kunst zu erfassen, deren andere Hälfte das Ewige und Unveränderliche ist”. Hamdad verfährt genau so in seinen großen urbanen Kompositionen. Er fängt das Flüchtige ein, diesen Passanten, dieses Licht, diese Geste, lädt sie jedoch mit einer malerischen Dichte auf, die sie in eine andere Zeitlichkeit überführt, jene des Kunstwerks. Die Quechua-Zelte der Obdachlosen, die blauen Westen des Samu Social, die Polizeiuniformen: so viele zufällige Details, die unter Hamdads Pinsel eine fast archäologische Schwere gewinnen. Diese Objekte zeugen, sie sind die noch warmen Fossilien einer Epoche, die sich betrachtet, ohne sich zu verstehen.
Die Melancholie Baudelaires durchdringt ebenfalls Hamdads Gemälde, jene „glorreiche Melancholie”, die der Dichter mit der Moderne verband. Patrick Modiano, dessen Zitat den Katalog der Ausstellung Solitudes croisées eröffnet, verlängert diese baudelairianische Stimmung im zeitgenössischen Paris: „Es gab in Paris Zwischenzonen, No-Man’s-Land, wo man am Rande von allem war, in der Transitphase oder sogar in Schwebe” [3]. Diese Zonen malt Hamdad unermüdlich. Es sind seine Wahlterritorien: Parkplätze, U-Bahn-Gänge, verlassene Bürgersteige von Saint-Rémy-de-Provence. Durchgangsorte, die unter seinem Blick seltsame urbane Poesie entfalten, zugleich vertraut und beunruhigend.
Die einsame Menge, zentrales Thema der baudelairianischen Moderne, findet bei Hamdad eine eindrucksvolle malerische Umsetzung. In Rive droite ist jede Figur allein in der Menge, eingeschlossen in ihrer Wahrnehmungsblase. Sie begegnen sich, ohne einander zu sehen, streifen sich, ohne wirklich zu berühren. Diese Nähe ohne Kontakt, diese Ko-Präsenz ohne Beziehung definiert seit Baudelaire die metropolitane Erfahrung. Hamdad fügt keinen überflüssigen Pathos hinzu, keine moralischen Kommentare. Er zeigt einfach, und dieses Zeigen reicht aus, um die affektive Architektur unserer Zeit zu offenbaren. Gesenkte Gesichter, abgewandte Blicke, das Versinken in Bildschirmen: so viele Rückzugsstrategien, die den öffentlichen Raum in ein Archipel nebeneinandergestellter Einsamkeiten verwandeln.
Die Malerei als politischer Akt
Es wäre bequem, aber falsch, Hamdads Werk auf eine ernüchternde Feststellung der zeitgenössischen Entfremdung zu reduzieren. Seine Malerei trägt eine politische Ladung, die ihren Namen nicht nennt, die lauten Aktivismus ablehnt und stattdessen die diskrete Wirksamkeit des Zeigens vorzieht. Wenn Hamdad die Zelte der Migranten in stillgelegten Architekturen malt, wenn er die Obdachlosen zusammengekrümmt in ihren Schlafsäcken darstellt, wenn er prekäre Arbeiter und Schwarzmarkthändler erfasst, vollzieht er eine bedeutende politische Geste: Er macht sichtbar, was die Gesellschaft lieber nicht sehen will. Wie Virginie Despentes in einem vom Katalog zitierten Satz schreibt, sind wir „wie viele Städter geimpft, an das Elend der anderen gewöhnt, aber immer ein wenig beschämt, den Blick abzuwenden”. Hamdads Malerei hindert uns daran, den Blick abzuwenden.
Diese politische Dimension steht in einer ausdrücklich behaupteten Nachfolge mit Gustave Courbet. Rive droite übernimmt ausdrücklich die Struktur von L’Atelier du peintre und verlegt die realistische Allegorie des 19. Jahrhunderts ins kosmopolitische Paris des 21. Jahrhunderts. Wie Courbet “die Gesellschaft in ihrem Oben, ihrem Unten, in ihrem Mittleren” zeigte, entfaltet Hamdad eine soziale Kartographie der zeitgenössischen Metropole. Courbets Akt wird zu einem Werbeplakat, die ländliche Landschaft zu einem U-Bahn-Plan, doch das Prinzip bleibt bestehen: die Malerei als Ort der symbolischen Versammlung aller sozialen Schichten. Hamdad aktualisiert so das realistische Projekt Courbets und zeigt, dass die große Malerei die Welt noch immer darstellen kann, ohne auf die Einfachheiten der Abstraktion oder konzeptuelle Kunststücke zurückzugreifen.
Die formalen Entscheidungen Hamdads tragen ebenfalls zu dieser politischen Haltung bei. Seine großen Formate, für die er bewusst die Dimensionen der historischen Malerei nutzt, unterstreichen die Bedeutung seiner Themen. Ein Obdachloser, ein U-Bahnausgang, ein Maisverkäufer verdienen diese zwei Meter Leinwand, die der Akademismus Helden und Göttern vorbehalten hatte. Dieser Gestus der Größenordnung ist an sich ein Akt des Widerstands gegen die heimliche Hierarchie der Sujets in der Kunstwelt. Hamdad erklärt mit seinen Formaten, dass diese anonymen Existenzen eine malerische Würde besitzen, die der der Mächtigen gleichkommt. Darin liegt etwas zutiefst Demokratisches im edelsten Sinne des Wortes.
Die Malerei als Übung des Blicks
Das Werk von Bilal Hamdad gilt heute als eines der notwendigsten in der französischen Kunstszene. Nicht wegen technischer Virtuosität, obwohl diese unbestreitbar ist, noch wegen formaler Originalität, obwohl sie existiert. Es ist notwendig, weil es das vollbringt, was nur die Malerei vollbringen kann: Es lehrt uns, das zu sehen, was wir sehen. Zwischen Kracauer und Baudelaire, zwischen Oberflächensoziologie und Poesie des Flüchtigen, baut Hamdad eine visuelle Archäologie der Gegenwart auf. Seine Gemälde wirken wie zeitliche Verlangsamungen, heilbringende Hindernisse gegen die Geschwindigkeit, die uns blind macht.
Seine Museums-Ausstellung mit dem Titel “Paname”, die mit Unterstützung der Galerie Templon organisiert wurde, ist derzeit im Petit Palais zu sehen und läuft bis zum 8. Februar 2026. Sie markiert eine wohlverdiente institutionelle Anerkennung. Angesichts von Courbet und Lhermitte machen seine Gemälde keine schlechte Figur. Sie treten mit den Meistern auf Augenhöhe in Dialog und beweisen, dass die große figurative Malerei nicht tot ist und nicht einmal krank. Sie verlangt einfach Maler, die fähig sind, sie zu tragen, Künstler, die die Langsamkeit des Mediums akzeptieren, die Forderung des Blicks, die Ablehnung konzeptueller Abkürzungen. Hamdad gehört zu diesen. Er malt, weil er nicht anders kann, weil die Malerei das präziseste Werkzeug bleibt, um die unendlichen Nuancen des Sichtbaren zu erfassen.
Jenseits der bequemen Etiketten Hyperrealismus, Sozialrealismus, Stadtmalerei stellt Hamdads Werk eine einfache, aber schwindelerregende Frage: Was sehen wir, wenn wir hinsehen? Seine Gemälde legen nahe, dass wir fast nichts sehen, dass unser Blick über die Oberflächen gleitet, ohne wirklich anzuhalten. Der Maler aber schaut. Er schaut beharrlich, methodisch, auch mit Liebe. Er schaut diese Stadt, die wir bewohnen, ohne wirklich da zu sein, diese Gesichter, denen wir begegnen, ohne sie zu treffen, jene Momente, die wir erleben, ohne sie wirklich zu leben. Und indem er uns das Ergebnis dieses geduldigen Blicks zeigt, bietet er uns die Möglichkeit, endlich vielleicht etwas von dem zu sehen, was unsere zeitgenössische Bedingung ausmacht.
Die Zukunft wird zeigen, ob Hamdad in das Pantheon der großen Maler der urbanen Moderne eintritt, neben einem Hopper oder einem Hammershøi. Für den Moment malt er. Er malt dieses Paris von 2025, diese überfüllte und einsame Metropole, gewalttätig und zerbrechlich, kosmopolitisch und segregiert. Er malt ohne Nostalgie für eine mythisierte Vergangenheit, ohne Zynismus gegenüber der Gegenwart, ohne Illusionen über die Zukunft. Er malt, weil Malen heute an sich ein Akt des Widerstands gegen das Reich der Wegwerf-Bilder und hohlen Reden ist. In einer Welt, die Geschwindigkeit und Vergessen bevorzugt, wählt Hamdad Langsamkeit und Erinnerung. Sein Pinsel ritzt in die malerische Materie Fragmente des Daseins, die ohne ihn im undifferenzierten Fluss der Zeit zerflossen wären. Das ist vielleicht die wesentliche Tat der Kunst: einige Splitter der Wahrheit dem Vergessen zu entreißen und sie denen anzubieten, die noch wirklich hinzusehen bereit sind.
- Siegfried Kracauer, zitiert im Katalog der Ausstellung Solitudes croisées, 2022, Text von Hélianthe Bourdeaux-Maurin
- Charles Baudelaire, “An eine Vorübergehende”, Les Fleurs du mal, 1857
- Patrick Modiano, Im Café der verlorenen Jugend, zitiert im Katalog der Ausstellung Solitudes croisées, 2022