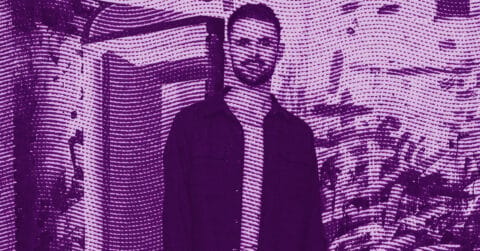Hört mir gut zu, ihr Snobs: Calvin Marcus wird Sie niemals um Erlaubnis bitten, Ihnen zu missfallen. Dieser kalifornische Künstler, geboren 1988 in San Francisco, schafft seit einem Jahrzehnt ein Werk, das beharrlich jede Form intellektuellen Komforts ablehnt. Seine Gemälde mit toten Soldaten, seine Selbstporträts mit heraushängender Zunge, seine überdimensionalen Störe, die sich über leinwandgroße Flächen wie Stretchlimousinen erstrecken, all dies ist Teil einer bewussten Strategie des Ausweichens, einer systematischen Weigerung, sich in eine Schublade stecken zu lassen. Marcus arbeitet in stilistisch unterschiedlichen Serien und entwickelt für jedes Werk neue materielle Methodologien, die beunruhigende Themen sowohl psychischer als auch gesellschaftlicher Art durch verschiedene Medien erforschen. Wie er selbst unmissverständlich erklärt: “Ich fühle keine Loyalität gegenüber einem bestimmten Medium, ich lasse die Idee die Form diktieren und gehe von dort aus” [1].
Diese formale Fluidität ist kein Gymnastikstück eines Ästheten auf Anerkennungssuche. Im Gegenteil, sie offenbart eine tief verankerte philosophische Haltung im existenzialistischen Denken, die eines Künstlers, der Freiheit als Kardinalwert seiner Praxis beansprucht. Auf die Frage nach seiner Beziehung zur Vernunft und Logik antwortet Marcus mit überraschender Offenheit: “Meine Beziehung zur Vernunft ist mein Interesse an Veränderung des Selbst; zu erkennen, dass Freiheit das ist, was ich wirklich für mich und meine Kunst will” [2]. Diese Aussage erhält eine besondere Schärfe, wenn man sie mit den von Jean-Paul Sartre in Das Sein und das Nichts entwickelten Konzepten vergleicht. Für Sartre ist die menschliche Existenz durch radikale Freiheit definiert, durch diese Fähigkeit und zugleich Verurteilung, sich ständig selbst zu wählen. Der Mensch bei Sartre ist „zur Freiheit verurteilt”, in eine Welt ohne vorgegebene Essenz geworfen, gezwungen, sich durch seine Handlungen zu definieren. Marcus scheint diese Lektion mit bemerkenswerter Intelligenz verinnerlicht zu haben. Indem er sich weigert, eine erkennbare “Marke” zu entwickeln und sich von Ausstellung zu Ausstellung stilistisch wandelt, fügt er sich in jene existenzialistische Tradition ein, die Freiheit nicht als Luxus, sondern als ontologische Notwendigkeit versteht.
Doch diese von Marcus beanspruchte Freiheit ist niemals leicht oder sorglos. Sie trägt die Last der existenziellen Angst in sich, jenes sartresche Übelkeitsgefühl, das auftaucht, wenn man sich seiner eigenen Kontingenz bewusst wird. Seine Serien, die toten Soldaten von 2016, die lächelnden Keramikfische, die sorgfältig gemalten Grasbilder funktionieren als Erkundungen von Grenzsituationen, in denen das Absurde mit dem Tragischen konkurriert. Die Serie Were Good Men, die 2016 bei Clearing gezeigt wurde, bietet ein besonders eindrückliches Beispiel für diese Spannung. Auf neununddreißig monumentalen Leinwänden entfaltet Marcus Figuren gefallener Soldaten, dargestellt in einem Stil, der an Kindzeichnungen erinnert, mit groben Strichen und Primärfarben. Diese verdrehten Körper mit geschwollenen Gesichtern, getönt in Violett, Grün oder Braun, mit hervorstehenden Augen und langen, herabhängenden rosafarbenen Zungen, liegen auf leuchtend grünen Grasflächen. Die Kraft der Installation lag in der überdimensionalen Größe der Leinwände und ihrer labyrinthartigen Anordnung, die ein bedrückendes räumliches Erlebnis schuf und den Betrachter buchstäblich in einem Universum stilisierter Todesszenen gefangen hielt. Diese Bilder, paradox sowohl visuell als auch ethisch still, stellen schwindelerregende Fragen nach männlicher Identität, Darstellung, Macht und dem Drang zur Selbstzerstörung.
Das Werk von Marcus findet übrigens einen verstörenden Widerhall im absurden Theater, und dabei besonders in der Welt von Samuel Beckett. Wie Beckett-Charaktere, gefangen in unverständlichen und sich wiederholenden Situationen, scheinen Marcus’ Motive in einer undefinierten Zeitlichkeit zu schweben, zwischen Präsenz und Abwesenheit, zwischen Sein und Nichts. Nehmen wir Warten auf Godot, dieses grundlegende Stück des absurden Theaters, in dem Vladimir und Estragon endlos auf einen Godot warten, der niemals kommen wird. Das Warten hat bei Beckett keinen Zweck, sondern ist das Wesen der Existenz selbst. Ebenso erzählen Marcus’ toten Soldaten keine Geschichte eines bestimmten Krieges; sie verkörpern den Krieg im Allgemeinen, entrückt von jeglichem spezifischen politischen oder sozialen Kontext. Sie sind Figuren in Erwartung eines Sinns, Körper, die in einem Zustand schweben, der sowohl heroische Verherrlichung als auch militante Anklage verweigert. Diese scheinbare Neutralität ist keineswegs eine Schwäche, sondern vielleicht die subversive Kraft dieser Gemälde. Sie konfrontieren uns mit der grundlegenden Absurdität organisierter Gewalt, ohne uns den moralischen Trost einer klaren ideologischen Position zu bieten.
Die Parallele zu Beckett vertieft sich bei der Betrachtung der seriellen Struktur von Marcus’ Arbeit. Wie Beckett Situationen und Motive in einer hartnäckigen Suche nach einem immer flüchtigen Wahrheitskern wiederholt, bearbeitet Marcus bestimmte Themen, das dämonische Selbstporträt, den verherrlichten oder verzerrten Alltagsgegenstand, in Variationen, die sich nicht linear entwickeln, sondern um ein fehlendes Zentrum kreisen. In Endspiel inszeniert Beckett Hamm, blind und gelähmt, und seinen Diener Clov in einem täglichen Ritual ohne Ziel. Die Welt zerfällt dort langsam, ohne Katastrophe, in einer Agonie, die sich weigert zu enden. Marcus’ lächelnde Keramikfische, die in verschiedenen Kontexten gezeigt werden (ein Teller Spaghetti, eine Austernschale), besitzen dieselbe Eigenschaft einer vertrauten Fremdheit, jenes Schwanken zwischen Naivität und Bedrohung, das Beckett-Universum charakterisiert. Diese kleinen, in sich geschlossenen Welten, fragil und hermetisch zugleich, wirken ebenso privat wie universell, ebenso verborgen wie die pulsierenden Tiefen von Marcus’ Vorstellungskraft.
Die Frage des Maßstabs, die im Werk von Marcus immer wiederkehrt, ist besonders interessant. Seine Leinwände können die Länge einer Limousine erreichen, um ungewöhnlich lange Störe aufzunehmen; seine Grasgemälde verherrlichen Details, die üblicherweise im Hintergrund stehen, bis hin dazu, das einzige Thema obsessiver quadratischer Kompositionen zu sein. Dieses Spiel mit dem Maßstab ist nicht willkürlich. Es funktioniert als eine Vorrichtung zur Aktivierung des Ausstellungsraums und zur Störung der Erfahrung des Betrachters. Indem er bestimmte Elemente übermäßig vergrößert, zwingt uns Marcus, unsere Beziehung zur Welt der Erscheinungen neu zu überdenken. Was unbedeutend schien, ein Grashalm, ein Miniaturfisch, erhält plötzlich eine monumentale Präsenz, die unsere Wahrnehmung verändert. Diese Strategie erinnert an die Verfahren des expressionistischen Kinos, bei dem räumliche Verzerrung dazu diente, psychologische Zustände zu externalisieren. Bei Marcus wird der Maßstab zu einer Sprache, die das unheimliche Eigenartige der Realität ausdrückt. Unvorhergesehene Maßstabsänderungen und die Fremdheit, die sie erzeugen, sind ein ausgeprägtes Thema seiner Praxis und schaffen visuelle Effekte, die zwischen Entzückung und Groteske schwanken.
Es wäre verlockend, das Werk von Marcus ausschließlich durch das Prisma des Surrealismus zu betrachten, ein Etikett, das der Künstler ausdrücklich ablehnt: “Nein, aber ich verstehe, warum jemand denken könnte, dass ich mich dafür interessiere”[2]. Diese Verneinung ist aufschlussreich. Marcus versucht nicht, Zugang zu einem kollektiven Unbewussten zu erhalten, noch Kräfte des Traums zu befreien. Sein Ansatz ist bodenständiger und paradoxerweise beunruhigender. Er arbeitet im Tonfall eines trockenen Humors, diesen neutralen und unerschütterlichen Ton, der Übertreibung verweigert und gleichzeitig tief verstörende Inhalte vermittelt. Seine Gemälde “erscheinen auf den ersten Blick trügerisch kenntlich, sei es wegen ihres Motivs, der Szene oder der angebotenen Absurdität, doch schon bei geringstem Engagement wächst die Bedeutung oft so weit, dass die Mehrdeutigkeit selbst monströs erscheint”[3]. Diese Fähigkeit, die dunkle Seite eines Objekts zu enthüllen, durch intensive Vergrößerung eine reale oder vorgestellte Angst oder eine latente Besorgnis hervorzurufen, ist eines der markanten Talente von Marcus.
Kehren wir einen Moment zu diesem Begriff der Freiheit zurück, der das Werk von Marcus zu durchdringen scheint. In einem zeitgenössischen künstlerischen Klima, in dem “der Wunsch besteht, etwas zu entwickeln, das fast den ikonischen Status einer Marke hat”, beansprucht Marcus das Recht des Ausweichens, der Flüssigkeit, des ständigen Wandels[4]. Diese Haltung erinnert nicht an die Kritik, die Sartre an der “mauvaise foi” (dem „Unaufrichtigsein”) übte, jene menschliche Tendenz, sich in vordefinierte Rollen zu verfestigen, um der Angst vor der Freiheit zu entkommen. Der Künstler, der eine erkennbare “Signatur” entwickelt, verurteilt sich zur Wiederholung, schließt sich in eine Essenz ein, die seiner Existenz vorgelagert ist und sie begrenzt. Marcus lehnt diese Bequemlichkeit mit unerschütterlicher Entschlossenheit ab. Seine Ausstellungen, beschrieben als “eng konstruierte Panoramen” und “labyrinthische Präsentationen”, verstärken die beunruhigende Wirkung seiner Werke und schaffen gleichzeitig immersive Erfahrungen, die den Betrachter fangen und desorientieren. Diese Raumanordnung ist niemals zufällig: Sie trägt zur gleichen Störungsabsicht bei, zur gleichen Skepsis gegenüber dem wahrnehmungskomfort.
Die Laufbahn von Marcus, von seinen ersten Ausstellungen bei Public Fiction und Peep-Hole bis hin zu seiner Teilnahme an der Whitney Biennale 2019 und seinen jüngsten institutionellen Ausstellungen im Museum Dhondt-Dhaenens in Belgien, zeigt einen steilen Aufstieg in der Welt der zeitgenössischen Kunst. Seine Werke sind mittlerweile Teil der Dauerausstellungen des Museum of Modern Art in New York, des Musée d’Art Moderne in Paris, des Los Angeles County Museum of Art und weiterer bedeutender Institutionen. Diese institutionelle Anerkennung könnte im Widerspruch zur anti-systemischen Haltung des Künstlers stehen. Aber Marcus hat verstanden, dass man das Spiel mitspielen kann, ohne sich täuschen zu lassen, die Regeln des Kunstmarkts akzeptieren kann, ohne seine kreative Freiheit aufzugeben. Sein Ansatz erinnert an Philip Guston, einen seiner wichtigsten Einflüsse, der den abstrakten Expressionismus auf dem Höhepunkt seines Ruhms aufgab, um zu einer verstörenden cartoonartigen Figuration zurückzukehren. Guston, ebenso wie Francis Bacon und Paul Thek, die anderen von Marcus genannten Bezugspersonen, lehnte Selbstgefälligkeit ab und scheute sich nicht davor, die Erwartungen seines Publikums zu verraten, um seiner eigenen inneren Notwendigkeit treu zu bleiben.
Die Zukunft von Marcus bleibt bewusst unvorhersehbar. Genau das macht seine Arbeit so anregend. In einer Kunstwelt, die oft in ihren eigenen Codes gefangen ist und in der Anerkennung durch die sofortige Identifizierung eines Stils erfolgt, bietet Marcus eine seltene Alternative: die eines Künstlers, der sich ständig neu erfindet, der das Risiko akzeptiert, unangenehm zu sein oder zu irritieren, um seine Freiheit zu bewahren. Seine Werke zielen nicht darauf ab, zu gefallen oder zu schockieren, nur aus Lust an Provokation. Sie stellen unbequeme Fragen zu Identität, Repräsentation, Gewalt und Männlichkeit, ohne jemals endgültige Antworten aufzuzwingen. Sie konfrontieren uns mit der grundlegenden Absurdität der Existenz und lehnen dabei jedoch einen nihilistischen Zynismus ab. Damit fügen sie sich vollständig in die existentialistische Tradition ein, die das Absurde nicht als lähmendes Schicksal, sondern als Ausgangspunkt einer authentischen Freiheit anerkennt.
Die Praxis von Marcus erinnert uns daran, dass Kunst im besten Fall kein Kulturkonsumprodukt ist, sondern eine Erfahrung, die uns destabilisiert und zwingt, unsere Gewissheiten zu überdenken. Seine gefallenen Soldaten verherrlichen nicht den Krieg, verurteilen ihn aber auch nicht auf simple Weise; seine dämonischen Selbstporträts offenbaren keine eindeutige psychologische Wahrheit; seine akribischen Grasgemälde feiern die Natur nicht naiv. Alles in seinem Werk widersteht einer eindeutigen Interpretation und hält eine produktive Spannung zwischen widersprüchlichen Bedeutungen aufrecht. Diese Mehrdeutigkeit ist keine Schwäche, sondern das Zeichen einer künstlerischen Intelligenz, die versteht, dass sich die zeitgenössische Welt nicht mit einfachen Formeln erfassen lässt. Angesichts der Komplexität der Realität wählt Marcus die Vervielfältigung von Ansätzen, die endlose Erkundung, die Weigerung, sich festzulegen. Er lädt uns dazu ein, dasselbe zu tun: Uns der Unsicherheit zu stellen und die Freiheit in ihrer schwindelerregendsten Form zu umarmen. Das ist ein riskantes, unbequemes und oft verwirrendes Unterfangen. Doch gerade das macht seine Arbeit zu einem der spannendsten künstlerischen Abenteuer seiner Generation. Das Werk von Calvin Marcus ist somit ein instabiles Terrain, auf dem Schönheit neben Unbehagen steht, Humor mit Grauen flirtet und jede Gewissheit sofort widerlegt wird. Gerade in dieser Instabilität liegt seine Stärke: Sie zwingt uns, wachsam und aufmerksam zu bleiben, unfähig, uns auf komfortable Wahrnehmungsgewohnheiten zu verlassen. Sie macht aus uns, den Betrachtern, unfreiwillige Komplizen einer Suche, die niemals enden wird, einer Freiheit, die niemals Ruhe findet.
- Offizielle Website von Karma, Biographie von Calvin Marcus.
- Flaunt Magazine, Interview mit Ben Noam, “Calvin Marcus: Zuhause ist dort, wo die wellenförmige, weise und aquaristische Skala ist”.
- David Kordansky Gallery, Text für Frieze Seoul 2022.
- Louisiana Channel, “Calvin Marcus: Ich möchte weit entfernt von Höflichkeit sein”, Juni 2022.