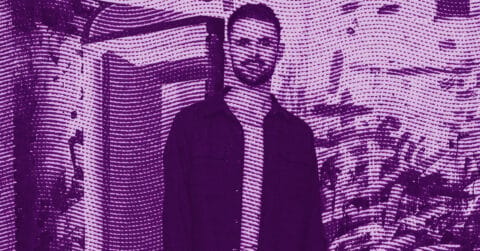Hört mir gut zu, ihr Snobs: Wenn ihr noch glaubt, zeitgenössische Malerei beschränke sich auf weiße Leinwände, die auf internationalen Kunstmessen für hohe Preise verkauft werden, dann ist Chase Hall hier, um euch daran zu erinnern, dass einige Künstler noch echte Fragen stellen. Dieser 32-jährige amerikanische Maler und bekennende Autodidakt schafft seit einem Jahrzehnt ein einzigartiges Werk, das die mixed-Identität, den Aufbau des Selbst und die Darstellung von Schwarzsein in einem Amerika hinterfragt, das immer noch Schwierigkeiten hat, seine eigenen Widersprüche zu erkennen. Bewaffnet mit äthiopischem Kaffee und rohem Baumwollstoff entwickelt Hall eine visuelle Sprache, die die Leichtigkeit pathosbeladener Rassenbilder ablehnt und gleichzeitig voll und ganz die historische Gewalt anerkennt, die in seinen Materialien selbst verankert ist.
Geboren in Saint Paul, Minnesota, aus einer weißen Mutter und einem schwarzen Vater, wuchs Hall in ständiger Instabilität auf und wechselte vor seinem sechzehnten Lebensjahr achtmal die Schule. Diese nomadische Kindheit, die zwischen benachteiligten Vierteln und wohlhabenden Gegenden, zwischen Chicago, Las Vegas, Colorado, Dubai und Los Angeles pendelte, prägte in ihm ein scharfes Bewusstsein für die Klassen- und Rassenmechanismen, die die amerikanische Gesellschaft strukturieren. Als er 2013 mit dem Ziel, Fotojournalist zu werden, nach New York kommt, ahnt er noch nicht, dass Malerei sein bevorzugtes Medium werden wird. Doch eine Begegnung vor einem Gemälde von Henry Taylor im MoMA bewegt ihn so sehr, dass sie ihn zu Tränen rührt. Dieser Moment ästhetischer Offenbarung lässt ihn erkennen, dass die bildende Kunst ein Überlebenswerkzeug sein kann, nicht nur eine bürgerliche Verzierung.
Das doppelte Bewusstsein als konzeptionelle Grundlage
Um die intellektuelle Struktur zu erfassen, die Halls Arbeit zugrunde liegt, muss man zu einem Gründertext der afroamerikanischen Denkweise zurückkehren. Im Jahr 1903 veröffentlicht W.E.B. Du Bois The Souls of Black Folk, ein Werk, in dem er das “doppelte Bewusstsein” konzeptualisiert: das Gefühl, stets durch die Augen anderer betrachtet zu werden, seine “Seele zu messen an einer Welt, die dich mit amüsiertem Verachtung und verächtlicher Mitleid betrachtet” [1]. Du Bois schreibt, dass der Afroamerikaner “immer diese Dualität fühlt: ein Amerikaner, ein Schwarzer; zwei Seelen, zwei Gedanken, zwei unversöhnliche Bestrebungen; zwei Ideale, die in einem einzigen dunklen Körper kämpfen” [1]. Diese Theoretisierung der rassifizierten Subjektivität ist keine einfache psychologische Beschreibung, sondern eine tiefgehende soziologische Analyse dessen, was es bedeutet, hinter dem zu existieren, was Du Bois den “Schleier” nennt, diese symbolische Barriere, die amerikanische Schwarze vom vollen Anerkennen ihrer Menschlichkeit trennt.
Hall, als Mann mit gemischter Herkunft, kennt eine besonders komplexe Version dieses doppelten Bewusstseins. Er hat es offen ausgedrückt: “Sie werden immer ausgegrenzt, weil Sie nicht hundertprozentig weiß sind, und Sie werden immer verleumdet, ohne die volle Liebe dessen zu erfahren, was es bedeutet, völlig schwarz zu sein, ohne koloniale genetische Geschichte.” Diese zwischengeschaltete Position, die er als “Hybridität”, “Dualität” oder sogar “palindromisch” bezeichnet, versetzt ihn in ein Dazwischen, das die amerikanische Gesellschaft traditionell nicht anerkennt. Die historischen Regeln wie die “One-Drop Rule” (die jede Person mit einem afrikanischen Vorfahren als schwarz definiert) oder der “Dreifünftelkompromiss” (der einen Sklaven als drei Fünftel einer Person zählte) beruhten stets auf dem Prinzip des absoluten Weiß: Wenn Sie nicht vollständig weiß sind, sind Sie also schwarz. Hall lehnt diese verarmende Binarität ab.
Seine künstlerische Praxis wird somit zum Schauplatz einer visuellen Untersuchung dieser “Dualität”. Die Verwendung von braunem Kaffee auf weißer Baumwollleinwand ist keine bloße ästhetische Wahl: Es ist eine buchstäbliche Verkörperung des doppelten Bewusstseins. Der Kaffee, hauptsächlich in Afrika und Lateinamerika angebaut, trägt die Geschichte kolonialer Ausbeutung und des Dreieckshandels in sich. Die Baumwolle, die von Sklaven im amerikanischen Süden geerntet wurde, bleibt eines der stärksten Symbole der Sklavenwirtschaft. Indem er absichtlich Bereiche der Leinwand unbemalt lässt, Gesichter ohne Merkmale, weiße Knie und nicht gemalte Geschlechtsteile, schafft Hall sogenannte “Weigerungspunkte”. Diese negativen Räume sind keine Abwesenheiten, sondern drängende Präsenz von Weißheit im Kern der Darstellung von Schwarzeit. Es ist der Schleier von Du Bois, der greifbar wird.
Aber Hall geht weiter als die bloße Illustration der Theorie von W.E.B. Du Bois. Während Du Bois die Erfahrungen der Afroamerikaner beschrieb, deren Schwarzeit aus Sicht der weißen Gesellschaft unbestreitbar war, hinterfragt Hall einen noch komplexeren Zustand: den des Mischlings, der von seinen weißen Freunden als “der schwarze Junge” und von seiner schwarzen Familie als “der gebleichte Junge” wahrgenommen wird. Dieses ständige Schwanken zwischen zwei Welten, die ihn jeweils teilweise ablehnen, macht ihn, um seine Worte zu verwenden, zu einem “palindromischen” Wesen, das in beide Richtungen lesbar ist, aber nie vollständig in einer von beiden integriert ist. Seine Figuren, oft in historisch als weiß kodierten Aktivitäten dargestellt, Reiten, Surfen, Tennis, sind Figuren, die sich weigern, auf “stereotype schwarze Räume” beschränkt zu werden. Hall malt schwarze Männer in Ruhe, schwarze Surfer an den Stränden von Malibu, schwarze Reiter in Reitkleidung, weil er die Sicht auf Schwarzeit komplexer gestalten und das Monolithische zerstören will.
Dieser Ansatz findet einen direkten Widerhall in Du Bois’ Anliegen bezüglich dessen, was er die “Talented Tenth” nannte, die zehn Prozent der schwarzen Männer, die durch Bildung und bürgerschaftliches Engagement der Welt die volle intellektuelle und kulturelle Leistungsfähigkeit ihres Volkes zeigen sollten. Hall hat übrigens ein Werk mit dem Titel The Talented Tenth (Mixed Doubles) (2025) geschaffen, in dem vier schwarze Männer in Tenniskleidung vor einer Ziegelwand stehen, Schläger in der Hand. Der Titel funktioniert auf mehreren Ebenen: Er bezieht sich auf den Text von Du Bois aus dem Jahr 1903, aber auch auf das “Mixed Doubles” im Tennis und natürlich auf die gemischte Identität (“mixed”), die Hall für sich beansprucht. Die Figuren tragen von der klassischen amerikanischen Inspiration geprägte Kleidung, Tennispullover, Cardigans und Faltenhosen, und zeigen Frisuren und Gesichtszüge, die teilweise im Negativraum dargestellt sind, diese “points de refus”, charakteristisch für seine bildhafte Sprache. Das Werk funktioniert gleichzeitig als historisches Dokument und futuristische Traumvision, als Erinnerung und Projektion.
Das doppelte Bewusstsein wird bei Hall zu einem multiplen, geschichteten Bewusstsein. Es geht nicht mehr nur darum, zwischen zwei festen Identitäten zu navigieren, sondern anzuerkennen, dass Identität selbst ein fließender Prozess, ein permanentes Werden ist. Wie er sagt: “sein und werden gleichzeitig”. Seine Gemälde sind “Belege dieses Werdens”, Spuren einer obsessiven Fragestellung: Wer bin ich, wenn mich niemand ansieht? Wer bin ich, wenn mich alle ansehen? Wie kann ich außerhalb der Kategorien existieren, die die Gesellschaft für mich vorbereitet hat? Diese Fragen stellte Du Bois vor mehr als einem Jahrhundert. Hall formuliert sie für unsere Zeit neu, in der Mischlinge immer häufiger werden, die aber die aus der Segregation vererbten Denkstrukturen mit beunruhigender Hartnäckigkeit bestehen bleiben.
Gordon Parks und das Erbe des dokumentarischen Blicks
Um Halls formalen und politischen Anspruch zu verstehen, ist es unerlässlich, die Figur von Gordon Parks heranzuziehen, einem Pionier des afroamerikanischen Fotojournalismus. Geboren 1912 in Kansas, war Parks 1948 der erste afroamerikanische Fotograf, der vom Magazin Life eingestellt wurde. Über zwei Jahrzehnte hinweg dokumentierte er die Bürgerrechtsbewegung, die urbane Armut, das Leben der Harlem-Gangs und wurde außerdem der erste schwarze Regisseur, der mit The Learning Tree (1969), einer Verfilmung seines halb-autobiografischen Romans, einen großen Hollywood-Film inszenierte. Parks erklärte: “Ich habe verstanden, dass die Kamera eine Waffe gegen Armut, gegen Rassismus, gegen alle Arten von sozialen Ungerechtigkeiten sein kann” [2].
Als Hall mit seiner Kamera nach New York kommt, bezieht er sich ausdrücklich auf Parks. Er will Fotojournalismus im Sinne von Parks machen, also mit Empathie, Würde und Engagement. Jahrelang durchstreift er die Stadt auf fünfzehn bis fünfundzwanzig Kilometern pro Tag, fotografiert Gesichter, Situationen, Momente des Lebens. Diese Schulung des Auges durch das Gehen und Beobachten, die Parks ebenfalls praktizierte, indem er Wochen bei seinen Motiven verbrachte, prägt seine Sensibilität tiefgreifend. Wenn Hall zu malen beginnt, bedeutet das keinen Verzicht auf die Fotografie, sondern eine Erweiterung derselben durch andere Mittel. Das Bildausschnitt, die Komposition, die Aufmerksamkeit für Kleidung als soziale und Identitätsmarke, all das stammt aus seiner fotografischen Ausbildung.
Parks hatte das Prinzip, seinen Blick vor der Aufnahme eines einzigen Bildes mit seinem Motiv zu sättigen. Hall verfährt ähnlich: Seine Gemälde sind niemals hastige Illustrationen, sondern Verdichtungen von Erinnerungen, Beobachtungen und gesammelten Reflexionen. Die Figuren, die er malt, Jazzmusiker, Tuskegee-Flieger, Arbeiter in Latzhosen und Footballspieler, besitzen alle diese Eigenschaft, sowohl Archetypen als auch individuelle Einzelpersonen zu sein. Bei Parks findet sich derselbe Ansatz: Seine Motive, sei es Red Jackson, junger Bandenchef aus Harlem, oder Flavio da Silva, asthmatisches Kind aus den Favelas von Rio, werden stets mit einer Menschlichkeit behandelt, die Sensationslust ablehnt.
Die Lehre von Parks ist doppelt. Einerseits zu zeigen, dass dokumentarische Kunst ein Werkzeug sozialer Gerechtigkeit sein kann. Andererseits zu demonstrieren, dass ein schwarzer Künstler alle Medien, Fotografie, Literatur, Kino und Musik, meistern kann, ohne die Validierung akademischer Institutionen zu benötigen. Parks ist, ebenso wie Hall, Autodidakt. Diese Autodidaktie ist kein Handicap, sondern ein Vorteil: Sie ermöglicht es, Formatierungen und verhärtenden Konventionen zu entkommen und eine wirklich persönliche Sprache zu schaffen.
Hall hat von Parks die Vorliebe für Kleidung als Charakterenthüller übernommen. Seine Figuren tragen sorgfältig ausgewählte Outfits: weite, funktionale Hosen aus den 1940er Jahren, klassische Cardigans, makellose weiße Hemden und gelbe Krawatten. „Ich kleide sie so, wie ich mich selbst kleide”, gibt er preis. Diese Identifikation zwischen dem Maler und seinen Motiven ist nie narzisstisch, sondern Ausdruck einer radikalen Ehrlichkeit: Hall malt, was er kennt, was er erlebt hat, die Welten, zwischen denen er schwankt. Kleidung wird zur identitären Rüstung, einem Mittel, die Zugehörigkeit zu einer gewählten Gemeinschaft statt einer zugewiesenen zu signalisieren.
Die Verbindung zwischen Hall und Parks geht über bloßen stilistischen Einfluss hinaus. Sie ist politischer Herkunft. Parks sagte, die Kamera sei eine Waffe. Hall hingegen behauptet, dass Leinwand und Kaffee Materialien mit einer historischen Gewaltladung sind, die umgekehrt werden muss. Indem er buchstäblich Produkte kolonialer und sklavenhalterischer Ausbeutung verwendet, um schwarze Figuren in Haltung von Würde, Freizeit und Kontemplation darzustellen, vollzieht er eine Geste symbolischer Aneignung. Nicht mehr Gewalt definiert diese Körper, sondern Anmut, Stil und Intelligenz. Wie Parks seine Motive nicht auf ihre Not reduzierte, verweigert Hall es, Schwarzsein auf Leiden zu reduzieren.
Parks hat auch den Weg als Regisseur geöffnet. Sein Film The Learning Tree, gedreht in seiner Heimatstadt Fort Scott, erzählte seine Kindheit im segregierten Kansas. Hall hingegen schafft ein Werk, das wie eine zerstreute Autobiografie funktioniert. Jedes Gemälde ist ein zusammengesetztes Erinnerungfragment, ein materiell gewordener Moment der Introspektion. Die Titel seiner Werke, Mama Tried (2025), Momma’s Baby, Daddy’s Maybe (Titel seiner Ausstellung in Wien 2025), Heavy Is The Head That Wears The Cotton (2025), zeugen von dem Wunsch, persönliche Geschichten zu erzählen, die universell Resonanz finden. Parks filmte seine eigene Kindheit; Hall malt seine in Fragmenten, Anspielungen und visuellen Codes.
Das Erbe von Parks zeigt sich auch in der Aufmerksamkeit für Momente der Ruhe. Parks fotografierte Kinder, die auf den Straßen von Harlem spielten, Familien, die sich um einen Tisch versammelten, flüchtige Augenblicke der Zärtlichkeit, die der Härte der Welt entrissen wurden. Hall malt Surfer, Reiter und Männer, die sich in Diners ausruhen. “Nicht alles muss Leistung sein”, sagt er. Diese Betonung auf Nicht-Leistung, auf Sein statt Tun, auf Präsenz statt Kampf, stellt eine Form ästhetischen Widerstands dar. In einer Gesellschaft, die schwarze Körper nur in ihrer Hyperphysicalität anerkennt, Sport, Tanz oder Gewalt, ist es ein zutiefst subversiver Akt, schwarze Männer einfach in ihrem Existieren, Denken, Träumen zu zeigen.
Eine Praxis zwischen Materialität und Metapher
Die Technik von Hall ist besonders interessant. Er bereitet bis zu einhundert Espressi für eine einzige Leinwand vor, variiert die Röstungen und Wasser-Kaffee-Verhältnisse, um sechsundzwanzig verschiedene Brauntöne zu erzielen. Dieser Kaffee, noch heiß, wird direkt auf den rohen Baumwollstoff gegossen. Hall muss schnell arbeiten, manchmal auf den Knien oder auf Gerüsten, um den Fluss, die Flecken und Nuancen zu kontrollieren. Es ist ein körperlicher, fast choreografischer Prozess, der das Atelier zu einem “Kessel der Konfrontation” macht, so seine eigenen Worte. Danach wird Acrylfarbe verwendet, um lebendige Farbtupfer in Azurblau, Zitronengelb und Tiefrot hinzuzufügen, die mit den Erdtönen kontrastieren. Was jedoch auffällt, ist die Menge an Weiß, das sichtbar bleibt: gesichtslose Gesichter, gespenstische Hände, blasse Knie, als ob die Leinwand sich weigert, vollständig bedeckt zu werden.
Dieser Widerstand des Materials ist beabsichtigt. Hall sagt, er lasse diese “Momente der Leere” als “Mosaike der Identität” zurück, Räume, in denen der Betrachter seine eigene Geschichte projizieren kann. Aber diese Weißflächen sind nicht neutral: Sie sind die tatsächliche Weiße der Baumwolle, dieses Material, das Millionen Afrikaner von ihrer Erde riss, um sie in Plantagen zu fesseln. Indem er die Baumwolle sichtbar lässt, tilgt Hall sie nicht, versteckt sie nicht unter Farbschichten: Er erhebt Anklage gegen sie. Jede Leinwand wird so zu einem juristischen ebenso wie ästhetischen Dokument, einem Beweisstück im endlosen Prozess der amerikanischen Geschichte.
Die Verwendung von Kaffee ist nicht weniger symbolisch aufgeladen. Wie Baumwolle ist es eine Exportware, die mit Ausbeutung verbunden ist. Aber es ist auch ein Getränk der Geselligkeit, der Sozialität, verbunden mit Wiener Kaffeehäusern, in denen sich Anfang des 20. Jahrhunderts Künstler und Intellektuelle versammelten. Hall ist sich dieser doppelten Bedeutung bewusst: koloniale Gewalt auf der einen Seite, öffentlicher Raum der Debatte auf der anderen. Indem er gezielt Bohnen äthiopischer Herkunft auswählt (Äthiopien ist die Wiege des Kaffees), verankert er seine Praxis in einer afrikanischen Geographie. Das Braun des Kaffees wird zu einer visuellen Metapher für Dunkelheit, ohne eine sklavische Nachahmung zu sein. Es ist “Melanin, das in Baumwolle getränkt ist”, wie er es mit brutaler Poesie ausdrückt.
Einige Kritiker warfen Hall eine Form von Opportunismus vor, insbesondere als sein Gemälde The Black Birdwatchers Association (2020), das einen schwarzen Mann mit Fernglas darstellt, nach dem Vorfall im Central Park viral ging, bei dem eine weiße Frau die Polizei gegen einen schwarzen Ornithologen rief. Hall gibt zu, das Bild selbst in den sozialen Medien geteilt zu haben, und gesteht: “Ich fühlte mich schuldig, die Situation ausgenutzt zu haben, war aber auch schockiert. Zu sehen, dass mein Werk massenhaft verbreitet wurde, mal instrumentalisiert durch offensichtliche Gleichgültigkeit, mal durch die plötzliche Begeisterung für Black Lives Matter, hat mich zutiefst beunruhigt.” Dieser Moment des Zweifels zeigt eine seltene Integrität. Hall weigert sich, instrumentalisiert zu werden, selbst wenn diese Instrumentalisierung seiner Karriere nützen könnte. Er möchte, dass seine Werke Fragen aufwerfen, nicht vorgefertigten Applaus erzeugen.
Die Dringlichkeit einer Ästhetik des Dazwischen
Was das Werk von Chase Hall heute unverzichtbar macht, ist genau das, was es zu verhindern sucht. Es weigert sich, zwischen Dunkelheit und Helligkeit, zwischen Schmerz und Freude, zwischen Politik und Ästhetik, zwischen Dokumentation und Fiktion zu wählen. Es nimmt bewusst den unbequemen Raum der Hybridität ein, jenes “Zwischen-dran”, das die amerikanische Gesellschaft stets auslöschen wollte. In einem Kontext, in dem identitäre Essenzialisierung herrscht und jeder sich durch fixe, oft von außen auferlegte Kategorien definieren muss, schlägt Hall einen anderen Weg vor: die Vielfalt anzunehmen, Widersprüche zu umarmen, Verwirrung als kreative Kraft statt als zu verbergende Schwäche zu begreifen.
Seine Arbeit spricht mit den Toten und den Lebenden. Mit Du Bois, der vor über einem Jahrhundert das Doppelbewusstsein diagnostizierte. Mit Parks, der zeigte, dass ein schwarzer Mann alle Werkzeuge der Repräsentation beherrschen kann. Mit Henry Taylor, Kerry James Marshall und Charles White, deren wohlwollende Geister seine Kompositionen durchdringen. Aber Hall ist kein Epigone. Er schafft etwas Neues, eine visuelle Grammatik, die ihm eigen ist. Diese Grammatik ist weder konzeptionell noch sentimental, weder abstrakt noch dokumentarisch. Sie besteht allein durch die Kraft ihrer Ehrlichkeit.
Ein Gemälde von Hall anzuschauen bedeutet, sich unbeantworteten Fragen zu stellen. Wer sind diese ruhenden Männer, diese eleganten Reiter, diese in der salzigen Luft schwebenden Surfer? Sind sie Erinnerungen, Projektionen, Fantasien, Dokumente? Die Leinwand fällt kein Urteil. Sie lässt offen. Und gerade diese Offenheit macht ihren Wert aus. In einer Zeit, in der alles sofort entziffert, kategorisiert und “instagrammable” sein muss, zeigt Hall Bilder, die der schnellen Konsumation widerstehen. Seine Gemälde verlangen Zeit, Aufmerksamkeit, Anstrengung beim Hinschauen. Sie belohnen diese Mühe nicht mit Gewissheiten, sondern mit Möglichkeiten.
Man kann ihm natürlich eine gewisse formale Selbstzufriedenheit vorwerfen, vielleicht eine übermäßige Vorliebe für Materialeffekte. Man kann auch den Markt hinterfragen: Seine Gemälde werden für 20.000 bis 90.000 Euro unter den Hammer gebracht und finden Eingang in die Sammlungen des Whitney, des LACMA, des Brooklyn Museums. Das alles riecht stark nach kulturellem Establishment, schicken Galerien, wohlhabenden Sammlern. Aber wessen Schuld ist das? Hall hat dieses System nicht gewählt; er versucht nur, darin zu überleben und dabei seine Stimme intakt zu halten. Und es ist unbestreitbar, dass ihm dies gelingt. Trotz der Medienmaschine, trotz der Erwartungen des Marktes, trotz widersprüchlicher Anweisungen (“sei authentisch, aber verkaufbar”, “sei politisch, aber nicht zu sehr”, “sei schwarz, aber nicht nur”), stellt Hall weiterhin seine Fragen, verschüttet seinen heißen Kaffee auf Baumwolle, lässt Gesichter unvollendet.
Seine letzte Ausstellung in Wien mit dem Titel Momma’s Baby, Daddy’s Maybe (Mamas Baby, Papas Vielleicht) behandelte direkt die Frage der schwarzen Vaterschaft, der gebrochenen Abstammung und der schwierigen Weitergabe. Der Titel stammt von einem Satz, den sein Vater ihm in seiner Kindheit gesagt hatte, ein Satz, der ihn “gebrochen” aber auch “geformt” hat. Selbst 2024 Vater geworden, denkt Hall nun darüber nach, was er seiner Tochter Henrietta weitergeben muss. Wie soll er ihr diese komplizierte Geschichte erzählen? Wie soll er ihr erklären, dass sie das Produkt einer Vermischung ist, die nicht immer eine freie Wahl war, dass sie widersprüchliche Schichten von Geschichte in sich trägt? Diese Fragen durchziehen die neuen Gemälde von Hall, die schwarze Männer in väterlicher, schützender und aufmerksamer Haltung zeigen. Es geht ihm nicht mehr nur um Identität, sondern um Weitergabe, Genealogie, die Möglichkeit, trotz allem Familie zu sein.
Im Grunde ist das, was Halls Werk vor Nihilismus oder Opfermentalität rettet, sein hartnäckiger Optimismus. “Ich glaube wirklich an das Leben”, sagt er einfach. Dieser Satz könnte naiv erscheinen. Ist er aber nicht. Es ist ein Glaubensbekenntnis von jemandem, der die Schattenseiten des amerikanischen Alltags gesehen hat, Armut, elterliche Inhaftierung und permanente Instabilität, und sich dennoch entschieden hat, Bilder von Anmut, Schönheit und Möglichkeiten zu malen. Diese Wahl ist ebenso ethisch wie ästhetisch. Sie sagt: ja, die Geschichte ist gewalttätig, ja, die Herrschaftsstrukturen bestehen fort, aber nein, wir sind nicht dazu verdammt, dieselben Tragödien immer wieder zu spielen. Es gibt Auswege, Brüche, Momente, in denen man einfach sein kann, ohne seine Existenz rechtfertigen zu müssen.
Die Gemälde von Chase Hall werden die Welt nicht verändern. Sie werden den Kapitalismus nicht stürzen, den Rassismus nicht abschaffen, die historischen Wunden nicht heilen. Aber sie tun etwas Bescheideneres und Grundlegenderes: Sie schaffen einen Atemraum. Einen Raum, in dem Komplexität existieren kann, ohne sofort gelöst zu werden, in dem Widersprüche koexistieren können, ohne sich gegenseitig aufzuheben, in dem ein Mensch gleichzeitig schwarz und weiß, amerikanisch und etwas anderes, Maler und Denker, Überlebender und Schöpfer sein kann. Das ist schon viel. Vielleicht ist es sogar alles, was wir heute von Kunst verlangen können: dass sie uns hilft, ein wenig besser, ein wenig tiefer zu atmen in einer Welt, die uns mit ihren Gewissheiten erstickt.
- W.E.B. Du Bois, The Souls of Black Folk, A.C. McClurg & Co., Chicago, 1903
- Gordon Parks, zitiert in Voices in the Mirror: An Autobiography, Doubleday, New York, 1990