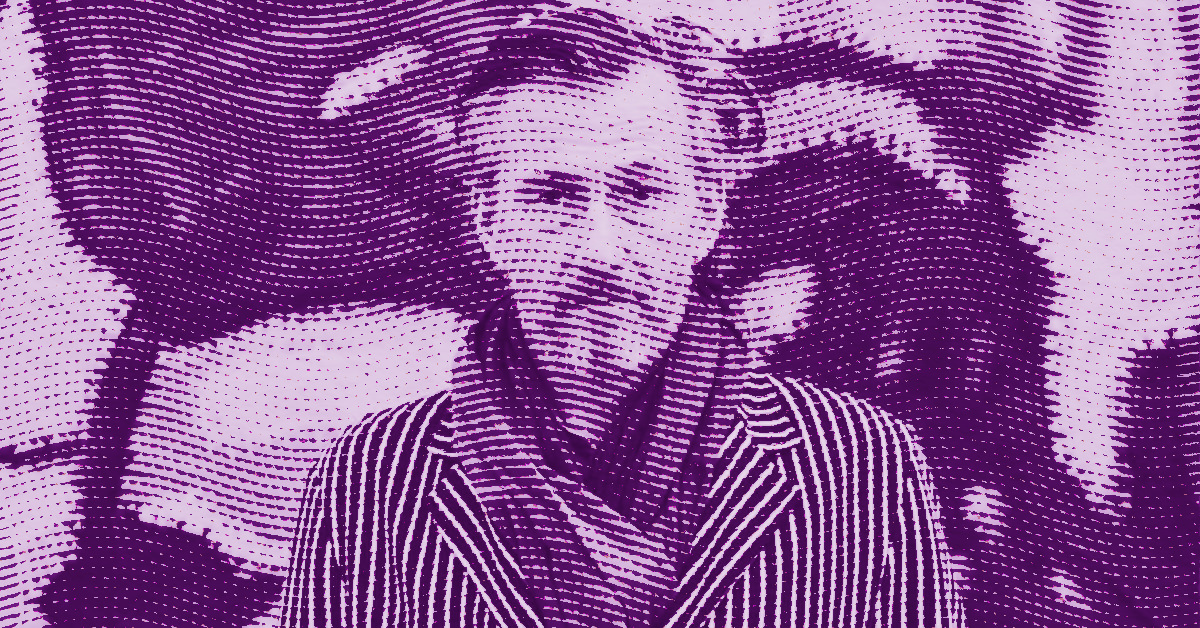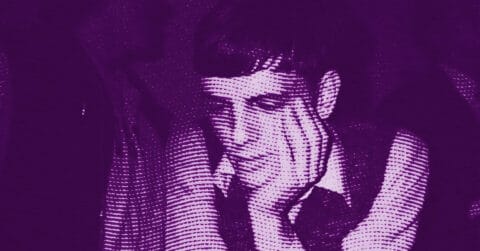Hört mir gut zu, ihr Snobs. Als Gunter Damisch erklärte, dass sein malerisches System von der Idee der Transformation und Metamorphose geleitet werde, sprach er nicht nur eine leere Formel für Ausstellungskataloge aus. Dieser Mann, der 2016 im Alter von achtundfünfzig Jahren zu früh verstarb, hatte etwas Wesentliches über die Natur der zeitgenössischen Kunst verstanden: dass Malerei gleichzeitig eine Massage der Nervenzellen und eine Kartographie des Unsichtbaren sein kann.
Damisch gehörte jener Generation der österreichischen Neuen Wilden an, die Anfang der 1980er Jahre gemeinsam mit Otto Zitko und Hubert Scheibl die etablierten Codes herausforderte. Doch im Gegensatz zu seinen Zeitgenossen entwickelte er rasch einen einzigartigen Weg, den eines Entdeckers der Grenzgebiete zwischen Wissenschaft und Sensibilität, zwischen Makrokosmos und Mikrokosmos. Seine Gemälde, bevölkert von organischen Kreaturen mit ausgebreiteten Tentakeln, wachsenden kristallinen Formen und galaktischen Energieansammlungen, zeigen einen Künstler, der die Essenz unserer Zeit erfasst hatte: diese permanente Spannung zwischen dem unendlich Kleinen und unendlich Großen, die unsere moderne Weltbeziehung prägt.
Der architektonische Tanz des Raumes
Das Werk von Damisch steht in ständigem Dialog mit der Architektur, jedoch nicht der von Gebäuden und Monumenten, sondern der der unsichtbaren Strukturen, die unsere Wahrnehmung organisieren. Seine Welten, Felder, Netzwerke und seine “Flämmer”, jene eher gasförmigen Kreaturen, die als Verbindungsstücke zwischen den verschiedenen Welten seiner Kompositionen dienen, bilden eine wahre räumliche Grammatik, ein architektonisches Vokabular des Intimen und des Kosmischen. Wenn er seine Schwerkraft trotzenden Figuren erschuf, die keine Enden besitzen und in einem beweglichen System zu schweben scheinen, inszenierte Damisch eine Choreographie des Raumes, die an die kühnsten Forschungen der zeitgenössischen Architektur erinnert.
Dieser architektonische Ansatz manifestiert sich besonders in seinem Verständnis des Bildraums als ein zu bewohnendes Gebiet statt eines zu betrachtenden Fensters. Seine Gemälde sind keine offenen Fenster zu einem Anderem, sondern immersive Umgebungen, in denen der Blick des Betrachters nomadisch wird und ständig neue Territorien erkundet. Wie Andrea Schurian erinnerte, war Damisch ein “Weltenformer”, der den zweidimensionalen Raum der Leinwand durch seine seriellen farbigen Verflechtungen, Ausradierungen und Kratzungen ins Unendliche öffnete.
Der Architekt Tadao Ando spricht über die Bedeutung der Leere in der räumlichen Schöpfung [1]. Bei Damisch wird diese Leere positiv, Form- und Bewegungs-erzeugend. Seine unbegrenzten Bildräume, strukturiert durch die Interferenz zwischen Großem und Kleinem, schaffen eine Architektur der Erfahrung und nicht eine Architektur des Objekts. Die schlängelnden Linien, die sich in seinen Kosmen abzeichnen, offenbaren eine räumliche Konzeption, in der Architektur Fluss, Bewegung und permanente Transformation wird.
Diese architektonische Vision geht weit über die reine kompositorische Organisation hinaus. Sie regt zum Nachdenken über das menschliche Wohnen in einer Welt des ständigen Wandels an. Die “inneren Orte” seiner Bronzeskulpturen, diese Zufluchtsräume, bevölkert von winzigen Kreaturen, bieten eine Alternative zur dominierenden funktionalistischen Architektur. Damisch stellt sich organische, atmende Räume vor, in denen der Mensch seinen Platz in der natürlichen Ordnung wiederfinden könnte.
Seine zarten, überlebensgroßen Gittertürme sind echte architektonische Vorschläge. Sie deuten bewohnbare Strukturen an, in denen die Grenze zwischen Innen und Außen verblasst und die Architektur zu einer durchlässigen Membran zwischen Mensch und Umwelt wird. Diese Vision weist auf die zeitgenössischen Forschungen zur biomimetischen Architektur und zu adaptiven Strukturen voraus.
Der Einfluss der Architektur auf seine grafische Arbeit verdient ebenfalls besondere Beachtung. Seine rhizomatischen Strukturen, seine lavischen Farbströme, seine rhythmischen, gewundenen Linien bilden eine echte emblematische Morphologie, die für alle zugänglich ist. Diese grafischen Notationen fungieren als Architektenpläne des Unsichtbaren, als topografische Aufnahmen mentaler Räume, in denen jeder seine eigenen räumlichen Erfahrungen projizieren kann.
Die schöpferische Melancholie und die Alchemie der Formen
Das Werk von Damisch steht auch in einem tiefen literarischen Dialog, der die geheimen Übereinstimmungen zwischen Gemütszuständen und den Formen der Welt erforscht. Seine “Verwicklungen” und “Konvolutionen” erinnern unwiderstehlich an das Universum von W.G. Sebald, jenem Schriftsteller, der Melancholie in schöpferische Kraft zu verwandeln wusste. Wie bei dem Autor der “Ringe des Saturn” wird bei Damisch die Betrachtung natürlicher Formen zum Ausgangspunkt einer Meditation über Zeit, Erinnerung und Transformation.
Diese melancholische Dimension entspricht nicht dem Pessimismus, sondern einer besonderen Klarheit gegenüber den Zyklen von Zerstörung und Regeneration, die das Lebendige regieren. Wenn Damisch “die Würmer und Schlangen, die Schleifen und Lianen, die Bäche und gewundenen Flüsse, Küstenlinien und Ufer, die Rinnsale und Wurmlöcher, die Fraßspuren von Insekten in der Rinde und die Erosionen des Wassers” beobachtete, praktizierte er jene Form aktiver Melancholie, die Sebald als “Naturwissenschaft der Zerstörung” bezeichnete.
Seine poetischen Titel zeugen von dieser besonderen literarischen Sensibilität. “Weltwegköpflerdurcheinander”, “Köpflerflämmler am Wetlbogen”, “Köpflersteher Weltaffäre” sind Ausdrücke, die wie zusammengesetzte deutsche Wörter erscheinen, aber völlig vom Künstler erfunden und absichtlich absurd sind. Diese Neologismen enthüllen einen Künstler, der wie ein Dichter dachte und für den die Benennung der Formen Teil ihrer Schöpfung war. Dieser sprachliche Zugang zur Malerei erinnert an Paul Celans Forschungen zu den Übereinstimmungen zwischen Bild und Sprache.
Damischs Melancholie verwandelt naturalistische Beobachtung in kosmische Vision. Seine einzelligen Kreaturen mit ausgebreiteten Tentakeln, seine kristallinen Formationen, seine galaktischen Energiekonzentrationen zeugen von der Fähigkeit, im Mikroskopischen die Gesetze zu erkennen, die das gesamte Universum beherrschen. Diese melancholische und zugleich wissenschaftliche Vision erinnert an Goethes “Wahlverwandtschaften”, in denen die Beobachtung natürlicher Phänomene die geheimen Gesetze enthüllt, die die menschlichen Leidenschaften regieren.
Der Übergang von der Malerei zur Textualität in seinem Werk der 1990er Jahre veranschaulicht diese literarische Dimension perfekt. Damisch entwickelte ein malerisches Universum mit eigenem konzeptuellem Vokabular, in dem “Welten”, “Steher”, “Flämmler” und “Wege” zu den Figuren einer persönlichen Mythologie wurden. Diese sprachliche Schöpfung parallel zur plastischen Schöpfung zeugt von einem ganzheitlichen Kunstverständnis, bei dem Malerei und Literatur sich gegenseitig nähren.
Seine Collagen, die Zeitungsausschnitte und Holzschnitte in die Bildoberfläche integrieren, bevor sie mit Farbe übermalt werden, erinnern an die Technik der Schichtung, die bei Schriftstellern geschätzt wird. Wie bei Sebald tritt die Vergangenheit unter der Oberfläche der Gegenwart hervor und erzeugt diese zeitliche Transparenz, die dem Werk seine melancholische Tiefe verleiht.
Diese schöpferische Melancholie findet ihren höchsten Ausdruck in seinen Bronzeskulpturen, die Otto Breicha als “dornige Modelle für die Gesamtheit der Welt” [2] bezeichnete. Diese fossilen Wesen scheinen die geologische Erinnerung der Erde in sich zu tragen und zeugen von jener rein literarischen Fähigkeit, im Jetzt die Spuren der langen Zeit wahrzunehmen.
Unterrichten als künstlerischer Akt
Über zwanzig Jahre lang Professor an der Akademie der bildenden Künste Wien revolutionierte Damisch die pädagogische Herangehensweise an die Kunst. Sein Unterricht zielte nicht darauf ab, “kleine Damischs” zu formen, sondern in jedem Studenten diese “kleine Kunstpflanze” zu entfachen, die er in jedem wahrnahm. Diese pädagogische Herangehensweise ist für sich genommen ein Kunstwerk, eine soziale Skulptur im Sinne Joseph Beuys.
Damisch betrachtete den Unterricht als einen Prozess gegenseitiger Transformation. Es ging nicht darum, feststehendes Wissen zu vermitteln, sondern die Bedingungen für eine gemeinsame Entdeckung zu schaffen. Seine Studenten zeugen einstimmig von dieser einzigartigen Fähigkeit, ein Lernklima zu schaffen, in dem “Kunst kann alles und muss nichts”. Diese Formel, die er gern wiederholte, fasst seine pädagogische Philosophie perfekt zusammen: einen Rahmen totaler Freiheit zu bieten und gleichzeitig höchste Anforderungen aufrechtzuerhalten.
Diese Herangehensweise hatte ihren Ursprung in seiner eigenen Ausbildung bei Arnulf Rainer und Max Melcher, aber auch in seiner Erfahrung als Musiker in der Punkband “Molto Brutto”. Damisch hatte verstanden, dass künstlerisches Lernen weniger die Aneignung von Techniken betrifft als die Fähigkeit, eine persönliche Sprache zu entwickeln. Seine Methode bestand darin, jeden Studenten auf dieser Suche nach Authentizität zu begleiten, ohne jemals seine eigene Ästhetik aufzuzwingen.
Die Zeugnisse seiner ehemaligen Studenten offenbaren einen Lehrer, der seine Herangehensweise an jede Persönlichkeit anpassen konnte. Einige benötigten Ermutigung, andere festere Herausforderungen. Damisch beherrschte diese delikate Kunst der differenzierten Pädagogik, wissend, wann er “trösten” und wann er “einen Tritt in den Hintern” geben musste, wie es ein Student ausdrückte.
Sein institutionelles Engagement zeugt ebenfalls von diesem erweiterten Kunstverständnis. Als Vorsitzender einer Kommission, Mitglied des Senats und Institutsleiter betrachtete Damisch diese administrativen Funktionen nicht als Beschränkungen, sondern als natürliche Erweiterungen seiner künstlerischen Arbeit. Es ging darum, die institutionellen Bedingungen zu schaffen, die Kunst gedeihen lassen.
Ein lebendiges Erbe
Fast zehn Jahre nach seinem Tod strahlt das Werk von Gunter Damisch weit über die Fachkreise hinaus. Seine Forschungen zu den Korrespondenzen zwischen Makro- und Mikrokosmos finden besondere Resonanz in unseren zeitgenössischen Anliegen bezüglich Ökologie und Lebenswissenschaften. Seine “dornigen Modelle für die Gesamtheit der Welt” bieten Schlüssel zum Verständnis unserer Beziehung zur Natur im Anthropozän.
Der Einfluss seines Unterrichts zeigt sich in der Vielfalt der Wege seiner ehemaligen Studenten, die heute in den unterschiedlichsten künstlerischen Bereichen aktiv sind. Diese schöpferische Zerstreuung zeugt von der Richtigkeit seiner pädagogischen Methode: Künstler auszubilden, die in der Lage sind, ihre eigene Sprache zu entwickeln, anstatt Nachahmer zu sein.
Seine plastischen Forschungen über Transformation und Metamorphose antizipieren auch die aktuellen Fragestellungen zur künstlichen Intelligenz und Biotechnologien. Indem er die Grenzgebiete zwischen organisch und anorganisch, zwischen natürlich und künstlich erforscht hat, eröffnete Damisch Wege, die die zeitgenössische Kunst erst zu beginnen scheint zu erkunden.
Die Universalität seiner plastischen Sprache erklärt seine wachsende internationale Rezeption. Seine Ausstellungen in China, Island und der Tschechischen Republik zeugen von dieser Fähigkeit, eine visuelle Sprache zu sprechen, die kulturelle Grenzen überschreitet. Seine “gasförmigen Kreaturen” und seine “Verbindungen zwischen den Welten” bieten visuelle Metaphern, um Globalisierung und interkulturellen Austausch zu denken.
Damisch hat uns ein Werk hinterlassen, das wie ein “Netz, ins Meer des Bewusstseins geworfen”, funktioniert. In einer Zeit, in der sich die zeitgenössische Kunst manchmal in reiner Konzeptualisierung oder Spektakel zu verlieren scheint, erinnert sein Beispiel daran, dass Malerei immer noch unersetzliche sinnliche Erfahrungen bieten kann. Seine Leinwände laden weiterhin zu jener “tanzenden Wahrnehmung des Selbst als Wahrnehmendem” ein, die er sich wünschte.
Wahre Kunst überdauert ihren Schöpfer, indem sie weiterhin Sinn erzeugt. Das Werk von Gunter Damisch erfüllt dieses Kriterium perfekt. Es bietet uns visuelle und konzeptuelle Werkzeuge, um die Komplexität der zeitgenössischen Welt zu begreifen, diese ständige Spannung zwischen Lokal und Global, zwischen Individuum und Kollektiv, zwischen Menschlichem und Nicht-Menschlichem, die unsere Epoche kennzeichnet.
- Tadao Ando, “Die Architektur der Leere”, Éditions du Moniteur, 2000.
- Otto Breicha, zitiert in “Gunter Damisch. Weltwegschlingen”, Hohenems/Wien, 2009.