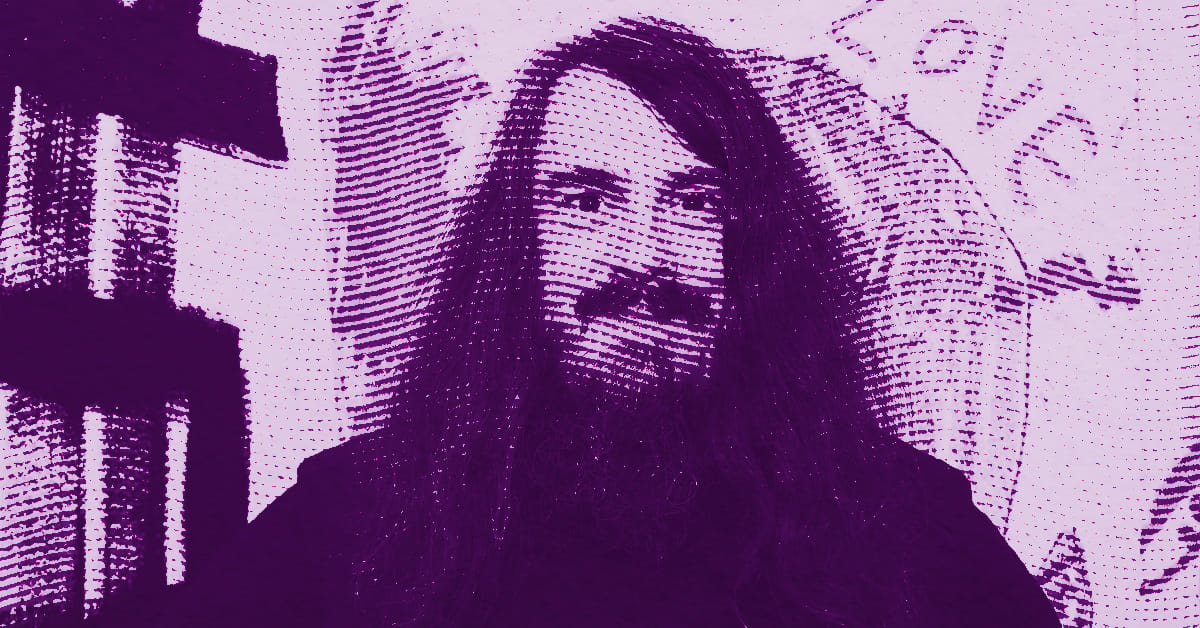Hört mir gut zu, ihr Snobs. Hier stehen wir vor einem der verwirrendsten und notwendigsten künstlerischen Phänomene unserer Zeit: Jonathan Meese, der 1970 in Tokio geborene Deutsche, der seit über zwei Jahrzehnten mit bewundernswerter Konsequenz unsere ästhetischen Gewissheiten malträtiert. In seinem Atelier-Bunker in Berlin, umgeben von seiner Mutter Brigitte, die als strenge Ausbilderin der kreativen Ordnung fungiert, schafft Meese eine Kunst, die sich beharrlich weigert, von unseren gewohnten Interpretationsmustern domestiziert zu werden. Sein malerisches Universum, bevölkert von zersetzten historischen Figuren und popkulturellen Referenzen, die mit wütendem Pinselstrich massakriert werden, stellt eine visuelle Erfahrung dar, die uns brutal mit unseren eigenen konzeptuellen Grenzen konfrontiert.
Meeses Werk begnügt sich nicht damit, den musealen Raum mit der lässigen Arroganz eines Luxus-Besetzers zu beanspruchen. Es setzt seine Präsenz durch eine chromatische und formale Gewalt durch, die gleichermaßen fesselt wie abstösst, und erzeugt das besondere Gefühl, in einem Technicolor-Albtraum gefangen zu sein, dessen Ausgang beharrlich unsichtbar bleibt. Seine Gemälde, wahre Schlachtfelder, auf denen farbige Pasten und grinsende Figuren aufeinandertreffen, zeugen von einer expressiven Dringlichkeit, die die Geschichte der deutschen Kunst wie ein glühendes Schwert durchschneidet. Diese Dringlichkeit hat ihre Wurzeln in einem komplexen Verhältnis zu Macht, Autorität und vor allem zu jener “Diktatur der Kunst”, die er mit der Inbrunst eines halluzinierten Evangelisten verkündet.
Das Unbewusste am Werk: Jonathan Meese und die psychoanalytische Maschine
Jonathan Meeses Ansatz offenbart beunruhigende Übereinstimmungen mit den Mechanismen des freudianischen Unbewussten, besonders in seiner Fähigkeit, kollektive Traumata in malerisches Material zu transformieren. Die zeitgenössische Kunst lädt, indem sie mit Abstraktion flirtet oder konzeptuelle Werke anbietet, jeden dazu ein, seine eigenen Erfahrungen, Ängste und Wünsche auf das Werk zu projizieren [1], und Meese treibt diese Logik bis zu ihren extremsten Grenzen. Seine Gemälde funktionieren als Projektionsflächen, auf denen sich unsere tiefsten Ängste gegenüber Autorität, Gewalt und Unterwerfung kristallisieren.
Der Künstler entwickelt einen kreativen Prozess, der unweigerlich an die Arbeit der Verdichtung und Verschiebung erinnert, die bei der Traumformung wirkt. Seine historischen Figuren, Hitler, Napoleon und Wagner, unterliegen plastischen Transformationen, die sie ihrer historischen Schwere berauben und in groteske, fast clowneske Gestalten verwandeln. Diese symbolische Abwertungsoperation erinnert an die psychischen Abwehrmechanismen, durch die das Individuum das neutralisiert, was es bedroht. Meese zerstört diese Figuren nicht, er macht sie lächerlich, indem er sie durch übermäßige Darstellung ihrerseits ihrer phantasmatischen Macht entkleidet.
Die obsessiv präsente Mutter in seinem kreativen Prozess ist ein entscheidendes Element, um die psychoanalytische Dimension seines Werks zu verstehen. Brigitte Meese ist nicht nur seine Assistentin, sie verkörpert eine mütterliche Autorität, die die zerstörerischen Impulse des Künstlers strukturiert und kanalisiert. Diese familiäre Konstellation erinnert an Freuds Analysen der Sublimierung, einem Prozess, bei dem aggressive Triebe sozial akzeptabel im künstlerischen Schaffen Ausdruck finden. Meese selbst erkennt an, dass seine Mutter “Ordnung schafft” in seinem Leben und Atelier, sie spielt die Rolle des wohlwollenden Über-Ichs, das es dem Künstler ermöglicht, seinen Obsessionen Gestalt zu geben, ohne in Selbstzerstörung zu verfallen.
Das komplexe Verhältnis, das Meese zur Ideologie pflegt, wird ebenfalls aus psychoanalytischer Sicht verständlich. Seine “Diktatur der Kunst” funktioniert als Kompromissform, die es erlaubt, Fantasien der Allmacht auszudrücken und sie gleichzeitig durch ihre offenkundig wahnhafte Natur zu entschärfen. Der Künstler projiziert seine dominanten Impulse auf die Kunst selbst und erschafft eine theoretische Fiktion, die ihm ermöglicht, direkte politische Bindungen zu vermeiden. Diese Vermeidungsstrategie offenbart eine besonders ausgefeilte psychische Struktur, die Angst in kreative Energie umwandeln kann und gleichzeitig eine kritische Distanz zu seinen eigenen Obsessionen wahrt.
Die Analyse seiner Selbstporträts offenbart ebenfalls eine bewusste narzisstische Dimension, die an Freuds Beschreibungen des primären Narzissmus erinnert. Meese stellt sich ständig in seinen Werken dar, aber stets mit verzerrten, grotesken Zügen, die eine ambivalente Beziehung zu seinem eigenen Bild zeigen. Diese zwanghafte Selbstrepräsentation erinnert an das von Freud beschriebene Fort-Da-Spiel, eine Wiederholungsspiel, mit dem das Kind symbolisch das beherrscht, was ihm entgleitet. Meese verschwindet und taucht auf seinen Bildern wieder auf, als würde er versuchen, seine eigene Existenz durch die Wiederholung seines Bildes zu kontrollieren.
Die triebhafte Dimension seiner Arbeit zeigt sich auch in seiner brutalen malerischen Technik, bei der die Farbe direkt aus der Tube auf die Leinwand gedrückt wird und jegliche Vermittlung durch den traditionellen Pinsel vermieden wird. Die Unmittelbarkeit der Geste erinnert an den direkten Ausdruck der Libido, ohne die üblichen Sublimierungen der klassischen künstlerischen Praxis. Meese malt, wie man eine Spannung ablässt, in der Dringlichkeit einer Erleichterung, die nicht aufgeschoben werden kann.
Die wiederkehrende Obsession für männliche Machtfiguren, Diktatoren, Kaiser und Wagner-Helden, offenbart eine Faszination für die väterliche Autorität, die der Künstler gleichzeitig aneignet und dekonstruiert. Diese Figuren fungieren als Stellvertreter des symbolischen Vaters, den er sowohl verehren als auch zerstören kann, ohne wirkliche Konsequenzen zu befürchten. Die Psychoanalyse lehrt uns, dass Kunst als Übergangsraum dienen kann, in dem unsere konfliktreichsten Beziehungen zur Autorität ausgearbeitet werden, und Meeses Werk ist ein privilegiertes Laboratorium, um diese Mechanismen in ihrem rohen Zustand zu beobachten.
Wagner und die Versuchung des totalen Kunstwerks
Die Beziehung von Jonathan Meese zu Richard Wagner offenbart eine weitere essenzielle Dimension seines künstlerischen Projekts: das Streben nach dem Gesamtkunstwerk, jenem totalen Kunstwerk, das die deutsche Kultur seit dem 19. Jahrhundert obsessiv beschäftigt. Dieser wagnerianische Ehrgeiz prägt die Praxis Meeses tief, der sich weigert, sich auf ein einziges Medium zu beschränken, und gleichzeitig Malerei, Skulptur, Performance, theoretisches Schreiben und lyrische Inszenierung entwickelt. Sein multidisziplinärer Ansatz zeugt von dem Willen, den künstlerischen Raum zu sättigen, ein Gesamtenvironment zu schaffen, in das der Betrachter eintaucht und das kohärent und bedrückend wirkt.
Der wagnerianische Einfluss zeigt sich besonders in den epischen Dimensionen seiner Installationen, die den Ausstellungsraum in ein Theater seiner persönlichen Obsessionen verwandeln. Wie Wagner seine Opern nach einer totalisierenden Dramaturgie gestaltete, in der Musik, Text, Bühnenbild und Interpretation zu einem einzigartigen Effekt beitragen, gestaltet Meese seine Ausstellungen als Gesamtspektakel, bei dem jedes Element, Gemälde, Skulpturen, Videos und Performances, Teil einer Gesamtinszenierung ist. Dieser orchestrale Ansatz der zeitgenössischen Kunst offenbart eine dämonische Ambition, die an die kulturellen Erneuerungsträume des Komponisten erinnert.
Meeses opernhafte Produktion, insbesondere seine Version von Parsifal, die 2017 bei den Wiener Festwochen uraufgeführt wurde, stellt die logische Vollendung dieses totalisierenden Ansatzes dar. Indem er sich Wagners letztem Oper widmet, reiht sich Meese in eine Reihe deutscher Künstler ein, die vom Erbe des Meisters von Bayreuth verfolgt werden. Doch wo traditionelle Regisseure meist versuchen, die mythologische Dimension Wagners durch psychologische oder soziologische Lesarten zu bändigen, treibt Meese diese Mythologie geradewegs zu ihren ekstatischsten Extremen. Sein futuristischer Parsifal, bevölkert von Science-Fiction-Figuren und angesiedelt in einer Mondbasis, radikalisiert die wagnerianische Ästhetik, anstatt sie zu neutralisieren.
Diese Strategie der Verstärkung offenbart ein feines Verständnis der ästhetischen und ideologischen Dimensionen der wagnerianischen Oper. Anstatt zu versuchen, Wagner von seinen problematischsten Aspekten zu säubern, wählt Meese, diese bis ins Absurde zu übersteigern, wodurch eine Art künstlerische Impfung gegen totalitäre Versuchungen entsteht. Sein Parsifal wird zur Parodie der kollektiven Erlösungssehnsüchte und verwandelt das heilige Drama in eine Oper des wilden Weltraums, in der die Suche nach dem Gral zur B-Movie-Abenteuerreise wird.
Meeses szenografischer Ansatz zeigt ebenfalls eine vollendete Beherrschung der wagnerianischen visuellen Codes, die er zu kritischen Zwecken umdeutet. Kostüme, Bühnenbilder und Beleuchtung entlehnen dem ästhetischen Vokabular Bayreuths, infiltrieren es aber mit popkulturellen und Science-Fiction-Elementen, die dessen Künstlichkeit entlarven. Diese stilistische Kontamination erzeugt einen Distanzierungseffekt, der es dem Publikum erlaubt, die Verführungsmethoden in Wagners Kunst wahrzunehmen, ohne ihnen jedoch zu erliegen.
Die zeitliche Dimension ist ein weiterer Verbindungspunkt zwischen Wagner und Meese. Wie Wagners Opern ihre Wirkung über ungewöhnlich lange Dauern entfalten, die die Zuschauerwahrnehmung übersättigen, schaffen Meeses Installationen eine spezifische, gedehnte Temporalität, bei der die Anhäufung visueller Elemente eine Art sensorische Erschöpfung hervorruft. Diese Strategie der verlängerten Immersion zielt darauf ab, die rationalen Widerstände des Publikums zu überwinden, um primitivere, unmittelbar emotionalere Aufnahmebereiche zu erreichen.
Die wagnerianische Ambition der kulturellen Erneuerung findet bei Meese eine zeitgenössische Umsetzung in seiner Theorie der “Dictature de l’Art”. So wie Wagner von einer Kunst träumte, die die deutsche Gesellschaft neu begründen könnte, prophezeit Meese das Aufkommen eines ästhetischen Herrschaftsystems, das die traditionellen politischen Spaltungen übersteigt. Diese künstlerische Utopie, so verrückt sie auch sein mag, zeugt von einer Persistenz totalisierender Bestrebungen in der deutschen Kultur, die Meese reaktiviert und gleichzeitig durch den Übermaß ihrer Formulierung ihrer Gefährlichkeit entkleidet.
Das Erbe Wagners zeigt sich auch in der Auffassung, die Meese von der Rolle des Künstlers hat. Wie Wagner sich als umfassender Kulturreformer, Theoretiker ebenso wie Schöpfer, sah, entwickelt Meese ein umfangreiches theoretisches Werk, in dem er seine Welt- und Kunstanschauung darlegt. Seine Manifeste, Interviews und theoretischen Performances sind Teil dieses pädagogischen Anspruchs, der den Künstler zum geistigen Führer seiner Zeit macht. Diese prophetische Haltung, geerbt vom deutschen Romantizismus und von Wagner verstärkt, findet bei Meese einen zeitgenössischen Ausdruck, der sowohl die Notwendigkeit als auch die Grenzen offenbart.
Die Ästhetik des Widerspruchs
Was sofort im Universum von Jonathan Meese auffällt, ist seine Fähigkeit, scheinbar unvereinbare Elemente in Spannung zu halten. Einerseits verkündet dieser Mann von über fünfzig Jahren, der noch bei seiner Mutter lebt, mit der Vehemenz eines revolutionären Tribuns die Notwendigkeit einer “Diktatur der Kunst”. Andererseits entwickelt er eine malerische Praxis von unerwarteter Zärtlichkeit, in der die leuchtenden Farben und biomorphen Formen sowohl die Welt der Kindheit als auch die Albträume des Erwachsenenalters hervorrufen. Diese bewusst angenommene Schizophrenie ist vielleicht der Dreh- und Angelpunkt seines ästhetischen Systems: jeglichen interpretatorischen Komfort verweigern, den Betrachter in einem Zustand produktiver Ungewissheit halten.
Seine jüngsten Gemälde, insbesondere diejenigen, die Scarlett Johansson oder mütterlichen Figuren gewidmet sind, zeigen eine chromatische Sensibilität, die den großen Farbmeistern der Kunstgeschichte in nichts nachsteht. Doch diese technische Meisterschaft wird ständig durch absichtlich grobe Elemente sabotiert: Markerschriften, zufällige Collagen, heftige Auftragungen, die jede Leinwand in ein ästhetisches Schlachtfeld verwandeln. Meese scheint unfähig, Schönes zu schaffen, ohne es sofort zu beschmutzen, als fürchtete er die Zauber der künstlerischen Verführung.
Diese Ästhetik der Selbstsabotage findet ihren radikalsten Ausdruck in seinen Performances, in denen der Künstler abwechselnd die Rollen des Narren und des Diktators, des Propheten und des Scharlatans übernimmt. Seine öffentlichen Auftritte sind stets spektakulär und schaffen eine produktive Verstörung, die unsere Erwartungen an die Figur des zeitgenössischen Künstlers hinterfragt. Indem er die Haltung des distinguierten Intellektuellen ebenso verweigert wie die des romantischen Rebellen, erfindet Meese eine neuartige künstlerische Persona, die zugleich grotesk und charismatisch ist und unsere Rezeptionsgewohnheiten destabilisiert.
Sein Verhältnis zur deutschen Geschichte veranschaulicht diese widersprüchliche Logik perfekt. Statt kompromittierende Symbole zu vermeiden oder sie frontal zu denunzieren, wählt er, sie in sein ästhetisches Universum einzubeziehen, indem er sie durch Wiederholung und Verzerrung ihrer dramatischen Ladung beraubt. Diese Strategie der symbolischen Erschöpfung offenbart eine bemerkenswerte taktische Intelligenz: Indem Meese die Ikonen des Bösen in bunte Marionetten verwandelt, entzieht er ihnen ihre Faszinationskraft, bewahrt jedoch gleichzeitig ihre kritische Funktion.
Die Anhäufung heterogener Objekte in seinen Installationen folgt derselben Logik der semantischen Sättigung. Spielzeuge, militärische Artefakte, Pop-Referenzen, Fragmente klassischer Werke treffen in einem organisierten Chaos aufeinander, das jeden Versuch einer kulturellen Hierarchisierung herausfordert. Diese Gleichsetzung durch Übermaß erzeugt einen Schwindeleffekt, der uns der Willkür unserer ästhetischen Wertmaßstäbe konfrontiert. Bei Meese ist eine Darth-Vader-Maske so viel wert wie eine Napoleon-Büste, und diese bewusst hergestellte Gleichwertigkeit ist vielleicht sein subversivster Beitrag zur zeitgenössischen künstlerischen Debatte.
Jenseits des Spektakels: Die Frage der Notwendigkeit
Hinter dem Medienzirkus und den kalkulierten Provokationen stellt das Werk von Jonathan Meese eine grundlegende Frage: die nach der Notwendigkeit der Kunst in unseren entzauberten Gesellschaften. Seine “Diktatur der Kunst”, trotz ihrer wirren Aspekte, formuliert eine legitime Forderung: dass die Kunst eine soziale Funktion wiedererlangt, die über reine kulturelle Unterhaltung oder spekulative Investitionen hinausgeht. Indem er verkündet, dass nur die Kunst die Menschheit vor tödlichen Ideologien retten kann, reaktiviert Meese eine utopische Tradition, die sich durch die Geschichte der künstlerischen Moderne zieht, von der russischen Avantgarde bis zum französischen Surrealismus.
Diese prophetische Dimension darf nicht die Strenge seines formalen Vorgehens verdecken. Meese beherrscht die Codes der internationalen zeitgenössischen Kunst perfekt, entscheidet sich jedoch, sie zum Dienst eines persönlichen Projekts zu verwenden, das sich den üblichen kritischen Kategorien entzieht. Seine Zusammenarbeit mit Albert Oehlen, Daniel Richter oder Tal R zeugt von einer Dialogfähigkeit mit seinen Kollegen, die das Bild eines isolierten Künstlers in seinen Obsessionen widerlegt. Diese kollektive Dimension seiner Arbeit offenbart eine Widerstandsstrategie gegenüber dem entfesselten Individualismus des zeitgenössischen Kunstmarktes.
Die jüngste Entwicklung seiner Praxis, geprägt von der Weigerung, für seine Ausstellungen zu reisen, und einer Rückbesinnung auf sein Berliner Atelier, deutet auf eine Reifung hin, die Aufmerksamkeit verdient. Indem Meese Sesshaftigkeit dem künstlerischen Nomadentum vorzieht, bestätigt er die Priorität des kreativen Prozesses über dessen Medialisierung. Diese unerwartete Weisheit bei einem Künstler, der für seine Exzesse bekannt ist, zeugt von einer wachsenden Klarheit über die Fallstricke des aktuellen Kunstsystems.
Seine jüngsten Werke, symbolisch weniger aufgeladen als seine Produktionen der 2000er Jahre, zeigen eine relative Beruhigung, die jedoch die expressive Intensität nicht ausschließt. Die Serien, die keramischen Masken oder mentalen Landschaften gewidmet sind, zeigen einen Künstler, der in der Lage ist, sich weiterzuentwickeln, ohne seine grundlegenden Obsessionen zu verleugnen. Diese Fähigkeit zur Erneuerung, selten in der zeitgenössischen Kunstszene, legt nahe, dass Meese den Status des schwarzen Schafs, das ihm anhaftet, hinter sich lassen und eine dauerhaftere Anerkennung erlangen könnte.
Denn genau darum geht es letztendlich: Jonathan Meese konfrontiert uns mit unseren eigenen Grenzen, unseren Ängsten, unseren verdrängten Wünschen mit einer heilsamen Brutalität, die jede Begegnung mit seinem Werk zu einer transformierenden Erfahrung macht. In einer künstlerischen Landschaft, die oft von Handelszwängen und institutionellen Konventionen gezähmt wird, hält er diese störende Funktion der Kunst lebendig, die uns zwingt, unsere Gewissheiten zu hinterfragen. Und dafür können wir ihm paradoxerweise dankbar sein. Auch wenn, vor allem wenn, seine Kunst uns zutiefst unwohl sein lässt, indem sie uns mit unseren eigenen Grenzen konfrontiert.
- “Das Subjekt, die Psychoanalyse und die zeitgenössische Kunst”, Cairn.info, 2012