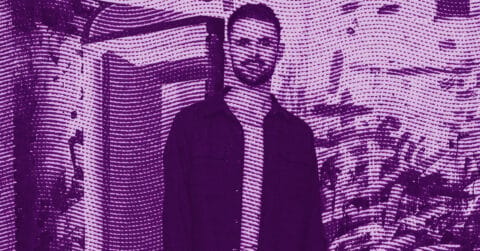Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch an den neuesten Extravaganzen des westlichen Kunstmarktes ergötzt, webt ein Mann in Tamale, im Norden Ghanas, eine Poetik des Verfalls, die eure bequemen Gewissheiten zu Fall bringt. Ibrahim Mahama spielt nicht das Spiel, das ihr von ihm erwartet. Er lehnt die Codes ab, unterläuft die Erwartungen und baut buchstäblich ein Werk, das die Fundamente unserer materiellen und narrativen Strukturen hinterfragt. Dieser Künstler, geboren 1987, begnügt sich nicht damit, monumentale Installationen zu schaffen: Er schreibt die Regeln der Architektur und Literatur in einer Sprache neu, die aus abgenutzten Jutesäcken, verlassenen Waggons und verfallenen Krankenhausbetten besteht.
Reden wir über Architektur, denn Mahama geht sie mit einer Kühnheit an, die viele zeitgenössische Baumeister erröten lassen würde. Wo andere sich damit begnügen, Stoffe nur zur Zier an Fassaden zu drapieren, besetzt er die Strukturen mit einer konzeptuellen Gewalt, die unsere räumlichen Vorstellungen erschüttert. Seine architektonischen Interventionen sind keine bloßen ästhetischen Gesten. Sie verkörpern eine materielle Kritik am Kolonialismus und dessen maroden Infrastrukturen. Wenn er das Barbican in London mit Purple Hibiscus umhüllt, dieser massiven Installation aus zweitausend Quadratmetern Stoff, dekoriert er kein Gebäude: Er erstickt es symbolisch unter der Last der postkolonialen Geschichte [1]. Die Geste ist brutal, fast erstickend, wie die kolonialen Erbschaften, die er anprangert.
Aber Architektur ist für Mahama nie nur metaphorisch. Sie wird zum Schauplatz einer konkreten sozialen Experimentation. Mit dem Savannah Centre for Contemporary Art, das er 2019 gründete, sowie mit Red Clay Studio und Nkrumah Volini errichtet er Räume, die die westlichen Konventionen kultureller Institutionen herausfordern. Diese Gebäude, aus lokal gebrannten Lehmziegeln gebaut, versuchen nicht, die klimatisierten Museen Europas zu imitieren. Mahama betont, dass Kunst in Beziehung zu den lokalen Bedingungen denken muss und dass Qualität nicht minderwertig ist, nur weil sie sich an die energetischen und klimatischen Beschränkungen Ghanas anpasst. Dieser pragmatische, aber radikale architektonische Ansatz kehrt die implizite Hierarchie zwischen Nord und Süd um. Seine Bauten sind keine armen Substitute westlicher Institutionen: Sie sind alternative Modelle, die die Relevanz jener Standards hinterfragen, die wir als universell betrachten.
Architektur wird für Mahama auch zu einem Akt materieller Erinnerung. Wenn er koloniale Eisenbahnwaggons in Klassenzimmer und Tonstudios verwandelt, praktiziert er eine Form von zeitlicher Chirurgie. Diese Infrastrukturen, einst Instrumente der britischen kolonialen Ausbeutung, verwandeln sich in pädagogische Räume für lokale Gemeinschaften. Das vom Boden der Waggons gerissene Leder, gezeichnet von Verfall und Zeit, offenbart Wunden, die zum perfekten Material des Werks werden. Wie er selbst sagt, ähnelt dieses Leder einer abgeschälten Haut, die alle Narben eines kriselnden Gesundheitssystems trägt. Diese architektonische Transformation verklärt nichts: Sie legt offen, seziert und enthüllt die in den Materialien selbst verankerten Traumata.
Aber vielleicht entfaltet Mahama seine tödlichste Subtilität in seinem literarischen Ansatz. Nicht, weil er schreibt, obwohl er Essays und theoretische Überlegungen verfasst, sondern weil er sein Werk als ein gewebter Text denkt, eine materielle Erzählung, die mit den großen Stimmen der afrikanischen Literatur in Dialog tritt. Wenn er eine Ausstellung Purple Hibiscus nach dem Roman von Chimamanda Ngozi Adichie [1] betitelt, ist das nicht einfach ein kultureller Wink. Er zieht eine strukturelle Parallele zwischen Adichies Schreibweise und seiner eigenen Praxis. Adichies 2003 veröffentlichter Roman erzählt die Geschichte von Kambili, einer Jugendlichen, die unter der tyrannischen Herrschaft eines Vaters lebt, der gleichzeitig ein philanthropischer öffentlicher Mann und ein gewalttätiger Häuslicher ist. Die purpurne Hibiskusblüte im Garten der Tante Ifeoma symbolisiert Freiheit und Rebellion gegen familiäre und religiöse Unterdrückung.
Mahama versteht, dass diese seltene Blume genau dieselbe symbolische Ladung trägt wie seine eigenen wiederverwendeten Materialien. Seine Jutesäcke mit dem Aufdruck “Product of Ghana” sind aus Südostasien gekommen, um den ghanaischen Kakao zu transportieren, die größte Exportressource des Landes zu Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts. Diese Säcke verkörpern, wie der purpurne Hibiskus bei Adichie, eine Form subtilen Widerstands, eine Schönheit, die gegen unterdrückerische Strukturen ankämpft. Sie tragen die Spuren von Zwangsarbeit, erzwungener Migration und systematischer Ausbeutung. Indem er sie mit lokalen Mitarbeitern zu monumentalen Patchworks zusammensetzt, praktiziert Mahama eine Form kollektiven Schreibens, eine Erzählung, die Faden für Faden zusammengenäht wird.
So wie Adichie im Englischen Igbo verwendet, um eine hybride Sprache zu schaffen, die koloniale Hegemonie ablehnt, mischt Mahama koloniale Materialien (importierte Säcke, britische Schienen) mit lokalen Techniken (Handweberei, Lehmkonstruktion). Diese materielle erzählerische Strategie schafft ein formales Vokabular, das gleichzeitig mehrere Sprachen spricht. Das Werk wird polyphon und lehnt die stilistische Reinheit ab, die ihm die westliche Kunstwelt aufzwingen möchte. Er zitiert auch Chinua Achebe, indem er einige Werke nach den Titeln des nigerianischen Romanautors benennt, und schafft so ein intertextuelles Netzwerk, das seine Arbeit im afrikanischen literarischen Erbe verankert [2].
Diese literarische Dimension beschränkt sich nicht auf entliehene Titel. Mahama praktiziert das, was man als “materielle Lesart” der Geschichte bezeichnen könnte. Seine Werke funktionieren als nicht-lineare Erzählungen, bei denen jedes Objekt eine narrative Schicht trägt. Die wiederverwendeten Schulpulte, die Schuhputzkästen, die Fischräuchernetze: all diese Elemente bilden ein narratives Vokabular, das Geschichten von Arbeit, Migration und wirtschaftlichem Überleben erzählt. Mahama erklärt, dass ihn der Moment interessiert, in dem die Beziehung zwischen Material und Gesellschaft zerbricht, wodurch die Risse im System sichtbar werden. Diese Aufmerksamkeit für den narrativen Bruch erinnert an modernistische Fragmentierungstechniken, jedoch angewandt im skulpturalen und architektonischen Bereich.
Der Begriff der “Geister” durchzieht sein Werk ebenfalls wie ein literarisches Leitmotiv. Während der COVID-19-Pandemie schreibt er, dass “die Versprechen der Gegenwart mit den Geistern der Zukunft und der Vergangenheit beginnen können” [3]. Diese Geister sind die Verkörperung unbeachteter Versprechen, abgebrochener Zukünfte, aufgegebener Infrastrukturen. Sie spuken in seinen Installationen wie gespenstische Figuren in gotischen Romanen. Anders als im europäischen Gotik beschäftigt sich Mahamas Geister jedoch mit politischen und wirtschaftlichen Themen und sind tief in postkolonialen Realitäten verankert. Sie terrorisieren nicht: sie zeugen.
Seine Arbeitsweise selbst erinnert an kollaborative Schreib- und Redaktionsprozesse. Er kauft Materialien von Schrottplätzen, demontiert sie, untersucht sie und setzt sie wieder zusammen. Es ist ein Prozess des materiellen Umschreibens, des Korrigierens, der Annotation. Mahama spricht von einer “zeitlichen Reise”, um seinen Ansatz zu beschreiben: eine Art, zwischen Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft zu navigieren, indem er verlassene Objekte reaktiviert. Diese fließende Zeitvorstellung erinnert an die komplexen narrativen Strukturen der postmodernen Literatur, in der die lineare Zeit zugunsten verflochtener zeitlicher Schichten aufgelöst wird.
Was Mahama wirklich subversiv macht, ist seine kategorische Ablehnung der Ästhetik des Trostes. Er bietet keine beruhigenden, schönen Metaphern über die afrikanische Resilienz an. Er verklärt die Armut nicht zu einem Exotismus für gelangweilte Sammler. Im Gegenteil, seine Werke bewahren die Rauheit, den Schmutz, die Gebrauchsspuren. Die Jutesäcke bleiben zerrissen, fleckig, manchmal stinkend. Diese Ästhetik des bewusst angenommenen Abfalls lehnt das Vokabular der westlichen Schönheit ab und schafft gleichzeitig visuell überwältigende Kompositionen. Es ist ein mächtiges Paradoxon: monumentale Werke aus Trümmern, die Respekt gebieten und dabei konventionelle Größe ablehnen.
Die pädagogische Dimension seiner Arbeit verdient ebenfalls Aufmerksamkeit. Mahama investiert die Einnahmen aus seinen Verkäufen in den Bau von Gemeinschaftsräumen. Er verwandelt verlassene Getreidesilos, ausrangierte Flugzeuge und Gefängnisse in Lernräume. Diese architektonische und soziale Praxis ist vielleicht sein radikalstes Werk: die materiellen Bedingungen zu schaffen, damit künftige Künstlergenerationen entstehen können. Er behauptet, wenn man künstlerische Gemeinschaften aufbaut, “sind diese Gemeinschaften voller Liebe”. Eine Aussage, die naiv erscheinen mag, aber an Gewicht gewinnt, wenn man die konkrete Wirkung seiner Infrastruktur im Norden Ghanas betrachtet.
Denn das ist der Kern der Sache: Mahama lehnt die Trennung zwischen künstlerischer Praxis und sozialer Verantwortung ab. Er verwirft die Idee, dass zeitgenössische afrikanische Kunst einfach Objekte für internationale Märkte produzieren soll. Seine Räume funktionieren als Gegeninstitutionen, Laboratorien, in denen die lokale Intelligenz über importierte Modelle gestellt wird. Er arbeitet mit Tischlern, Schustern, Wachleuten, Tätowierern zusammen, Menschen, deren Fähigkeiten in der Kunstwelt normalerweise unsichtbar bleiben. Dieser kollaborative Ansatz erzeugt Werke, die die Spuren vieler Hände, vieler Stimmen tragen.
Westliche Kritiker lieben es, über “Dekolonisierung” zu sprechen, als handele es sich um eine elegante intellektuelle Haltung. Mahama hingegen dekolonisiert konkret: indem er koloniale Infrastruktur zurückgewinnt und neu nutzt, alternative Wirtschaften um materielle Wiederverwertung schafft und Jugendliche im Norden Ghanas statt in London oder New York ausbildet. Seine Dekolonisierung ist nicht rhetorisch: sie ist materiell, architektonisch, wirtschaftlich. Marie-Ann Yemsi, Kuratorin im Palais de Tokyo in Paris, betont gerade, dass er “eine immense Rolle bei der Dekolonisierung der Vorstellungskraft spielt” [4].
Es wäre verlockend, optimistisch zu enden und Mahama als einen Helden der zeitgenössischen Kunst, ein Vorbild für alle, zu feiern. Aber das wäre ein Verrat am Geist seines Werks selbst. Denn was Mahama uns bietet, ist kein Triumphgeschichten, sondern eine tiefgründige Meditation über das Scheitern als fruchtbares Material. Er selbst sagt, dass ihn das Scheitern als Material, aber auch als Potenzial interessiert, die Idee, dass das Scheitern ein Portal öffnet, um die Welt, in der wir leben, neu zu lesen. Diese Philosophie des produktiven Scheiterns stellt unsere heroischen Erwartungen auf den Kopf. Sie legt nahe, dass es gerade im Ausfall, im Bruch, im Aufgeben die Chancen zur Neuerfindung gibt.
Seine verrosteten Waggons, seine abgenutzten Krankenhausbetten, seine zerrissenen Säcke: all dies zeugt von Systemen, die gescheitert sind. Das koloniale Eisenbahnsystem, das nie den einheimischen Bevölkerungen diente. Das unterfinanzierte Gesundheitssystem. Die Weltwirtschaft, die afrikanische Rohstoffe wie einfache Handelswaren behandelt. Mahama versteckt diese Misserfolge nicht. Er legt sie offen, untersucht sie und verwandelt sie in Denkwerkzeuge. Seine Werke werden zu Autopsien des postkolonialen Kapitalismus, die die Mechanismen der Ausbeutung in der Beschaffenheit der Materialien selbst offenbaren.
Was Mahama von Künstlern unterscheidet, die sich mit bloßer Anklage zufriedengeben, ist, dass er gleichzeitig Alternativen schafft. Seine Kunstzentren sind keine Denkmäler für seinen eigenen Ruhm, sondern lebendige Infrastrukturen, die sich ständig verändern. Sie beherbergen Ausstellungen, die sechs Monate dauern, um es den abgelegenen Dorfbewohnern zu ermöglichen, die Reise anzutreten. Sie archivieren die Werke ghanaischer Künstler früherer Generationen, deren Arbeiten im Verschwinden begriffen waren. Sie bilden Kinder in Programmierung, Robotik und digitalen Technologien aus und bewahren dennoch eine Verankerung in materiellen Praktiken.
In einer von Neuheit besessenen zeitgenössischen Kunstwelt praktiziert Mahama eine andere Zeitlichkeit. Seine Werke blicken zurück, um nach vorne zu imaginieren. Sie schöpfen aus den Ruinen der Vergangenheit die Materialien der Zukunft. Diese Haltung zur Zeit ist weder nostalgisch noch futuristisch: sie ist gleichzeitig archäologisch und visionär. Er gräbt die Schichten der kolonialen und postkolonialen Geschichte aus, um unerforschte Potentialitäten zu gewinnen.
Ja, Ibrahim Mahama verdient Aufmerksamkeit. Nicht weil er die zeitgenössische afrikanische Kunst repräsentiert (als ob eine solche monolithische Kategorie existierte), sondern weil er eine radikale Neubewertung dessen vorschlägt, was Kunst in der Welt bewirken kann. Er erinnert uns daran, dass Materialien Geschichten tragen, dass Gebäude Texte sind, dass künstlerische Gesten reale Gemeinschaften erschaffen können. Sein Werk ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Kunst nicht zwischen intellektueller Strenge und sozialer Wirkung, zwischen formaler Schönheit und politischem Engagement wählen muss. Sie kann all das gleichzeitig sein, in all ihrer rauen und großartigen Komplexität. Und wenn Sie das stört, umso besser: genau das war die Absicht.
- Chimamanda Ngozi Adichie, Purple Hibiscus, Algonquin Books, 2003.
- Chinua Achebe, nigerianischer Schriftsteller (1930-2013), unter anderem Autor von Things Fall Apart (1958), das als Gründungstext der modernen postkolonialen afrikanischen Literatur gilt.
- Ibrahim Mahama, Beitrag zur Serie Messages of Hope von Designboom während der COVID-19-Pandemie.
- Marie-Ann Yemsi, Kuratorin der Ausstellung Ubuntu, a Lucid Dream im Palais de Tokyo in Paris.