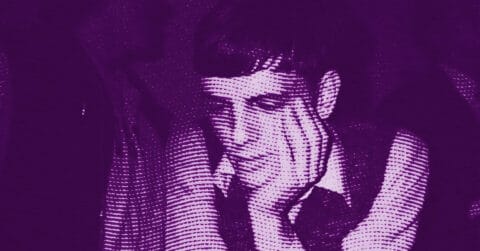Hört mir gut zu, ihr Snobs. Ein neuer Stern ist am japanischen Kunstfirmament aufgegangen, und er stammt nicht aus dem virtuellen Nichts eurer Börsenspekulationen. Emi Kuraya, geboren 1995 in Kanagawa, verkörpert diese neue Generation japanischer Künstlerinnen, die das kulturelle Erbe des Manga in eine zeitgenössische, zutiefst emotionale malerische Erfahrung verwandelt.
In einem Japan, in dem soziale Einsamkeit zu einer Epidemie wird, die virulenter ist als COVID-19, malt Kuraya adolescenten Mädchen, die zwischen zwei Welten schweben. Ihre Heldinnen, eingefroren in einem schwebenden Moment, blicken den Betrachter mit einer Intensität an, die an die Porträts von Lucas Cranach dem Älteren erinnert. Diese Referenz ist nicht zufällig: Wie der deutsche Renaissance-Meister, der seine Venusfiguren mit einer beunruhigenden Mischung aus Unschuld und Sinnlichkeit malte, fängt Kuraya ihre jungen Modelle in einem zeitlichen Zwischenraum ein, zwischen der dahinschwindenden Kindheit und dem drohenden Erwachsenenalter.
Kurayas Technik ist ebenso einzigartig wie ihre Vision. Auf einem Gesso-Grund, der der Leinwand ihre ursprüngliche Rauheit verleiht, trägt sie die Ölfarbe in so dünnen Schichten auf, dass es scheint, als wäre sie vom Wind hauchzart aufgetragen worden. Anschließend tupft sie die Farbe mit Taschentüchern ab und schafft so eine luftige Textur, die eher an Aquarell als an traditionelle Ölmalerei erinnert. Dieser technische Ansatz spiegelt die japanische Philosophie des Mono No Aware wider, das scharfe Bewusstsein für die Vergänglichkeit der Dinge.
Betrachten Sie “Flying Dog and Girl” (2023): Ein junges Mädchen und ein Hund schweben über einer gewöhnlichen städtischen Landschaft. Dieses Werk ist nicht nur eine einfache Manga-Fantasie auf Leinwand übertragen. Es veranschaulicht perfekt das japanische philosophische Konzept des “ma”, jenes spatio-temporalen Intervalls, das weder hier noch dort, weder präsent noch abwesend ist. Die schwebenden Figuren Kurayas bewohnen genau diesen liminalen Raum, als wären sie zwischen der Erdanziehungskraft und der himmlischen Anziehungskraft suspendiert.
Die zeitgenössische japanische Gesellschaft, mit ihrer erdrückenden sozialen Starrheit und ihren überwältigenden Erwartungen an die Jugend, spiegelt sich in jedem Gemälde wider. Die Mädchen von Kuraya, mit ihren makellosen Schuluniformen und ihren rätselhaften Blicken, verkörpern das, was der Philosoph Roland Barthes in seiner Analyse der japanischen Kultur als das “Nullniveau des Schreibens” bezeichnete. Sie sind da, vor uns, aber ihre bloße Anwesenheit ist eine Form der Abwesenheit, ein stiller Kommentar zur sozialen Entfremdung im japanischen Archipel.
Nehmen wir “Ferris Wheel: Girl” (2023), wo ein junges Mädchen in einer Gondel eines Riesenrads sitzt. Die scheinbar einfache Bildkomposition offenbart eine schwindelerregende Komplexität: die Kabine, zwischen Himmel und Erde schwebend, wird zur Metapher der zeitgenössischen japanischen Jugend, gefangen zwischen alten Traditionen und verschlingender Modernität. Dieses Werk steht in direktem Dialog mit dem philosophischen Konzept des “Dazwischen-Seins”, entwickelt von Martin Heidegger, jenem existenziellen Zustand, in dem das Individuum zwischen verschiedenen Seinsmöglichkeiten schwebt.
Die Künstlerin, die 2018 als Studentin an der Tama Art University in Tokio dem Kollectiv Kaikai Kiki von Takashi Murakami beitrat, begnügt sich nicht damit, die Codes des Manga zu recyclen. Sie transzendiert sie, um eine einzigartige malerische Sprache zu schaffen, in der die japanische Popkultur auf die große Tradition der westlichen Ölmalerei trifft. Ihre weiblichen Figuren, sowohl inspiriert von engen Freundinnen als auch von Fremden auf der Straße oder Anime-Heldinnen, werden zu Schauspielerinnen eines sozialen Theaters, in dem das stille Drama der japanischen Jugend aufgeführt wird.
Die städtischen Landschaften, die als Hintergrund für ihre Kompositionen dienen, sind nie zufällig gewählt. Es sind Orte, die sie intim kennt, im Landkreis Kanagawa, die durch ihre Vision in nahezu metaphysische Szenen verwandelt werden. Verlassene Parkplätze, anonyme Wohnstraßen, banale Supermärkte werden unter ihrem Pinsel zu Übergangsräumen, in denen der banalste Alltag ins Fremde kippt.
Betrachten wir, wie Kuraya das Licht verwendet: ihre blassen Himmel, ihre metallischen Reflexionen auf der städtischen Möblierung, ihre sanften Schatten schaffen eine Atmosphäre, die an “ukiyo-e”, die “Bilder der schwebenden Welt” der Edo-Zeit, erinnert. Aber während die Meister der japanischen Holzschnittkunst die flüchtigen Freuden der Vergnügungsviertel darstellten, fängt Kuraya die diffuse Melancholie einer Generation ein, die nach ihrem Platz in einem sich ständig wandelnden Japan sucht.
Diese Spannung zwischen Tradition und Moderne, zwischen Realität und Imagination, zwischen Schwere und Schwerelosigkeit macht Kurayas Werk zu einem subtilen Kommentar zur weiblichen Situation im Japan des 21. Jahrhunderts. Ihre stillen Heldinnen, mit ihren großen ausdrucksvollen Augen und ihren starren Posen, werden zu stummen Sprachrohren einer Generation, die unter dem Gewicht sozialer Konventionen erstickt und zugleich vom Aufbruch träumt.
Kurayas Arbeit überschreitet den einfachen Dialog zwischen Manga und westlicher Malerei, um eine universelle Dimension zu erreichen. Ihre Figuren, obwohl in der zeitgenössischen japanischen Realität verankert, berühren etwas Tieferes: jene Übergangszeit, in der sich Identität kristallisiert, in der die Gewissheiten der Kindheit angesichts der Mehrdeutigkeiten des Erwachsenseins zerfließen.
Ihre Farbpalette, dominiert von Pastelltönen, die wie vom Regen ausgewaschen wirken, erinnert an die vaporösen Atmosphären der Gemälde von William Turner. Doch während der englische Meister versuchte, die wechselhaften Stimmungen der Natur einzufangen, malt Kuraya die subtilen Schwankungen jugendlicher Emotionen, jene innere Meteorologie, so instabil wie Gewitterhimmel.
In ihren letzten Werken, wie denen, die 2024 in Hongkong ausgestellt wurden, treibt die Künstlerin ihre Erforschung der zeitgenössischen weiblichen Identität weiter voran. Die Figuren, die sie malt, sind nicht mehr nur Manga-Archtypen, sondern werden zu Akteurinnen einer umfassenderen Reflexion über den Aufbau des Selbst in einer hypervernetzten Gesellschaft. Ihre Charaktere, oft in Momenten kontemplativer Einsamkeit eingefangen, verkörpern das, was der Soziologe Zygmunt Bauman “flüssige Moderne” nannte, diesen zeitgenössischen Zustand, in dem Identitäten fließend und ständig zwischen Realität und Virtualität verhandelt werden.
Kuraya verwandelt alltägliche Szenen in Momente visueller Epiphanie. Ein Parkplatz wird zu einem metaphysischen Theater, eine gewöhnliche Straße verwandelt sich in eine Bühne, auf der ein stilles Drama gespielt wird, ein Supermarkt wird zu einem liminalen Raum, in dem die Zeit stillzustehen scheint. Diese Verwandlung des Banalen erinnert an die Herangehensweise der italienischen metaphysischen Maler wie Giorgio de Chirico, aber ohne deren existenziellen Pessimismus.
Mit nur 29 Jahren hat Emi Kuraya bereits eine unverwechselbare künstlerische Stimme entwickelt, die weit über die Grenzen Japans hinaus hallt. Ihre Ausstellungen in der Galerie Perrotin, von Paris bis Shanghai und Seoul, zeigen, dass ihre Kunst eine universelle Saite berührt. In einer Welt, in der die Jugendzeit immer länger wird und Identität ein zunehmend fließendes Konzept ist, fangen ihre Gemälde etwas Wesentliches über die zeitgenössische menschliche Existenz ein.
Die Künstlerin beschränkt sich nicht darauf, Porträts zu malen, sie erschafft Fenster zur Innerlichkeit ihrer Sujets. Ihre Figuren blicken uns mit einer Intensität an, die uns zwingt, über unsere eigene Beziehung zu Zeit, Raum und Identität nachzudenken. In einer Zeit, die von Geschwindigkeit und Leistung besessen ist, laden ihre Bilder zu einer kontemplativen Pause ein, zu einem Moment des Innehaltens, in dem die Zeit selbst den Atem anzuhalten scheint.
Kuraras frühzeitiger Erfolg könnte die Befürchtung nahelegen, sie könnte sich auf ihren Lorbeeren ausruhen, doch jede neue Ausstellung offenbart eine Künstlerin in stetiger Entwicklung. Ihre Technik verfeinert sich, ihre Vision vertieft sich, und ihre Erforschung der Grenzen zwischen Realität und Fiktion wird immer anspruchsvoller. Sie verkörpert perfekt diese neue Generation japanischer Künstlerinnen, die es, obwohl sie sich in einer jahrtausendealten Tradition verankern, schaffen, eine entschieden zeitgenössische visuelle Sprache zu kreieren.
In einer Kunstwelt, die oft zynisch und desillusioniert ist, erinnert uns Kuraya daran, dass Malerei uns immer noch berühren, träumen und nachdenken lassen kann. Ihre Gemälde sind visuelle Gedichte, die von Einsamkeit und Verbindung, Entfremdung und Hoffnung, Schwere und Aufstieg erzählen. Und vielleicht liegt hierin ihr größtes Talent: uns durch ihre schwebenden Figuren fühlen zu lassen, dass auch wir in der Lage sind, uns über die Schwere des Alltags zu erheben.