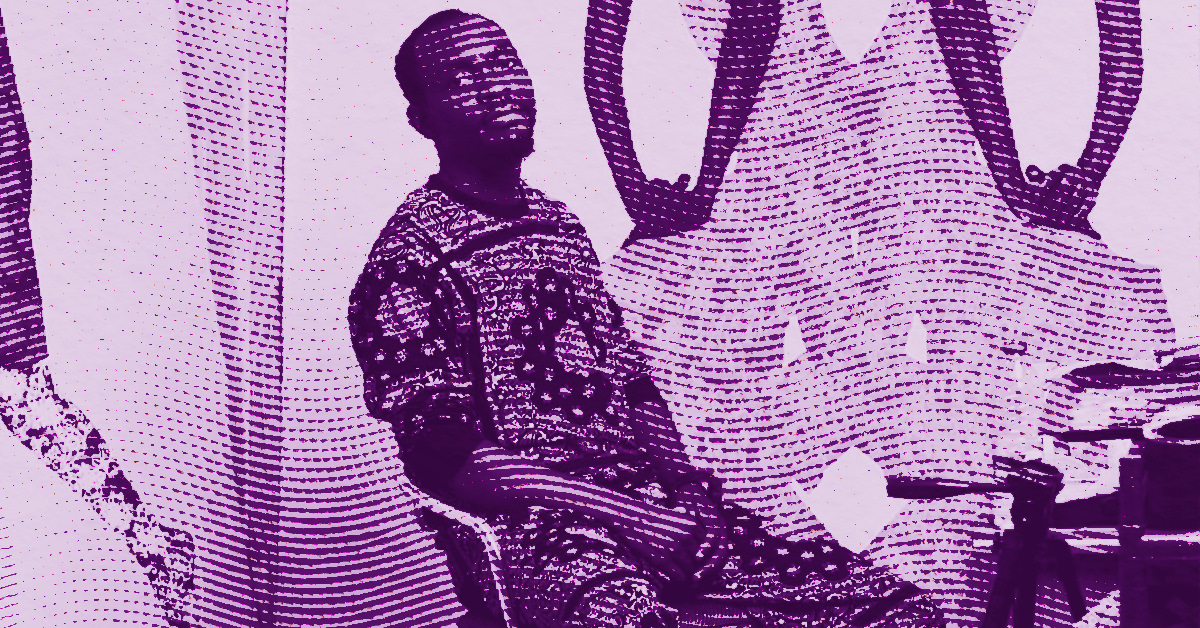Hört mir gut zu, ihr Snobs: Hier ist ein Künstler, der seit den Ateliers von Accra das schwarze Porträt mit einer Kühnheit neu erfindet, die euch für eure weichgespülten Sicherheiten beschämen sollte. Emmanuel Taku, geboren 1986 in Ghana, zeichnet auf seinen monumentalen Leinwänden eine Gegen-Geschichte der Darstellung, ein visuelles Manifest, das nicht um eure Erlaubnis bittet, um zu existieren. Ausgebildet am Ghanatta College of Art and Design zwischen 2005 und 2009, unterrichtete dieser Mann zunächst figuratives Zeichnen, bevor er erkannte, dass der Unterricht nicht ausreichen würde, um das auszudrücken, was er zu sagen hatte. Es brauchte eine neue Sprache, eine plastische Syntax, die die Verehrung schwarzer Körper tragen kann, ohne in die konventionellen Fallen der Erinnerung oder der illustrativen Aktivismus zu tappen.
Die Serie, die Taku auf die internationale Bühne brachte, trägt den Titel “Temple of Blackness – It Takes Two” und entstand während seines ersten Aufenthaltsstipendiums bei Noldor im Jahr 2020. Der Titel an sich ist bereits eine theoretische Geste: Während westliche Museen lange Zeit Tempel der Weiße errichteten, baut Taku seine eigenen Altäre. Seine Figuren, gehüllt in Stoffe mit siebgedruckten Blumenmustern, posieren gleichzeitig wie Models aus Modezeitschriften und klassische Statuen. Ihre weißen Augen, völlig ohne Pupillen, verwandeln sie in Halbgötter. Dieses formale Detail, das der Künstler als eine Referenz zum Film Man of Steel nennt, in dem Superman seine Kraft durch diese Augenmetamorphose zeigt, geht weit über die cineastische Hommage hinaus und berührt etwas Tieferes in den ghanaischen Kosmogonien.
Die Verbindung zum Autorenkino ist bei Taku kein Zufall. Als er den britisch-ghanaischen Filmemacher John Akomfrah über seine Erfahrungen als schwarzes Kind in englischen Museen sprechen hörte, die er als “Tempel der Weiße” [1] bezeichnete, fand Taku das grundlegende Konzept seiner Arbeit. Akomfrah, 1957 in Accra geboren und später nach Großbritannien ausgewandert, gründete 1982 das Black Audio Film Collective mit und entwickelte zeitlebens ein filmisches Werk, das postkoloniales Gedächtnis, diasporische Verschiebungen und Machtstrukturen in kulturellen Institutionen hinterfragt. Seine Multi-Screen-Video-Installationen wie Vertigo Sea oder Purple verweben historische Archive und zeitgenössische Bilder, um visuelle Essays über die schwarze Existenz und die Umweltkrise zu schaffen.
Für Taku wirkte die Formulierung von Akomfrah, die Museen als Tempel der Weiße, wie eine Offenbarung. Sie bündelte, was er diffus empfand: dass westliche kulturelle Räume historisch als Orte der Weihe einer bestimmten Weltanschauung, Ästhetik und Menschlichkeit funktionierten. Gegenüber diesen Tempeln errichtet Taku seine eigenen. Doch entgegen einer oberflächlichen Lesart handelt es sich nicht um eine einfache binäre Umkehrung. Takus Figuren ersetzen keine Hegemonie durch eine andere; sie schlagen eine andere Modalität der Präsenz in der Welt vor. Ihre Posen sind nicht triumphal im militärischen Sinne; sie bekräftigen eine ruhige Souveränität, eine Majestät, die sich nicht erobern muss, um sich zu behaupten.
Diese architektonische Dimension von Takus Projekt verdient besondere Aufmerksamkeit. Wenn er von “Tempel” spricht, begnügt sich der Künstler nicht mit einer Metapher: Er ruft eine ganze Denktradition über den heiligen Raum, die Schwelle zwischen Profanem und dem Göttlichen, die Funktion von Orten, an denen eine Transformation des Blicks stattfindet, hervor. Tempel sind in allen Kulturen Übergangsräume, in denen das Gewöhnliche auf das Außergewöhnliche trifft. Indem Taku seine Gemälde zu Fragmenten dieses metaphorischen Tempels macht, verwandelt er den Akt des Betrachtens in einen Akt der Andacht. Der Betrachter befindet sich nicht mehr in der Rolle des ästhetischen Richters, der ein Werk bewertet, sondern in der des Pilgers, der einen heiligen Raum betritt. Diese Umkehr der Machtverhältnisse in der Beziehung zwischen Werk und Publikum ist vielleicht der subversivste Aspekt von Takus Arbeit.
Der Film von Akomfrah und Takus Malerei teilen ebenfalls einen geschichteten Bildansatz. Bei Akomfrah erzeugen die Multiplen Bildschirme und die Überlagerung von Zeitlichkeiten eine visuelle Dichte, die einer linearen Lesart widersteht. Bei Taku erfolgt diese Schichtung durch die Anhäufung von Techniken: Acryl, Siebdruck, Zeitungscollagen, Textilien. Die floralen Stoffe, mit denen er seine Figuren kleidet, sind keine bloßen Ornamente; sie tragen eine Geschichte in sich, die seiner Schwester, einer Schneiderin, die Handelsbeziehungen zwischen Indien, Großbritannien und Afrika, die hybriden Identitäten, die sich in diesen Zirkulationen formen. Das Paisley-Motiv, das Taku besonders am Herzen liegt, verkörpert diese Komplexität: Ursprünglich aus Persien und Indien stammend, in Schottland popularisiert, von westlichen Gegenkulturbewegungen übernommen, trägt es in sich die Karte kultureller Aneignungen und Rückaneignungen.
Doch es gibt noch etwas anderes in Takus Werk, etwas Intimeres und Amerikanischeres in seiner Herkunft: den Einfluss der Positiven Denkweise und der Neuen Gedankenbewegung, wie sie sich in den 1920er Jahren entwickelte. Der Künstler zitiert gerne The Secret of the Ages, ein 1926 von Robert Collier veröffentlichtes Buch [2], das sein Leben verändert hat. Dieses Buch, das zu Lebzeiten seines Autors mehr als 300.000 Exemplare verkaufte, gehört zur literarischen Tradition der Persönlichkeitsentwicklung, die den Zugang zu unbegrenzter Macht durch die Kontrolle des Unterbewusstseins verspricht. Collier, Neffe des Gründers des Magazins Collier’s Weekly, entwickelt darin eine Psychologie des Überflusses, die auf Verlangen, Glauben und Visualisierung basiert.
Diese Referenz könnte überraschen. Was hat ein solches Werk, das oft wegen seines naiven Optimismus und seines rigorosen Individualismus kritisiert wird, in einer Arbeit zu suchen, die sich als kollektives Projekt der Würderestitution präsentiert? Die Antwort liegt gerade in der Art und Weise, wie Taku Colliers Vorschläge neu artikuliert. Während sich The Secret of the Ages an isolierte Individuen richtet, die persönlichen Erfolg suchen, überträgt Taku diese Prinzipien in einen gemeinschaftlichen und dekolonialen Kontext. Die Visualisierung wird zur Schaffung gegenhegemonialer Bilder; der Glaube an die eigenen Möglichkeiten verwandelt sich in die Bestärkung einer lange verleugneten schwarzen Schönheit und Stärke; die Macht des Unterbewusstseins wird zur Fähigkeit, sich jenseits der von der Kolonialgeschichte auferlegten Skripte neu zu erfinden.
Taku erklärt es selbst so: “Wenn Sie es sich vorstellen können, dann können Sie es auch erreichen” [3]. Dieser Satz, direkt inspiriert von Colliers Rhetorik, nimmt beim Künstler eine politische Dimension an, die er beim amerikanischen Autor nicht hatte. Schwarze Körper als göttliche Wesen zu denken, sie in Machtposen zu visualisieren, sie in prächtige Stoffe zu hüllen, bedeutet jene Transformation zu vollziehen, die Collier versprach: durch Gedanken Wirklichkeit werden zu lassen, was die Realität noch ablehnt. Das Buch von 1926 und die Gemälde von 2020 teilen die Überzeugung, dass Vorstellungskraft keine bloße Fantasie ist, sondern eine schöpferische Kraft, die die Realität umgestalten kann.
Es gibt jedoch einen Unterschied: Bei Collier bleibt die Verwandlung individuell und materiell; bei Taku ist sie kollektiv und symbolisch. Die Figuren des Künstlers sind nie allein. Sie treten paarweise, in Gruppen auf und bilden Konfigurationen, in denen sich die Körper verschlingen und aufeinander eingehen. Diese Betonung von Dualität und Vielheit hat ihre Quelle in einem ghanaischen Sprichwort, das Taku regelmäßig anführt: Ein einzelner Besenstiel bricht leicht, aber zusammengebunden sind Besen unzerbrechlich. Festigung, Synergie, Einheit: Das sind die Ziele dieser Kompositionen, in denen sich anthropomorphe Silhouetten ineinander auflösen und Hybride schaffen, bei denen man kaum noch erkennt, wo ein Körper beginnt und der andere endet.
Diese Ästhetik der Verschmelzung steht im Kontrast zum Hyperindividualismus der amerikanischen Neuen-Denk-Bewegung. Taku übernimmt das konzeptionelle Werkzeug, die Kraft des Denkens, das Schaffen durch Visualisierung, richtet es aber auf gemeinschaftliche Zwecke aus. Seine Tempel feiern keine einsamen Helden, sondern Kollektive, Solidaritäten und Allianzen. Damit vollzieht er eine kulturelle Übersetzung: persönlicher Erfolg wird kollektive Emanzipation. Diese Aneignung zeugt von bemerkenswerter strategischer Intelligenz. Anstatt die konzeptionellen Werkzeuge der dominanten amerikanischen Kultur pauschal abzulehnen, passt Taku sie seinen eigenen Zwecken an.
Die monumentalen Gemälde des Künstlers, einige bis zu 3 Meter breit, erzwingen physisch ihre Präsenz. Sie lassen sich nicht beiläufig betrachten; sie verlangen, vor ihnen zu stehen, die Augen zu diesen überlebensgroßen Figuren zu heben. Diese Monumentalität ist Teil der Umkehrungsstrategie: Wo schwarze Körper historisch verkleinert, objektiviert und fragmentiert wurden, vergrößert, verherrlicht und macht Taku sie unübersehbar. Der Siebdruck auf der Kleidung fügt eine ornamentale Dimension hinzu, die die oft mit “ernster” Kunst verbundene nüchterne Strenge ablehnt. Diese üppigen Blumenmotive, die gesättigten Farben, die Ablehnung formaler Askese: all das ist eine freudige, fast unverschämte Behauptung des Rechts auf Schönheit und Pracht.
Die Sammler haben das nicht übersehen. Im Jahr 2022, mit fast einer Million Euro versteigerter Werke, wurde Taku zum dritt-erfolgreichsten ghanaischen Künstler seiner Generation auf dem Weltmarkt. Ein während der Noldor-Residenz entstandenes Gemälde erreichte im März 2022 seinen persönlichen Rekord von 250.000 Euro. Diese Zahlen, die man in einer kritischen Analyse vielleicht als proletenhaft empfinden könnte, sagen dennoch etwas Wichtiges aus: Der Markt, trotz all seiner Mängel, erkennt hier die Kraft einer Arbeit, die keine Zugeständnisse macht. Taku hat seine Aussage nicht verwässert, um zu gefallen; im Gegenteil, er hat seine Positionen radikalisiert, und genau diese Unnachgiebigkeit zieht an.
Denn im Grunde genommen schlägt Taku einen Ausstieg aus dem mitfühlenden Repräsentationsregime vor, das lange Zeit die Art und Weise prägte, wie die westliche Kunst schwarze Themen behandelte. Seine Figuren rufen weder Mitleid noch wohlmeinende Solidarität oder moralische Empörung hervor. Sie brauchen eure Empathie nicht. Sie genügen sich selbst, souverän und unzugänglich in ihrer übernatürlichen Pracht. Diese Unzugänglichkeit, dargestellt durch die weißen blinden Augen, die euch nicht wirklich ansehen, bildet eine Ablehnung des üblichen skopischen Pakts. Ihr könnt sie betrachten, aber sie betrachten euch nicht zurück. Sie existieren in einer parallelen Sphäre, dem Tempel, den sie bewohnen, und ihr bleibt draußen, zugelassene aber nicht eingeladene Zuschauer.
Diese ästhetische Haltung ähnelt letztlich der von Akomfrah in seinen Installationen: Räume der Kontemplation zu schaffen, in denen der westliche Betrachter dezentrisch ist, wo sein Blick die Welt nicht mehr organisiert. In den dunklen Sälen, in denen sich Akomfrahs Videos entfalten, wie vor Takus Gemälden, erlebt man eine Andersartigkeit, die sich nicht reduziert, nicht erklärt, sondern einfach behauptet. Es ist diese ontologische Würde, diese volle und ganze Präsenz, die beide Künstler auf unterschiedliche Weise sichtbar machen wollen. Der Film von Akomfrah und die Malerei von Taku bilden so eine diasporische ghanaische Konstellation, einen Dialog über den Atlantik hinweg zwischen zwei Künstlergenerationen, die sich weigern, die ihnen zugewiesenen Plätze einzunehmen.
Hier geht es nicht darum, der hagiografischen Versuchung zu erliegen, die jede Kunstkritik in Bezug auf Fragen der Repräsentation und Gerechtigkeit bedroht. Takus Werk hat seine Grenzen, seine Schattenseiten. Man könnte die Dauerhaftigkeit der menschlichen Figur hinterfragen, während so viele zeitgenössische Künstler Abstraktion oder Installation erforschen. Man könnte auch die relative formale Gleichförmigkeit einer Produktion in Frage stellen, die Serie für Serie dieselben kompositorischen Entscheidungen wiederholt. Doch diese Vorbehalte wiegen wenig angesichts der offensichtlichen Notwendigkeit: Diese Bilder fehlten, und jetzt existieren sie. Sie besetzen Galerien in Brüssel, New York und Hongkong. Sie werden in Auktionssälen gehandelt. Sie gelangen in Museums-Sammlungen. Sie produzieren das, was Taku visualisiert hatte, in Übereinstimmung mit den Prinzipien von Collier: Sie verwandeln das Mögliche in Wirklichkeit.
Der Tempel, den Emmanuel Taku errichtet, ist kein statisches Denkmal; er ist eine permanente Baustelle, eine Architektur im Werden. Jedes neue Gemälde fügt dem Bauwerk einen Stein hinzu, erweitert den heiligen Raum, nimmt neue Figuren in den Pantheon auf. Und dabei verändert es unmerklich die Landschaft der zeitgenössischen Kunst, verschiebt die Linien, erschwert das Aufrechterhalten der alten Hierarchien ein wenig. Diese strategische Geduld, dieses Vertrauen in die kumulative Kraft der Bilder machen aus Taku keinen krachenden Ikonoklasten, sondern einen hartnäckigen Bauherrn. Er zerstört die Tempel der Weiße nicht; er errichtet geduldig, methodisch seine eigenen, in dem Wissen, dass deren bloße Existenz ausreicht, um die Hegemonie der ersten infrage zu stellen. Das ist vielleicht die wertvollste Lektion, die man aus diesem Werk ziehen kann: dass die Gegengeschichte weniger in der frontalen Konfrontation geschrieben wird als im geduldigen Aufbau visueller Alternativen, in der Hartnäckigkeit, das Existieren von dem zu erzwingen, was kein Bürgerrecht hatte. Und dass diese Existenz, einmal etabliert, irreversibel wird.
- John Akomfrah, Referenz, die Emmanuel Taku in seinem Gespräch mit Gideon Appah für die Noldor Residency 2020 erwähnt hat, bezüglich Museen als “temples of whiteness”.
- Robert Collier, The Secret of the Ages, Robert Collier Publications, 1926.
- Emmanuel Taku, Interview mit Fashion Week Daily, 2021.