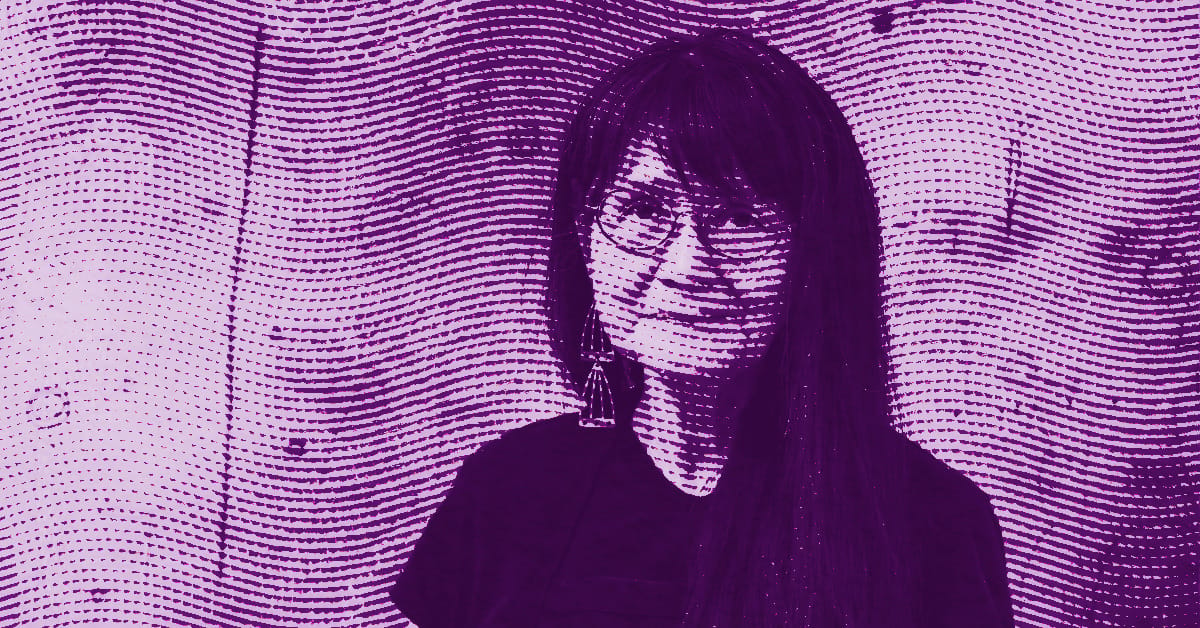Hört mir gut zu, ihr Snobs: Emmi Whitehorse malt wie ihre Vorfahren webten, mit jener sorgfältigen Geduld, die farbige Fäden in spirituelle Karten verwandelt. Seit über vierzig Jahren komponiert diese Frau, Mitglied der Navajo-Nation, visuelle Symphonien, in denen sich die Natur in ihrer intimsten Nacktheit offenbart, fernab der westlichen Bild-Konventionen, die noch immer definieren wollen, was zeitgenössische Kunst ist oder nicht ist.
Geboren 1956 in Crownpoint, New Mexico, gehört Whitehorse zu jener Künstlergeneration indigener Herkunft, die Identitätszuweisungen ablehnte, um ihre eigene bildnerische Sprache zu erfinden. Ihre Ausbildung an der Universität von New Mexico, wo sie zunächst einen Abschluss in Malerei und anschließend einen Master in Druckgrafik erwarb, konfrontierte sie von Anfang an mit jener fundamentalen Spannung zwischen kulturellem Erbe und künstlerischer Moderne. Anders als ihre Zeitgenossen, die sich für Denunziation oder polemische Aneignung entschieden, wählt Whitehorse den Weg der kontemplativen Versenkung.
Die Architektur der Vergänglichkeit
Whitehorses Werk entfaltet sich nach einer Logik, die unvermeidlich an die gotische Architektur in ihrer Auffassung vom sakralen Raum erinnert. Wie die Kathedralbauer, die versuchten, das unsichtbare Göttliche zu materialisieren, konstruiert die Navajo-Künstlerin ihre Kompositionen nach einer spirituellen Geometrie, in der jedes Element an einem kosmischen Gleichgewicht teilhat. Ihre Leinwände offenbaren diesen selben vertikalen Aufstieg, diese gleiche Suche nach Transzendenz, wie sie in den Gewölben von Chartres oder in den Rosetten von Notre-Dame zu finden ist. Doch wo die gotische Kunst sich zu einem christlichen Gott erhebt, steigt Whitehorse hinab in die tellurischen Tiefen ihres angestammten Landes.
Diese Verwandtschaft zur mittelalterlichen Sakralarchitektur ist nicht zufällig. Whitehorses Gemälde funktionieren als liturgische Räume, in denen der Betrachter zu einer Form ästhetischer Einkehr eingeladen wird. Ihre abstrakten Kompositionen, durchzogen von schwimmenden Zeichen und Symbolen, erinnern an illumine Manuskripte, in denen heiliger Text sich mit ornamentalen Marginalien vermischt. Jedes Werk wird zum zeitgenössischen Stundenbuch, einem visuellen Brevier, das das Chaos der Welt nach den Navajo-Kosmischen Rhythmen ordnet.
Die Künstlerin arbeitet mit sukzessiven Akkumulationen, indem sie die Farbschichten übereinanderlegt, wie Glasmeister ihre polychromen Glasfenster zusammensetzten. Diese Stratifikationstechnik schafft eine optische Tiefe, die an das gefilterte Licht großer sakraler Bauwerke erinnert. In ihren jüngsten Werken, ausgestellt auf der Biennale in Venedig 2024, insbesondere “Typography of Standing Ruins #3”, treibt Whitehorse diese architektonische Analogie bis zur konzeptuellen Grenze: ihre “stehenden Ruinen” suggerieren jene Überreste verlassener Kapellen, an denen die Natur sich zurückerobert, wo menschliche Kunst zu ihrem organischen Substrat zurückkehrt.
Aber Whitehorse begnügt sich nicht damit, die gotische Ästhetik zu imitieren. Sie unterläuft die theologische Logik, um eine autochthone Kosmogonie einzusetzen, in der die Horizontalität über der Vertikalität steht, in der Immanenz die Inkarnation verdrängt. Ihre “Kathedralen” sind Wiesen, ihre “Schiffe” Canyons, ihre “Gewölbe” die unendlichen Himmel des amerikanischen Südwestens. Diese paradigmenwechselnde Umkehrung ist eines der subversivsten Merkmale ihrer Arbeit: Sie demontiert stillschweigend die spirituelle Hegemonie des Westens, indem sie eine Spiritualität gegenüberstellt, die aus den vorkontinentalen Quellen der Menschheit schöpft.
Bei Whitehorse wird Architektur zur Metapher für kulturelles Gedächtnis. Wie jene gotischen Monumente, die die Spuren all ihrer aufeinanderfolgenden Umgestaltungen tragen, bewahren ihre Leinwände die geschichtete Erinnerung des Navajo-Landes. Jede farbliche Schicht entspricht einer geologischen Epoche, jedes Symbol einem historischen Ereignis, das in die Landschaft eingeschrieben ist. Dieses Schichtkonzept der Malerei macht Whitehorse zur Archäologin des Fühlens, zur Entdeckerin von Seelen, die verborgene Wahrheiten unter den Ablagerungen der Kolonisierung ausgräbt.
Das Licht spielt in ihren Werken die gleiche strukturierende Rolle wie in der gotischen Kunst: Es enthüllt, hierarchisiert, heiligt. Doch während das gotische Licht vom Himmel zur Erde herabsteigt, strahlt das Licht von Whitehorse aus den geologischen Tiefen, um ihre Kompositionen mit einem mineralischen Phosphoreszenzschein zu durchfluten. Diese Umkehrung der Lichtquelle spiegelt perfekt den Unterschied zwischen einer Spiritualität des Erhebens und einer Spiritualität der Verwurzelung wider.
Die Alchemie der amerikanischen Poesie
Wenn die gotische Architektur Whitehorse ihr räumliches Vokabular liefert, schöpft sie ihren zeitlichen Rhythmus aus der amerikanischen Poesie. Ihre Kompositionen erinnern unwiderstehlich an die Prosodie von Walt Whitman, diesen weitgespannten, rhythmischen Atem, der die weiten Ausdehnungen des amerikanischen Kontinents umfasst. Wie der Autor von “Blätter des Grases” praktiziert Whitehorse eine Ästhetik kosmischer Bestandsaufnahme, in der jedes natürliche Element seinen Platz in einer Gesamtsymphonie findet.
Diese poetische Abstammung geht über die einfache stilistische Analogie hinaus und berührt die philosophischen Grundlagen künstlerischer Schöpfung. Whitman revolutionierte die amerikanische Poesie, indem er die metrischen Formen Europas aufgab und einen freien Vers erfand, der den natürlichen Rhythmen von Sprache und Landschaft folgt. Ebenso befreit Whitehorse die indigene Malerei von den ästhetischen Kanons des westlichen Kunstverständnisses, um jene ursprüngliche Organik wiederzufinden, die Kunst zu einer Fortsetzung der Natur macht und nicht zu einer Nachahmung.
Der whitmansche Begriff des “kosmischen Ichs” findet bei Whitehorse seinen plastischen Ausdruck. Ihre abstrakten Selbstporträts der Serie “Self Surrender” offenbaren ein künstlerisches Subjekt, das sich in die umgebende Natur auflöst, um sich dort besser zu erneuern. Dieses Auflösen des individuellen Ichs im großen kosmischen Ganzen erinnert an Whitmans pantheistische Ekstasen, jene Momente, in denen sich der Dichter von universeller Energie “durchströmt” fühlt. Bei Whitehorse vollzieht sich diese Verschmelzung durch die Vermittlung der Farbe: ihre glühenden Gelbtöne, ihre abgründigen Blautöne und ihre tellurischen Rottöne wirken als Träger mystischer Gemeinschaft mit den elementaren Kräften.
Whitehorses Technik erinnert in ihrem prozesshaften und generativen Charakter an Whitmans Schreibweise. Wie Whitman, der seine “Blätter des Grases” immer wieder neu schrieb und erweiterte, arbeitet die Navajo-Künstlerin mit unendlichen Überarbeitungen und Variationen derselben organischen Motive. Ihre Samen, Pollen und Pflanzenfäden verwandeln sich von Leinwand zu Leinwand nach einer evolutiven Logik, die die natürlichen Zyklen von Wachstum und Regeneration nachahmt.
Diese Poetik der ständigen Variation verankert das Werk von Whitehorse in der großen Tradition der mündlichen indigenen Dichtung, bei der jede Rezitation den Mythos je nach den Umständen der Äußerung aktualisiert. Ihre Gemälde fungieren als visuelle Gedichte, die sich bei jedem Blick neu erfinden und bisher unbekannte Assoziationen je nach Geisteshaltung des Betrachters und den Lichtverhältnissen der Ausstellung offenbaren.
Der Einfluss der amerikanischen Poesie zeigt sich ebenfalls in Whitehorses Auffassung von Zeit. Wie bei Whitman oder Emily Dickinson ist die Zeit nicht linear, sondern zyklisch, geprägt von biologischen und kosmischen Rhythmen statt von der menschlichen Geschichte. Ihre jüngsten Werke der Serie “Sanctum”, während der Pandemie gemalt, offenbaren diese alternative Zeitlichkeit, in der soziale Isolation zur Gelegenheit wird, sich mit den grundlegenden Rhythmen des Daseins wiederzuverbinden [1].
Diese poetische Auffassung von Zeit erklärt, warum Whitehorse ihren Gemälden jede endgültige Orientierung verweigert und sie während des kreativen Prozesses ständig dreht. Diese permanente Rotation ahmt die saisonalen und täglichen Zyklen nach, die die zeitliche Erfahrung der Indigenen strukturieren. Jede Position der Leinwand offenbart eine andere Facette der dargestellten Realität, ähnlich wie Dickinsons Gedichte, deren Bedeutungen sich je nach Betonung bestimmter Verse verändern.
Die Offenbarung des Mikrokosmos
“Meine Gemälde erzählen die Geschichte davon, die Erde in der Zeit zu kennen, an einem Ort ganz und gar, mikrokosmisch zu sein” [2], vertraut Whitehorse in einem ihrer seltenen Interviews an. Diese Formel fasst das Wesen ihres künstlerischen Ansatzes zusammen: die Unendlichkeit des Kleinen zu offenbaren, die unsichtbare Vermehrung des elementaren Lebens zu zeigen, die jeden Quadratmeter des Territoriums belebt. Ihre Kompositionen fungieren wie poetische Mikroskope, die das Unmerkliche vergrößern und zu einer visuellen Epiphanie werden lassen.
Diese Ästhetik des Mikrokosmos wurzelt in der Kindheit der Künstlerin, die mit dem Hüten von Schafen in den kargen Weiten von New Mexico verbracht wurde. Diese frühe Einsamkeit schärfte ihre Wahrnehmung für feine Lichtvariationen, feine Bewegungen der Vegetation und all jene zarten Phänomene, die sonst dem menschlichen Auge entgehen. Ihre Werke übersetzen diese sensorische Hypersensibilität in eine plastische Sprache von äußerster Subtilität, bei der jede Farbnuance einer besonderen Empfindung entspricht.
Whitehorses Arbeit offenbart ein intimes Wissen über die Ökosysteme des amerikanischen Südwestens, das weit über die oberflächliche Beobachtung eines Touristen oder sogar eines Ranchbesitzers hinausgeht. Ihre Bezüge zu endemischen Pflanzen wie “Ice Plant XIV”, “Needle and Thread Grass III” und “Prickly Green II” zeugen von einer fast wissenschaftlichen Vertrautheit mit der lokalen Flora. Diese botanische Präzision wird jedoch von einer spirituellen Dimension begleitet, die jede Pflanzenart zu einem Akteur des kosmischen Dramas der Navajo macht.
Die Philosophie des hózhó, zentral in der Kosmologie der Navajo, findet in Whitehorses Kunst ihre plastischste Umsetzung. Dieses Konzept, das in unserer Sprache unübersetzbar ist, bezeichnet die dynamische Harmonie, die alle Lebewesen in einem Netzwerk feiner gegenseitiger Abhängigkeiten verbindet. Whitehorse materialisiert diese ganzheitliche Sicht durch ihre Technik der Überlagerung: Ihre verschiedenen Bildebenen interagieren nach einer ökosystemischen Logik, in der jedes Element alle anderen beeinflusst und verändert.
Dieser systemische Ansatz der Malerei macht Whitehorse zu einer Pionierin der zeitgenössischen ökologischen Kunst. Schon lange bevor die Klimakrise die Kunstwelt für Umweltfragen sensibilisierte, entwickelte sie eine plastische Sprache, die die Vernetzung aller natürlichen Phänomene sichtbar macht. Ihre Werke fungieren als Modelle der Biosphäre, als malerische Ökosysteme, in denen neue Beziehungen zwischen Mensch und Umwelt erprobt werden.
Diese ökologische Dimension erfährt im aktuellen Kontext des sechsten Massenaussterbens eine besondere Resonanz. Die fragilen Gleichgewichte, die Whitehorses Gemälde offenbaren, erinnern uns an die Prekarität unserer natürlichen Welt und die Dringlichkeit, neue Formen des Zusammenlebens mit anderen Arten zu erfinden. Ihre Kunst wird so zu einem stillen Plädoyer für die Anerkennung der inhärenten Würde des Lebendigen, jenseits seines Nutzens für die menschliche Spezies.
Auf dem Weg zu einer kritischen Synthese
Das Werk von Emmi Whitehorse widersteht vorschnellen Kategorisierungen, die sie in das Ghetto der “indigenen Kunst” einsperren oder der vorherrschenden Strömung der zeitgenössischen Abstraktion zuordnen wollen. Ihre Einzigartigkeit besteht gerade in dieser Synthesefähigkeit, die verschiedenste plastische Traditionen in einen Dialog bringt, ohne sie jemals zu hierarchisieren oder gegeneinander auszuspielen. Sie zeigt am Beispiel, dass es möglich ist, radikal modern zu sein, ohne seine kulturellen Wurzeln zu verleugnen, innovativ zu sein ohne Ikonoklasmus.
Diese Balanceposition macht Whitehorse zu einer emblematischen Figur der künstlerischen Postmoderne, verstanden nicht als ein bestimmter ästhetischer Stil, sondern als kritische Haltung, die die großen vereinheitlichenden Erzählungen der westlichen Moderne ablehnt. Ihre Kunst bietet eine Alternative zum abstrakten Universalismus der New Yorker Schule, indem sie einen konkreten Partikularismus entgegenstellt, der interkulturelle Kommunikation nicht ausschließt.
Die internationale Anerkennung, die Whitehorse heute genießt, ihre Einbeziehung in die Biennale von Venedig 2024 und ihre Ausstellungen in den größten amerikanischen Museen, zeugen von dieser Entwicklung des zeitgenössischen Geschmacks hin zu inklusiveren und weniger eurozentrierten Ästhetiken. Aber diese institutionelle Weihe darf nicht über die subversive Dimension ihres Werks hinwegtäuschen, über ihre stille Infragestellung der etablierten kulturellen Hierarchien.
Denn die Kunst von Whitehorse vollzieht eine kopernikanische Revolution in unserer Beziehung zur Landschaft und zur Natur. Wo die westliche malerische Tradition ihre anthropozentrische Perspektive aufdrängt, setzt sie eine ökologische Sichtweise ein, die den Menschen von seiner dominanten Position verdrängt und ihn wieder in die Gemeinschaft des Lebendigen eingliedert. Diese ontologische Dezentrierung ist vielleicht der wertvollste Beitrag ihres Werks zur zeitgenössischen Kunst: uns zu lehren, die Welt anders zu sehen als durch das Prisma unserer narzisstischen Projektionen.
Das Erbe von Whitehorse bemisst sich weniger an dem stilistischen Einfluss, den sie auf die junge Generation ausüben könnte, als an ihrer Fähigkeit, neue Territorien ästhetischer Erfahrung zu eröffnen. Indem sie die Schönheit des Unendlich Kleinen offenbart, den spirituellen Intuitionen ihrer Herkunftskultur eine plastische Gestalt gibt und eine abstrakte Sprache erfindet, die das Unsichtbare ausdrückt, bereichert sie unser Wahrnehmungsvokabular und macht uns empfänglicher für die Feinheiten der natürlichen Welt.
Diese Erziehung des Blicks ist eine wichtige politische Herausforderung in einer Zeit, in der die Menschheit ihre Beziehung zur Biosphäre neu erfinden muss. Die Kunst von Whitehorse bereitet uns auf diesen notwendigen Wandel vor, indem sie jene schwebende Aufmerksamkeit kultiviert, jene kontemplative Bereitschaft, die es ermöglicht, das Leben in all seinen Formen zu erfassen. Sie erinnert uns daran, dass Kunst nicht nur ästhetische Unterhaltung, sondern ein Instrument der Erkenntnis und der geistigen Erneuerung ist.
In einer von spektakulären Bildern und künstlichen Emotionen übersättigten Welt bieten die Gemälde von Whitehorse einen Zufluchtsort der Stille und Authentizität. Sie laden uns ein, jene wahrnehmende Langsamkeit, jene meditative Geduld wiederzufinden, die den Zugang zu den wesentlichen Wahrheiten ermöglicht. Sie lehren uns, dass wahre Kunst sich nicht damit begnügt, die Realität darzustellen, sondern sie in ihrer heiligen Dimension offenbart und uns mit dem grundlegenden Geheimnis der Existenz versöhnt.
Das Werk von Emmi Whitehorse ist ein wertvolles Gegenmittel gegen die Entweihung der zeitgenössischen Welt. Indem sie der Natur ihre heilige Dimension zurückgibt und die verborgene Poesie der bescheidensten Phänomene offenbart, hilft sie uns, unsere Beziehung zur Wirklichkeit wieder zu verzaubern. Ihre Kunst erinnert uns daran, dass wir nicht nur Konsumenten von Bildern sind, sondern Teilnehmende am großen kosmischen Dialog, der alle Wesen in einer gemeinsamen Schicksalsgemeinschaft vereint. Diese Lektion der Weisheit, vermittelt von einer Frau, die die uralten Intuitionen ihres Volkes bewahren und zugleich in der Sprache der zeitgenössischen Kunst aktualisieren konnte, klingt wie eine Botschaft der Hoffnung in unserer bewegten Zeit.
- Michael Abatemarco, “Depth of Field: Artist Emmi Whitehorse”, The Santa Fe New Mexican, 8. Januar 2021
- Elisa Carollo, “Navajo Artist Emmi Whitehorse’s Symbolic Landscapes Offer a Path to Reconnection With Nature”, Observer, Oktober 2024