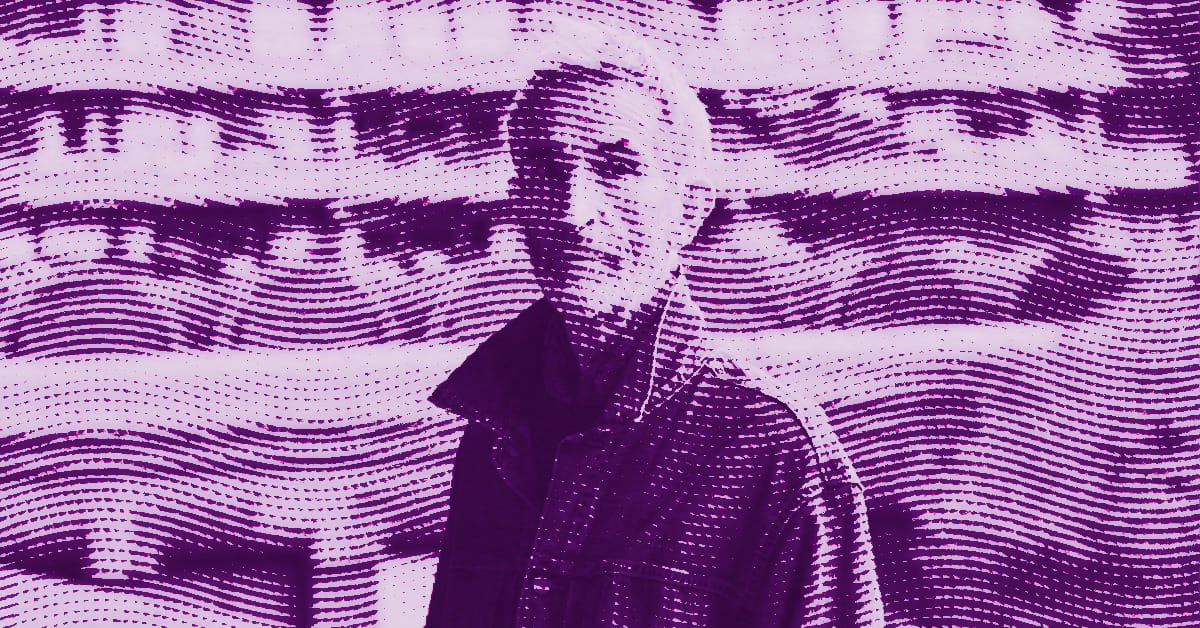Hört mir gut zu, ihr Snobs: Francis Alÿs verlangt von uns nicht, seine Werke zu verstehen, sondern sie zu durchschreiten. In einer Welt, die voller spektakulärer Bilder und donnernder künstlerischer Gesten ist, entwickelt dieser Belgier, der seit 1986 in Mexiko lebt, eine künstlerische Praxis, die auf der Einfachheit der Geste und der Komplexität ihrer Resonanzen beruht. Weder Maler im traditionellen Sinne, noch Performer im theatralischen Sinne, besetzt Alÿs ein einzigartiges künstlerisches Terrain, in dem der Akt des Gehens zum Instrument poetischen Widerstands gegen zeitgenössische urbane Logiken wird.
Das Werk von Francis Alÿs entfaltet sich im Zwischenraum von Kunst und Anthropologie, zwischen minimaler Geste und maximaler politischer Ladung. Seit seinen ersten Spaziergängen durch die Straßen von Mexiko-Stadt Anfang der 1990er Jahre entwickelt der Künstler eine Praxis, die die Arten der Nutzung des urbanen Raums hinterfragt. Seine Aktionen, von Video dokumentiert und durch Malerei verlängert, bilden ein kohärentes Corpus von Untersuchungen zu den zeitgenössischen geopolitischen Spannungen.
Francis Alÿs wurde 1959 in Antwerpen geboren und kam als Architekt nach Mexiko, beauftragt, an den Nachbebenprojekten des Erdbebens von 1985 mitzuwirken. Diese architektonische Ausbildung bleibt fundamental für seinen künstlerischen Ansatz: Er vergisst nie, dass der urbane Raum in erster Linie ein soziales Konstrukt ist, ein Gefüge von Zwängen und Möglichkeiten, die die Formen des kollektiven Daseins bestimmen. Sein Übergang zur Kunst um 1989 ist weniger ein Bruch als eine Radikalisierung dieses Interesses am Raum als Offenbarung sozialer Machtverhältnisse.
Das Gehen als Raumzeichnung
Das Werk von Francis Alÿs findet seine tiefste theoretische Resonanz in den Gedanken von Michel de Certeau, besonders in dessen Analyse des Gehens als Praxis des Raums, entwickelt in “L’invention du quotidien”. Für Certeau ist der Akt des Gehens eine Form räumlicher Äußerung, die den Überwachungs- und Kontrollsystemen der Städte entgeht[1]. Diese Perspektive verändert unser Verständnis von Alÿs’ Spaziergängen grundlegend: Sie sind kein bloßes ästhetisches Üben, sondern eine echte Politik des Raums.
In “The Collector” (1991-1992) zieht Alÿs einen magnetischen Stoffhund durch die Straßen von Mexiko, um metallische Überreste aufzusammeln, die auf dem Asphalt verstreut liegen. Diese scheinbar spielerische Aktion offenbart durch die allmähliche Anhäufung der metallischen Rückstände den Zustand des Verfalls der mexikanischen urbanen Infrastruktur. Die minimale Geste von Alÿs verwandelt das Gehen in ein Instrument sozialer Untersuchung und zeigt auf, was die offiziellen Stadtentwicklungspläne zu verbergen suchen.
Diese kritische Dimension des Gehens findet ihren vollendetsten Ausdruck in “Paradox of Praxis I (Sometimes Making Something Leads to Nothing)” (1997), wo Alÿs einen Eisblock neun Stunden lang durch die Straßen von Mexico City schiebt, bis er vollständig geschmolzen ist. Die Aktion hinterfragt direkt die Konzepte von Produktivität und Effizienz, die die neoliberale Wirtschaft strukturieren. Indem er einen erheblichen Aufwand für ein null Ergebnis investiert, aktualisiert Alÿs Michel de Certeaus Überlegungen zu den Taktiken des täglichen Widerstands: Es geht darum, durch die Logik des Absurden die von der rationalen Organisation des urbanen Raums auferlegten Rhythmen und Ziele zu stören.
Alÿs’ Spaziergänge ordnen sich in diese theoretische Tradition ein, die von Baudelaire über Certeau bis zu den Situationisten das urbane Gehen als kritische Praxis betrachtet. Aber Alÿs radikalisiert diesen Ansatz, indem er seine Bewegungen in dokumentierte künstlerische Ereignisse verwandelt. Seine Wege sind nicht mehr Teil der subjektiven Erfahrung des Flaneurs, sondern Konstruktionen künstlerischer Objekte, die die zeitgenössischen Modalitäten der Zirkulation und Kontrolle im metropolitanen Raum hinterfragen.
Dieser Ansatz findet eine besondere Resonanz im mexikanischen Kontext, wo die schnelle Urbanisierung und die Informalität zahlreicher Viertel Reibungsflächen zwischen offizieller Planung und populären Nutzungen schaffen. Alÿs entwickelt eine Poetik dieser Zwischenräume und zeigt auf, wie die Bewohner täglich Besetzungsmodi erfinden, die den dominanten Logiken der Raumordnung entgehen.
Die kritische Wirksamkeit von Alÿs’ Aktionen liegt in ihrer Fähigkeit, durch minimale Umleitungen alltäglicher Gesten die unsichtbaren Strukturen, die die urbane Erfahrung organisieren, offenzulegen. Indem er anders geht, an Orten anhält, an denen man normalerweise nicht hält, und sammelt, was gewöhnlich vernachlässigt wird, aktualisiert der Künstler die aufdeckende Funktion der Kunst, die Certeau den alltäglichen Praktiken des Widerstands zuschrieb.
Die videografische Dokumentation dieser Aktionen ist kein bloßer Mitschnitt, sondern Teil ihrer kritischen Wirksamkeit. Indem Alÿs das Flüchtige ins Archiv überführt und das Unreproduzierbare reproduzierbar macht, hinterfragt er auch die zeitgenössischen Modalitäten der Zirkulation und Validierung von Kunst. Seine Videos wirken wie Viren, die sich in internationalen Kunstkreisen verbreiten und andere urbane Kontexte mit ihren Fragestellungen anstecken.
Diese politische Dimension des Gehens findet ihre Fortsetzung in Alÿs’ geopolitischen Projekten, insbesondere in “The Green Line” (2004), wo der Künstler zu Fuß der Waffenstillstandslinie von 1948 in Jerusalem folgt und grüne Farbe vergießt. Die Aktion zeigt die Willkür jeder Grenze auf und aktualisiert zugleich die durch diplomatische Abkommen zu naturalisierenden Teilungen durch die bloße physische Präsenz des Wanderers.
Diese Politik des Umherstreifens findet ihre theoretische Grundlage in der von Certeau vorgeschlagenen Analyse der alltäglichen “Künste des Handelns”. Für den französischen Theoretiker sind diese gewöhnlichen Praktiken Formen mikropolitischen Widerstands, die die dominanten Strukturen zwar nicht umstoßen, aber genug stören, um Freiräume zu schaffen. Alÿs radikalisiert diese Analyse, indem er diese Störungen in künstlerische Ereignisse verwandelt, die die politische Dimension scheinbar beiläufiger Gesten offenbaren.
Der Austausch des Sensiblen und die Umverteilung der Rollen
Die künstlerische Praxis von Francis Alÿs erhält in den theoretischen Überlegungen von Jacques Rancière zum “teilen des Sinnlichen” und zur politischen Funktion der Kunst eine zweite wesentliche Beleuchtung. Für Rancière besteht politische Kunst nicht darin, politische Botschaften zu vermitteln, sondern die Verteilungen zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen Sagbarem und Unsagbarem, die die soziale Ordnung strukturieren, neu zu verteilen [2]. Diese Perspektive erlaubt es, die eigentliche politische Dimension der Eingriffe von Alÿs zu erfassen, die niemals Propaganda sind, sondern eine Umverteilung der Wahrnehmungen.
In “When Faith Moves Mountains” (2002) organisiert Alÿs die kollektive Verschiebung einer Sanddüne in Lima, Peru, indem er fünfhundert Freiwillige mit Schaufeln mobilisiert. Die Handlung, aus geologischer Sicht offensichtlich ineffizient, verteilt die üblichen sozialen Rollen radikal neu. Bewohner der Slums von Ventanilla, die normalerweise im öffentlichen peruanischen Raum unsichtbar sind, werden zu Protagonisten eines internationalen Kunstevents. Diese Umverteilung der Rollen stellt das eigentliche politische Ziel der Aktion dar: Sie macht eine normalerweise an den Rand der Repräsentation gedrängte Bevölkerung sichtbar.
Diese politische Dimension ergibt sich nicht aus dem expliziten Inhalt des Werks, sondern aus seiner eigentlichen Form. Indem Alÿs eine kollektive Aktion um ein scheinbar absurder Ziel organisiert, setzt er vorübergehend die Logiken von Rentabilität und Effizienz außer Kraft, die normalerweise die soziale Organisation bestimmen. Diese Aussetzung eröffnet einen Möglichkeitsraum, in dem andere Formen des Zusammenlebens entstehen können, wenn auch nur vorübergehend.
Rancière betont, dass politische Kunst nicht darin besteht, das Politische darzustellen, sondern die Bedingungen der Repräsentation selbst neu zu konfigurieren. Die Aktionen von Alÿs folgen genau dieser Logik: Sie prangern die sozialen Ungleichheiten nicht explizit an, sondern schaffen Situationen, in denen diese Ungleichheiten anders wahrnehmbar werden. In “The Green Line” bezieht der Künstler keine Stellung im israelisch-palästinensischen Konflikt, sondern macht zugleich die Willkürlichkeit jeder Grenze und ihre zwingende Realität spürbar.
Dieser Ansatz findet im lateinamerikanischen Kontext eine besondere Resonanz, wo die Beziehungen zwischen Kunst und Politik lange als explizites Engagement gedacht wurden. Alÿs entwickelt eine Alternative zu dieser Tradition, indem er die indirekten Modalitäten erforscht, durch die Kunst im öffentlichen Raum intervenieren kann. Seine Aktionen eintreten nicht für eine bestimmte Sache, sondern schaffen Situationen, in denen die Zuschauer ihre gewohnten Wahrnehmungen des sozialen Raums überdenken.
Die Serie “Children’s Games” (1999-heute) illustriert beispielhaft diese Politik der Wahrnehmungsverteilung. Indem Alÿs Kinderspiele in geopolitisch angespannten Kontexten (Afghanistan, Irak, Ukraine) dokumentiert, verfällt er nie in Mitleid, sondern zeigt das Fortbestehen von Lebensformen auf, die den Logiken des Krieges entgehen. Dieses Fortbestehen ist keine Botschaft der Hoffnung, sondern eine grundlegende anthropologische Tatsache: Trotz der dramatischsten Kontexte organisiert die spielerische Erfindung weiterhin die kindliche Erfahrung.
Diese anthropologische Dimension von Alÿs’ Werken berührt Rancières Anliegen bezüglich der Fähigkeit der Kunst, Lebensformen zu offenbaren, die von den dominanten Diskursen ignoriert werden. Indem der Künstler diese Kinderspiele dokumentiert, produziert er kein Zeugnis über den Krieg, sondern zeigt die Koexistenz unterschiedlicher Zeitlichkeiten innerhalb desselben sozialen Raums. Diese Koexistenz stört die eindimensionalen Darstellungen der geopolitischen Gewalt, indem sie die unauflösbare Komplexität der Realität offenbart.
Die politische Wirksamkeit dieser Dokumentationen beruht auf ihrer Fähigkeit, unsere gewohnten Wahrnehmungskategorien auszusetzen. Angesichts der Bilder von Kindern, die in den Trümmern von Mossul spielen, kann der Betrachter keine einheitliche Vorstellung von Krieg mehr aufrechterhalten. Diese Aussetzung der Wahrheitsgewissheiten stellt laut Rancière die spezifisch politische Funktion der Kunst dar: nicht zu überzeugen, sondern zu verwirren, nicht zu lehren, sondern zu desorientieren.
Die Gemälde von Alÿs folgen dieser gleichen Logik der Wahrnehmungsverteilung. Seine kleinen Leinwände, die oft nachts entstehen, funktionieren wie poetische Zusammenfassungen seiner Aktionen. Sie sind keine Illustrationen seiner Performances, sondern eigenständige Objekte, die andere Formen der Beziehung zu Raum und Zeit erkunden. Durch ihren reduzierten Maßstab und ihre zarte Ausführung stehen sie im Kontrast zur geografischen Weite der begleitenden Aktionen und schaffen ein Größenverhältnisspiel, das unsere Wahrnehmungsgewohnheiten stört.
Dieser multimodale Ansatz ermöglicht es Alÿs, verschiedene Formen ästhetischen Widerstands zu erforschen. Seine Aktionen hinterfragen die Nutzung öffentlicher Räume, seine Gemälde offenbaren alternative Zeitlichkeiten, seine Videos hinterfragen die Umlaufmodalitäten der zeitgenössischen Kunst. Diese Vervielfältigung der Medien ist kein Opportunismus, sondern eine kohärente Strategie für Interventionen in unterschiedlichen Regimen der Sensibilität.
Die kritische Kraft von Alÿs Werk liegt letztlich in seiner Fähigkeit, die Falle der Didaktik zu vermeiden, ohne in Ästhetismus zu verfallen. Seine Interventionen senden keine expliziten Botschaften aus, sondern schaffen Situationen, in denen die gewohnte Ordnung der Wahrnehmungen vorübergehend aufgehoben wird. Diese Aussetzung eröffnet Möglichkeiten für Wahrnehmungsneukonfigurationen, die die eigentliche politische Herausforderung seiner Arbeit darstellen.
Kunst als Laboratorium für Alternativen
Das Werk von Francis Alÿs stellt grundlegend die zeitgenössischen Formen des Widerstands gegen die neoliberale Rationalisierung des Daseins in Frage. Angesichts der zunehmenden Kommerzialisierung des urbanen Raums und der Beschleunigung sozialer Rhythmen entwickelt der Künstler eine Praxis der Langsamkeit und scheinbaren Ineffizienz, die eine Form passiven Widerstands gegen die dominanten Produktivitätslogiken darstellt.
Dieser Widerstand beruht nicht auf Nostalgie, sondern auf der Erfindung alternativer Formen kollektiven Daseins. Die Aktionen von Alÿs fungieren als Labore, in denen andere Beziehungen zu Zeit, Raum und Effizienz erprobt werden. In “Rehearsal I” (1999-2001) versucht unermüdlich ein roter Volkswagen, eine Steigung in Tijuana zu erklimmen, scheitert systematisch und beginnt immer wieder von vorne. Diese obsessive Wiederholung hinterfragt die Fortschrittsmythologien, die die Vorstellung von Modernisierung in Lateinamerika strukturieren.
Die kritische Wirksamkeit dieses Werks liegt in seiner Fähigkeit, die sisyphische Dimension vieler wirtschaftlicher Entwicklungsprojekte offenzulegen. Indem er das Scheitern in ein ästhetisches Spektakel verwandelt, verfällt Alÿs nicht in Zynismus, sondern zeigt die tragische und komische Dimension bestimmter kollektiver Hoffnungen auf. Diese Offenbarung führt nicht zu einer moralischen Belehrung, sondern zu einer Aussetzung von Gewissheiten, die es erlaubt, die Herausforderungen der Entwicklung anders zu betrachten.
Alÿs jüngste Projekte in Afghanistan und im Irak zeigen eine bedeutende Entwicklung seiner Praxis hin zu zunehmend dramatischen Kontexten. Diese Entwicklung ist nicht auf Sensationslust zurückzuführen, sondern auf eine Radikalisierung seiner Fragestellungen bezüglich der Formen des Zusammenlebens in Konflikträumen. In “Reel-Unreel” (2011) laufen zwei afghanische Kinder durch die Straßen von Kabul und rollen abwechselnd einen Filmstreifen auf und ab. Diese einfache Handlung offenbart das Fortbestehen von Spiel- und Erfindungsformen in einem Zustand permanenten Krieges.
Diese Dokumentationen werfen komplexe Fragen zu den ethischen Modalitäten der Darstellung von Krieg auf. Alÿs vermeidet systematisch das Mitleid erzeugende Elend, indem er sich auf die Formen des täglichen Widerstands konzentriert, die die Zivilbevölkerung entwickelt. Dieser Ansatz entspricht den Überlegungen von Susan Sontag zur Kriegsfotografie: Es geht weniger darum, das Leiden zu dokumentieren, sondern vielmehr die Lebensformen zu zeigen, die trotz der Gewalt fortbestehen.
Die Originalität von Alÿs liegt in seiner Fähigkeit, die Fallen des humanitären Voyeurismus zu vermeiden, ohne in die Ästhetisierung der Gewalt zu verfallen. Seine Dokumentationen zeigen, wie Kunst in Konfliktkontexten intervenieren kann, ohne deren Lösung zu beanspruchen. Diese Bescheidenheit bildet paradoxerweise die politische Stärke seiner Arbeit: Indem er auf große Erklärungen verzichtet, eröffnet er nuanciertere Reflexionsräume zu den zeitgenössischen geopolitischen Herausforderungen.
Die internationale Dimension von Alÿs’ Karriere wirft auch Fragen zu den Modalitäten der Zirkulation kritischer Kunst in institutionellen Kreisen auf. Seine Werke, ausgestellt in den renommiertesten westlichen Kunstinstitutionen, hinterfragen das Verhältnis zwischen ästhetischem Widerstand und marktwirtschaftlicher Integration. Diese Spannung widerlegt nicht die kritische Tragweite seiner Arbeit, sondern offenbart die strukturellen Widersprüche der zeitgenössischen Kunst.
Die Wirksamkeit von Alÿs’ Werken beruht letztlich auf ihrer Fähigkeit, Reflexionssituationen zu schaffen, statt kulturelle Konsumgüter zu sein. Seine Aktionen funktionieren als Katalysatoren, die latente Spannungen im sozialen Raum aufdecken, ohne deren Lösung zu beanspruchen. Diese aufdeckende Funktion ist der spezifische Beitrag der Kunst zu den zeitgenössischen politischen Debatten: nicht Lösungen zu bieten, sondern die Problemstellung zu verkomplizieren.
Das Werk von Francis Alÿs lädt uns damit ein, die zeitgenössischen Modalitäten sozialer Kritik neu zu überdenken. Angesichts spektakulärer Formen politischer Proteste entwickelt er eine Ästhetik der Zurückhaltung, die die politische Dimension scheinbar unbedeutender Gesten offenbart. Diese Offenbarung führt nicht zu Aktionsprogrammen, sondern zu einer Sensibilisierung für die mikropolitischen Herausforderungen, die den täglichen Alltag strukturieren.
Die Stärke dieses Ansatzes liegt in seiner Fähigkeit, die Falle des Moralismus zu vermeiden, ohne in ästhetische Gleichgültigkeit zu verfallen. Alÿs’ Interventionen schaffen Situationen, in denen das Publikum angeregt wird, seine gewohnten Beziehungen zu Raum, Zeit und Wirksamkeit zu überdenken. Diese Neubewertung ist eine notwendige Voraussetzung für jede echte politische Transformation: Sie offenbart die Kontingenz unserer wahrgenommenen Selbstverständlichkeiten und eröffnet Möglichkeiten alternativer Organisation kollektiver Erfahrung.
Die Kunst von Francis Alÿs lehrt uns letztlich, dass politischer Widerstand verschlungene Wege nehmen kann, dass kritische Wirksamkeit sich nicht unbedingt am Ausmaß der erzeugten Veränderungen messen lässt, sondern an der Qualität der angeregten Fragestellungen. In einer Welt, in der spektakuläre Formen des Protests oft von den Logiken vereinnahmt werden, die sie zu bekämpfen vorgeben, erforscht Alÿs die politischen Potenziale von Bescheidenheit, Langsamkeit und scheinbarer Unwirksamkeit. Diese Erforschung ist ein wertvoller Beitrag zu den zeitgenössischen Überlegungen über die Modalitäten sozialer Kritik und die politischen Funktionen der Kunst.
- Michel de Certeau, L’invention du quotidien. 1. Arts de faire, Paris, Gallimard, 1990.
- Jacques Rancière, Le partage du sensible. Esthétique et politique, Paris, La Fabrique, 2000.