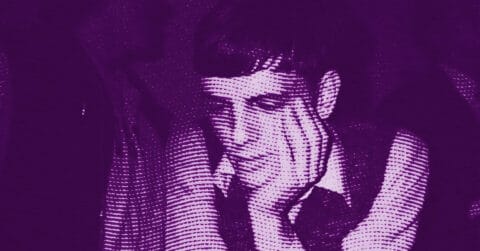Hört mir gut zu, ihr Snobs. George Morton-Clark, geboren 1982 in Tooting im Süden Londons, verkörpert genau das, was die britische zeitgenössische Kunst am destabilisierensten hervorzubringen vermag, wenn sie sich von akademischen Konventionen löst. Seine riesigen, unbearbeiteten Leinwände, bevölkert von vertrauten Zeichentrickfiguren, sind eine künstlerische Provokation, der man Aufmerksamkeit schenken sollte, wenn auch nur um zu verstehen, wie sich dieser ehemalige Student der Animation am Surrey Institute of Art and Design als einer der eigenwilligsten Künstler seiner Generation durchgesetzt hat. Wenn Sie denken, seine Werke seien nur überdimensionale Kritzeleien eines Kindes, täuschen Sie sich. Morton-Clark spielt mit unseren kollektiven Erinnerungen mit einer Virtuosität, die jeden jungianischen Psychoanalytiker vor Neid erblassen ließe.
Im Mittelpunkt seiner Arbeit steht eine faszinierende Dichotomie zwischen der tröstlichen Vertrautheit der Cartoon-Figuren und ihrer expressionistischen Verformung. Mickey Mouse, Donald Duck oder Bart Simpson treten auf seinen Leinwänden wie Gespenster unserer kollektiven Kindheit auf, aber sie werden systematisch einem Dekonstruktionsprozess unterzogen, der sie in beunruhigende Kreaturen verwandelt. Das erinnert unwillkürlich an Walter Benjamin und sein Essay “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit”: die Spannung zwischen Original und Abbild, zwischen Authentischem und Simulakrum. Morton-Clark führt diese Überlegung weiter, indem er Werke schafft, die gleichzeitig vertraut und fremd sind, als hätten diese Pop-Ikonen einen Ausdruck eines expressionistischen Alptraums erfahren.
Der Künstler verwendet Öl, Acryl und Kohle auf rohen, unbehandelten Leinwänden und schafft Kompositionen, in denen die Spontaneität der Geste neben einer unbestreitbaren technischen Meisterschaft steht. Dieser Ansatz erinnert an Theodor Adornos Theorien über die Dialektik zwischen Technik und Ausdruck in der modernen Kunst. Die kraftvollen Striche und gesättigten Farben von Morton-Clark erzeugen einen außergewöhnlichen visuellen Tanz, der ein Gefühl von Unmittelbarkeit und Vitalität vermittelt, das fast nitzschianisch ist, um die treffende Analyse von Pedro Medina Reinón aufzugreifen.
Seine Technik der “doodling aesthetic” (ästhetisches Gekritzel), wie Forbes sie bezeichnet hat, offenbart eine beeindruckende Unmittelbarkeit zwischen dem mentalen Bild und seiner Umsetzung. Dieser Ansatz spiegelt Roland Barthes’ Überlegungen zum Zeichnen als “erste Form der im Geist des Künstlers erzeugten Idee” wider. Morton-Clark führt diesen Gedanken bis an seine Grenzen, indem er Werke schafft, die scheinbar ständig im Entstehen begriffen sind, in einem ständigen Fluss zwischen Skizze und Fertigstellung. Diese kreative Spannung ist besonders in seinen großformatigen Werken sichtbar, in denen die Figuren zu kämpfen scheinen, um ihre Integrität angesichts der Angriffe der Abstraktion zu bewahren.
Wenn Morton-Clark sich Ikonen wie Mickey Mouse oder Donald Duck widmet, versucht er nicht einfach, sie zu reproduzieren oder wie die Pop-Art-Künstler der 1960er Jahre zu verfremden. Nein, er seziert sie, demontiert sie und baut sie mit kontrollierter Gewalt wieder auf, die an die Experimente von Francis Bacon mit seinen Porträts erinnert. Die Augen seiner Figuren, oft übertrieben vergrößert, richten sich mit beunruhigender Intensität auf den Betrachter, als wollten sie einen direkten Kontakt mit unserem kollektiven Unbewussten herstellen.
Dieser einzigartige Ansatz der kulturellen Aneignung ist Teil einer umfassenderen Reflexion über die Natur des Bildes in unserer heutigen Gesellschaft. Wie Jean Baudrillard betont hat, leben wir in einer Welt, in der die Kopie das Original verdrängt hat, in der das Simulakrum realer geworden ist als die Realität selbst. Morton-Clark spielt mit dieser Vorstellung, indem er alternative Versionen dieser universell bekannten Figuren schafft, Versionen, die gerade noch genug von ihrem ursprünglichen Wesen behalten, um erkennbar zu sein, aber ausreichend verzerrt sind, um unsere Gewissheiten in Frage zu stellen.
Der Künstler behandelt die Codes der Popkultur mit einer Geschicklichkeit, die an Stuart Halls Theorien über die Kodierung und Dekodierung kultureller Botschaften erinnert. Seine Cartoons-Figuren, erkennbar, aber verzerrt, fungieren als fließende Signifikanten, deren traditionelle Bedeutungen absichtlich verwischt wurden, um neue interpretative Möglichkeiten zu schaffen. Diese Strategie der semiotischen Destabilisierung ist besonders wirkungsvoll in seinen jüngsten Arbeiten, in denen die Figuren unter unseren Augen zu zerfallen scheinen, als ob der Prozess ihrer Dekonstruktion inszeniert würde.
Das zweite Merkmal seiner Arbeit liegt in seiner Fähigkeit, eine dramatische Spannung zwischen Abstraktion und Figuration zu erzeugen. Seine Cartoons-Figuren, erkennbar, aber verzerrt, schweben in abstrakten Räumen, die an Wassily Kandinskys Theorien über die Notwendigkeit einer “inneren Reise” in der Kunst erinnern. Morton-Clark schafft Kompositionen, in denen figürliche und abstrakte Elemente sich gegenüberstehen und ergänzen und eine visuelle Dynamik erzeugen, die über die einfache Aneignung von Pop-Art hinausgeht.
Dieser mutige Ansatz in der Komposition offenbart ein ausgefeiltes Verständnis der Geschichte der modernen Kunst. Wie Gillo Dorfles betonte, ist es notwendig, für die Version zu sprechen, da wir “mehr expressive und interpretative Möglichkeiten in Bezug auf die Neuinterpretation, die die Version vom Original vornimmt”, in Betracht ziehen müssen. Morton-Clark aktualisiert diese Überlegung, indem er Werke schafft, die als visuelle Zeugnisse auf mehreren Ebenen fungieren, wo sich Bedeutungsschichten anhäufen, ohne sich je aufzuheben.
Die Gewalt des malerischen Gestus bei Morton-Clark zielt nicht auf eine kritische oder politische Weiterentwicklung des Werks ab, wie man zunächst vermuten könnte. Sie dient vielmehr dazu, unsere Beziehung zur Vergangenheit zu transformieren, zu jenen Bildern, die unsere Kindheit bevölkerten und weiterhin unsere kollektive Vorstellungskraft bewohnen. Er verzerrt die Welt der Erinnerung, während er seinen Gemälden eine große Intensität verleiht, gerade durch ein Spiel von Gegensätzen, das die Spannung zwischen der Perspektive des Kindes und des Erwachsenen veranschaulicht.
Diese Manipulation der Kindheitserinnerungen durch vertraute Cartoonfiguren erinnert unweigerlich an Walter Benjamins Theorien über kollektives Gedächtnis und die Erfahrung der Moderne. Morton-Clarks Figuren fungieren als Ankerpunkte in unserem gemeinsamen kulturellen Gedächtnis, aber ihre systematische Verzerrung zwingt uns, unsere Beziehung zu diesen populären Ikonen neu zu überdenken.
Seine Arbeit hallt besonders im aktuellen Kontext wider, in dem uns Bilder ständig überfluten. Wie Marshall McLuhan oder John Berger angedeutet hätten, “sind wir das, was wir sehen”. Morton-Clark zwingt uns, die Bilder zu hinterfragen, die unsere Vorstellungskraft und unsere Beziehung zu ihr prägen, und schafft Werke, die als verzerrte Spiegel unserer zeitgenössischen visuellen Kultur fungieren.
Der Einsatz von Großformaten in seiner Arbeit ist kein Zufall. Er ermöglicht es dem Künstler, Werke zu schaffen, die sich dem Betrachter physisch aufdrängen und ihn dazu zwingen, sich mit diesen vertrauten Figuren in Dimensionen auseinanderzusetzen, die sie eigentümlich monumental erscheinen lassen. Diese Strategie erinnert an Maurice Merleau-Pontys Überlegungen zur Phänomenologie der Wahrnehmung, bei der die Größe des Werks selbst ein aktives Element unserer Erfahrung wird.
Die abstrakten Räume, die seine Figuren umgeben, verdienen besondere Aufmerksamkeit. Diese Bereiche reiner Farbe, diese gestischen Striche, die scheinbar in einem Moment kreativer Raserei aufgetragen wurden, schaffen einen markanten Kontrast zur relativen Einfachheit der Cartoonfiguren. Diese Spannung zwischen Abstraktion und Figuration ruft Clement Greenbergs Theorien zur Spezifität des malerischen Mediums hervor und aktualisiert sie für eine Epoche, in der die Grenzen zwischen hoher und niedriger Kultur zunehmend durchlässig geworden sind.
Sein jüngster Ausflug in die Bildhauerei, insbesondere mit seinen Betonarbeiten, die Donald Duck und Mickey Mouse darstellen, demonstriert seine Fähigkeit, seine künstlerischen Anliegen in neue Medien zu übertragen. Diese Skulpturen, die mit den Codes des architektonischen Brutalismus spielen, bieten eine neue Perspektive auf seine Arbeit der Dekonstruktion populärer Ikonen. Die Verwendung von Beton und sichtbaren Eisenstäben schafft einen faszinierenden Dialog zwischen der Beständigkeit des Materials und der vergänglichen Natur der Cartoonfiguren.
Der Einfluss seines Hintergrunds in der Animation zeigt sich deutlich in seiner Art, Bewegung auf der Leinwand zu behandeln. Seine Figuren scheinen in einem Zustand ständiger Transformation eingefroren zu sein, als ob sie zwischen zwei Bildern einer animierten Sequenz eingefangen wären. Dieser Ansatz erinnert an Henri Bergsons Theorien zur Dauer und Bewegung und suggeriert eine komplexe Temporalität, die über die einfache statische Darstellung hinausgeht.
Die Farbgestaltung von Morton-Clark ist ebenfalls interessant. Seine kühnen Farbwahl, die auf den ersten Blick vielleicht discordant erscheint, schafft unerwartete Harmonien, die an die Experimente der Fauves erinnern. Im Gegensatz zu diesen verwendet Morton-Clark die Farbe jedoch nicht, um reine Emotionen auszudrücken, sondern um visuelle Spannungen zu erzeugen, die den verstörenden Charakter seiner Kompositionen verstärken.
Sein Umgang mit der Bildoberfläche, bei dem die rohe Leinwand an manchen Stellen sichtbar bleibt, offenbart ein ausgeprägtes Bewusstsein für die zeitgenössischen Debatten über Materialität in der Malerei. Diese Strategie erinnert an die Überlegungen von Rosalind Krauss zur Rasterstruktur als Paradigma der modernen Kunst, während sie zugleich für eine Zeit aktualisiert wird, in der die Virtualität digitaler Bilder paradoxerweise die Bedeutung der Materialität neu entdecken lässt.
Die Art und Weise, wie Morton-Clark den Bildraum gestaltet und Kompositionen schafft, die zugleich flach und tief wirken, evoziert die Theorien von Maurice Denis zur Flächigkeit der Bildoberfläche. Der britische Künstler führt diese Überlegung jedoch weiter, indem er paradoxe Räume schafft, in denen Cartoonfiguren scheinbar in einer Leere schweben, die zugleich von malerischen Gesten gesättigt ist.
Seine Arbeit wirft wichtige Fragen zur Natur der Authentizität in der zeitgenössischen Kunst auf. In einer Welt, in der Bilder unendlich reproduzierbar und manipulierbar sind, gelingt es Morton-Clark Werke zu schaffen, die eine unbestreitbare Authentizität bewahren, gerade weil sie ihre eigene simulakrale Natur erkennen und mit ihr spielen. Dieser Ansatz spiegelt die Theorien von Jacques Derrida zur Dekonstruktion wider und legt nahe, dass Bedeutung gerade in den Abweichungen und Unterschieden entsteht.
Die wiederkehrende Präsenz bestimmter Figuren in seinem Werk, insbesondere Mickey Mouse und Donald Duck, ist kein Zufall. Diese Ikonen fungieren als Orientierungspunkte in unserer kollektiven visuellen Kultur, Konstanten, um die herum der Künstler seine Variationen konstruiert. Dieser Ansatz erinnert an Roland Barthes’ Reflexionen über zeitgenössische Mythologien, in denen bestimmte Bilder einen quasi mythischen Status in unserer kollektiven Vorstellungskraft erlangen.
Morton-Clark setzt seine Erkundung neuer künstlerischer Richtungen fort, verschiebt die Grenzen seiner Praxis und bewahrt dabei eine bemerkenswerte Kohärenz in seinem Vorgehen. Seine jüngste Arbeit zeigt eine zunehmende Tendenz zur Abstraktion, wobei die Cartoonfiguren sich stärker in die malerische Materie aufzulösen scheinen. Diese Entwicklung deutet auf ein wachsendes Vertrauen in seine Fähigkeit hin, die visuellen Codes, die er sich angeeignet hat, zu manipulieren.
Betrachtet man sein Gesamtwerk, fällt vor allem seine Fähigkeit auf, ein zerbrechliches Gleichgewicht zwischen Vertrautheit und Fremdheit, zwischen Humor und Beklommenheit, zwischen Abstraktion und Figuration zu wahren. Morton-Clark hat ein einzigartiges visuelles Universum geschaffen, in dem die Ikonen unserer Kindheit in neuen und verstörenden Formen wiederkehren und uns zwingen, unsere Beziehung zu diesen Bildern, die unsere Weltsicht geprägt haben, neu zu überdenken.