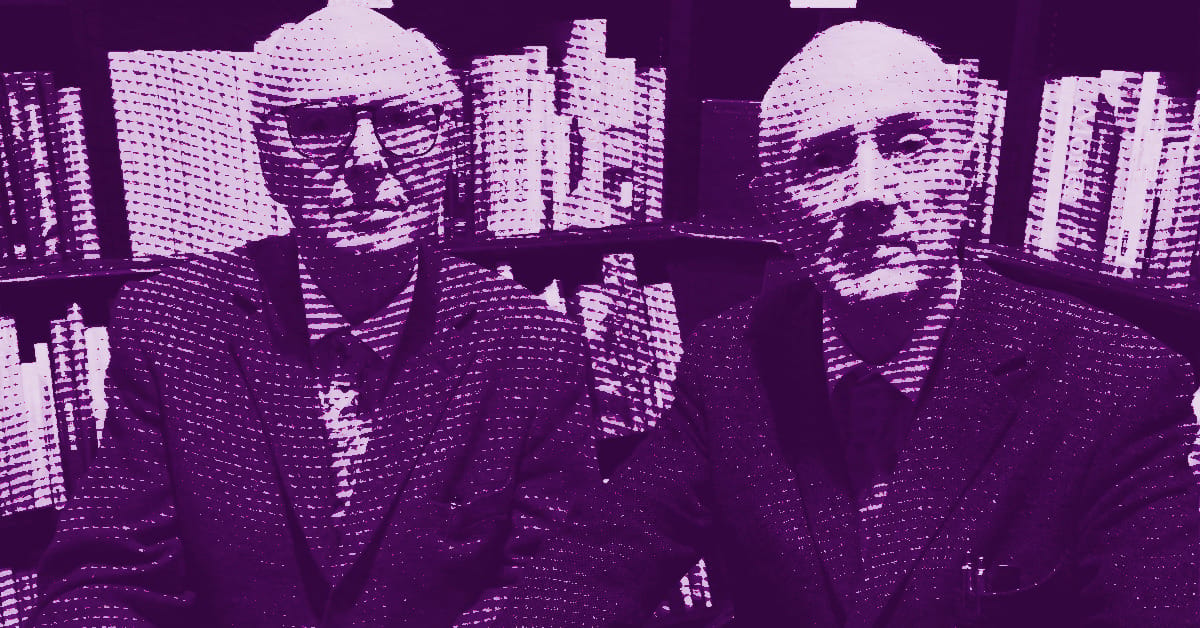Hört mir gut zu, ihr Snobs: Gilbert & George sind keine gewöhnlichen Künstler, und sie durch das konventionelle Prisma der zeitgenössischen Kunstgeschichte zu verstehen, wäre ein ebenso grober Fehler wie eine Kathedrale nach der Farbe ihrer Glasfenster zu beurteilen. Dieses unwahrscheinliche Duo, 1967 an der Saint Martin’s School of Art gegründet, hat methodisch ein Werk geschaffen, das jeder vorschnellen Kategorisierung, jedem Versuch, es auf eine Bewegung, eine Schule oder eine vorübergehende Tendenz zu reduzieren, trotzt.
Gilbert Prousch, geboren 1943 im italienischen Südtirol, und George Passmore, geboren 1942 in Plymouth, verkörpern seit mehr als einem halben Jahrhundert eine künstlerische Besonderheit, die es verdient, mit Sorgfalt betrachtet zu werden. Ihr Ansatz ist in einer langen, fast architektonischen Zeitlichkeit verankert, bei der jedes Werk ein weiterer Stein im Bauwerk ist, das sie geduldig errichten. Die architektonische Dimension ihrer Arbeit ist keine bloße Metapher, sondern eine tiefgreifende strukturelle Realität. Ihr Haus in der Fournier Street in Spitalfields, ein georgianisches Gebäude aus dem 18. Jahrhundert, das sie seit 1968 bewohnen, ist nicht nur Wohnort, sondern der eigentliche Schmelztiegel ihrer künstlerischen Praxis. Architektur wird bei ihnen Sprache, Methode, Philosophie. Die sorgfältige Restaurierung dieses Hauses, bei der sie die ursprüngliche Dekoration wiederhergestellt haben, zeugt von einem scharfen Bewusstsein für die Beziehung zwischen Struktur und Inhalt, zwischen Form und Existenz. Dieses Haus ist kein Bühnenbild, sondern eine Erweiterung ihres künstlerischen Körpers, ein Raum, in dem Leben und Kunst bis zur Ununterscheidbarkeit verschmelzen.
Die schwarzen Gitter, die ihre Fotomontagen seit den 1970er Jahren strukturieren, erinnern sofort an die Anordnung mittelalterlicher Glasfenster, diese fragmentierten Kompositionen, die durch farbige Tafeln heilige Geschichten erzählen. Aber wo das gotische Glasfenster die Seele zum Göttlichen erhebt, führen Gilbert & Georges Gitter sie brutal zum Irdischen, zum Körperlichen, ja sogar zum Obszönen zurück. Ihre Bilder-Serie, die Anfang der 1970er Jahre begann, setzt ein strenges Kompositionssystem durch, bei dem jedes Werk wie ein offenes Fenster zum Londoner East End entfaltet wird. Diese geometrische Struktur, weit mehr als eine bloße ästhetische Wahl, schafft eine Ordnung im Chaos des urbanen Lebens, das sie mit fast manischer Konstanz dokumentieren. Die gesättigten, oft grellen Farben, eingeschlossen hinter diesen schwarzen Gitterstäben, erzeugen eine Spannung zwischen Eindämmung und Überschwang, zwischen der apollinischen Struktur und dem dionysischen Inhalt. Die Architektur ihrer Werke imitiert die der Stadt selbst, mit ihren Fenstern, Fassaden und räumlichen Unterteilungen, die das menschliche Nebeneinander ordnen.
Die soziologische Frage durchdringt ihr Werk mit einer Schärfe, die bei Künstlern, die oft der Oberflächlichkeit bezichtigt werden, überrascht. Gilbert & George beschränken sich nicht darauf, ihren Stadtteil zu beobachten, sie machen daraus ein Labor zur Untersuchung der zeitgenössischen sozialen Veränderungen. Ihre Aussage, dass “nichts in der Welt passiert, was nicht im East End geschieht” [1], könnte überheblich erscheinen, wenn sie nicht von einer Bildproduktion begleitet würde, die methodisch die sozialen Schichten dieses Gebiets dokumentiert. Das Londoner East End mit seiner Geschichte der fortlaufenden Einwanderung, der endemischen Armut und der rasanten Gentrifizierung bietet tatsächlich einen konzentrierten Überblick über die Spannungen, die westliche Metropolen durchziehen. Die Künstler positionieren sich dort als Ethnographen im Dreiteiler, die die Überreste der urbanen Moderne sammeln: Lachgaspatronen, Graffiti, Kleinanzeigen von Sexarbeiter*innen, reißerische Schlagzeilen aus Zeitungen. Diese Ansammlung ist nicht willkürlich, sondern folgt einer fast wissenschaftlichen Methodologie. Jedes Element, das aus ihrer unmittelbaren Umgebung entnommen wird, wird zu einem Symptom, einem Hinweis auf Klassen-, Rassen- und Geschlechterverhältnisse, die die britische Gesellschaft strukturieren.
Ihr Sprachgebrauch, insbesondere in Serien wie Ages von 2001 oder den Jack Freak Pictures von 2009, offenbart ein feines Verständnis der Mechanismen symbolischer Herrschaft. Indem sie Annoncen männlicher Prostitution reproduzieren, legen sie schonungslos die Kommerzialisierung der Körper in der neoliberalen Ökonomie offen. Indem sie die hysterischen Schlagzeilen des Evening Standard sammeln, entlarven sie die Fabrikation von Angst und Ressentiments, die den Populismus nährt. Die obsessive Wiederholung der Wörter “Murder”, “Victim”, “Gangs” in ihren Kompositionen unterstreicht die ideologische Funktion der medialen Diskurse, die eine Wirklichkeit konstruieren, in der Gewalt zur dominierenden Erfassungsweise des Sozialen wird. Gilbert & George prangern diese Mechanismen nicht explizit an, ihre offensichtliche Neutralität bewahrt sie vor jeglichem Didaktismus, doch ihre Montage erzeugt eine kritische Distanzierung. Der Betrachter sieht sich mit der rohen Materialität der sozialen Sprache konfrontiert, die aus dem Kontext gelöst und im Raum des Kunstwerks vergegenständlicht wird.
Die Frage der sozialen Klasse durchzieht unterschwellig ihre Praxis. Ihre Kleidung, jene altmodischen Anzüge, die sie seit The Singing Sculpture von 1969 tragen, stellt eine soziologische wie ästhetische Geste dar. Der Anzug symbolisiert historisch die Kleidung der kleinen bürgerlichen Respektabilität, die des Büroangestellten, des Untergebenen im öffentlichen Dienst. Indem Gilbert & George sich täglich darin einsperren, performen sie eine mehrdeutige Klassenidentität, weder proletarisch noch aristokratisch, die genau ihrer Position im künstlerischen Feld entspricht. Sie beanspruchen eine populäre Zugänglichkeit mit ihrem Slogan “Art for All” (Kunst für alle) [2], produzieren aber Werke, die zu Goldpreisen an internationale Sammler verkauft werden. Dieser Widerspruch ist keine Heuchelei, sondern ein ehrlicher Spiegel der unmöglichen Position des zeitgenössischen Künstlers, gefangen zwischen demokratischem Anspruch und Integration in den Luxusmarkt. Ihr Stadtteil Spitalfields verkörpert diese Spannung: einst Arbeiterviertel der Textilindustrie, ist es zu einem der am stärksten gentrifizierten Gebiete Londons geworden, in dem georgianische Häuser mehrere Millionen Pfund erreichen. Gilbert & George wohnen physisch und symbolisch in diesem Widerspruch.
Ihre Behandlung der Religion als soziale Institution ist besonders interessant. Die Werke der Serie Sonofagod Pictures von 2005 beschränken sich nicht darauf, zum Vergnügen zu schocken zu lästern. Sie hinterfragen das Fortbestehen des religiösen Faktors in säkularisierten Gesellschaften und die Art und Weise, wie heilige Symbole weiterhin das kollektive Vorstellungsbild beherrschen. Indem sie christliche Kreuze, islamische Motive und ihre eigenen Körper in christusähnlichen Posen nebeneinandersetzen, heben sie die universelle anthropologische Funktion des Religiösen hervor und entmystifizieren gleichzeitig dessen transzendente Ansprüche. Religion erscheint als ein Zeichensystem unter anderen, nicht mehr und nicht weniger legitim als die Werbesprache oder Pornografie. Diese allgemeine Gleichwertigkeit der Zeichensysteme, charakteristisch für die postmoderne Bedingung, findet in ihrer Arbeit einen besonders expliziten Ausdruck.
Die Rassenfrage, allgegenwärtig in ihrem Werk der 1980er und 2000er Jahre, wirft Ambiguitäten auf, die die Künstler mit einer Form berechnender Provokation annehmen. Titel wie Paki zur Bezeichnung des Porträts eines asiatischen Mannes haben Rassismusvorwürfe ausgelöst, die sie mit einer Handbewegung abtun, indem sie auf ihre Funktion als gesellschaftlicher Spiegel verweisen. Sie schaffen den Rassismus nicht, argumentieren sie, sie dokumentieren ihn. Diese Haltung ethnografischer Neutralität ist natürlich problematisch, da sie die Tatsache verschleiert, dass die Reproduktion selbst kritischer rassistischer Stereotype zu deren Verbreitung beiträgt. Dennoch trägt ihr Beharren darauf, die ethnische Vielfalt des East End darzustellen und marginalisierten Bevölkerungsgruppen Sichtbarkeit zu verleihen, zu einer Form von Inklusivität bei, auch wenn sie unbeholfen ist. Ihre neuesten Arbeiten, die bis zum 11. Januar 2026 in der Hayward Gallery in London ausgestellt sind, hinterfragen weiterhin die Identitätsbruchlinien, die die britische Gesellschaft nach dem Brexit durchziehen, diese Gesellschaft, die sie seit über einem halben Jahrhundert mit bewundernswerter Konstanz beobachten.
Die künstlerische Geste von Gilbert & George besteht im Grunde darin, ihr eigenes Dasein in lebende Skulptur zu verwandeln. Diese Ende der 1960er Jahre getroffene Entscheidung, niemals getrennt aufzutreten, ständig denselben Anzugtyp zu tragen, die Unterscheidung zwischen Arbeitszeit und Privatleben abzulehnen, zeugt von einer Radikalität, deren Anforderungen wir kaum ermessen. Sie haben sich buchstäblich zu Monumenten gebaut, öffentlichen Figuren, deren künstlerische Identität über jeder persönlichen Identität steht. Diese Selbstmonumentalisierung findet ihren logischen Höhepunkt in der Eröffnung des Gilbert & George Centre in der Heneage Street im Jahr 2023, einem ausschließlich ihrem Werk gewidmeten Raum, einer Vorschau auf ein Mausoleum, in dem ihr Andenken nach ihrem Tod bewahrt wird. Denn der Tod schleicht sich nun in ihre jüngsten Kompositionen ein. Die Serie The Corpsing Pictures von 2023 zeigt sie ausgestreckt auf Knochen, gekleidet in blutrote Anzüge. Im Alter von über achtzig Jahren stellen sie sich ihrer Endlichkeit mit derselben Ungekünsteltheit, die sie auf alle anderen Themen angewandt haben.
Ihre Beziehung zur Sexualität verdient besondere Aufmerksamkeit. 2008 zivil verheiratet nach vierzig gemeinsamen Jahren, haben sie ihre homosexuelle Beziehung schon lange vor ihrer gesellschaftlichen Akzeptanz zu einem grundlegenden Element ihres Werks gemacht. Die Naked Shit Pictures von 1994, die sie nackt inmitten von Darstellungen von Exkrementen zeigen, bekräftigen die fleischliche, körperliche, triviale Dimension der menschlichen Existenz. Sie lehnen die romantische Verklärung von Liebe wie Sexualität ab und bevorzugen es, diese in ihrer prosaischen Materialität zu zeigen. Dieser entzauberte Ansatz mag zynisch erscheinen, trägt aber auch eine Form von Zärtlichkeit in sich. Ihre Aussage, dass ihre Werke “eine Art visueller Liebesbrief von uns an den Betrachter” [3] seien, deutet darauf hin, dass hinter Provokation und Obszönität der Wunsch nach menschlicher Verbindung und das Bedürfnis steht, eine ungeschminkte, ehrliche Welterfahrung zu teilen.
Das Werk von Gilbert & George entzieht sich jeder einfachen Vereinnahmung. Selbsternannte Konservative, Bewunderer von Margaret Thatcher, Befürworter des Brexits und der Monarchie trotzen sie den politischen Erwartungen der meist progressiven zeitgenössischen Kunstszene. Diese heterodoxe Position hat ihnen die Feindschaft eines Teils der Kritik eingebracht, die ihnen Nachgiebigkeit gegenüber reaktionären Kräften vorwirft. Doch ihre Werke über Faschismus oder Homophobie bezeugen ein eindeutiges Engagement gegen Unterdrückung. Dieser scheinbare Widerspruch offenbart vor allem die Armut binärer politischer Kategorien, wenn es darum geht, die Komplexität der Wirklichkeit zu erfassen. Gilbert & George entziehen sich Schubladen, und genau das macht ihre Arbeit notwendig. Sie erinnern uns daran, dass das soziale Leben nicht auf Parolen reduziert werden kann und dass Individuen keine ideologischen Abstraktionen sind, sondern fleischgewordene Wesen voller Widersprüche.
Ihr Vermächtnis geht weit über den Rahmen der britischen Kunstgeschichte hinaus. Sie haben Generationen von Künstlern beeinflusst, von Kraftwerk, der ihr Erscheinungsbild als Inspiration für seine robotische Ästhetik nutzte, bis hin zu Grant Morrison, der sie in seiner Comicserie The Filth parodierte. Ihre außergewöhnliche Langlebigkeit, mehr als fünfundfünfzig Jahre ununterbrochene Zusammenarbeit, ist an sich eine bemerkenswerte Leistung in einer Kunstwelt, die von Flüchtigkeit und dem Streben nach Neuem geprägt ist. Sie haben methodisch ein Werk kathedralenartigen Ausmaßes Stein um Stein, Bild um Bild mit monastischer Disziplin aufgebaut. Diese Geduld, diese Treue zu einer Vision, diese Hartnäckigkeit, denselben Weg jahrzehntelang zu verfolgen, gebietet Respekt, auch wenn man bestimmte Aspekte ihrer Arbeit kritisieren kann.
Am Ende dieser Reise in die Welt von Gilbert & George wird eine Wahrheit offensichtlich: Ihr Werk lässt sich nicht durch herkömmliche Analyse-Raster zähmen. Es verlangt, dass man es mit den Instrumenten der Architektur betrachtet, um seine Struktur zu verstehen, mit denen der Soziologie, um seinen Bezug zur Realität zu erfassen, mit denen der Anthropologie, um seine dokumentarische Dimension zu würdigen. Doch es erfordert auch, dass man seinen unnachgiebigen Anteil an Geheimnis akzeptiert, jene undurchsichtige Zone, in der zwei Leben zu einer einzigen künstlerischen Einheit verschmolzen sind, deren innere Logik uns notwendigerweise entgeht. Ihr Haus in der Fournier Street, Tempel und Labor, Archiv und Heiligtum, wird nach ihrem Verschwinden ein Pilgerort für jene, die das Geheimnis dieser Verschmelzung ergründen wollen. Aber vielleicht gibt es dieses Geheimnis gar nicht, vielleicht haben Gilbert & George einfach beschlossen, ihre Kunst zu leben, statt sie zu produzieren, und diese ursprüngliche Entscheidung enthält bereits den Schlüssel zu ihrem Rätsel. In einer Zeit, die von theoretischen Diskursen und konzeptuellen Rechtfertigungen übersättigt ist, bieten sie die seltene Erscheinung einer künstlerischen Praxis, die für sich allein steht, die nicht übersetzt oder erklärt werden muss, weil sie da ist, massiv, unumgänglich, manchmal irritierend, aber unbestreitbar lebendig. Und vielleicht ist genau das ihr größter Sieg: alle Moden, alle Bewegungen, alle Theorien zu überdauern, indem sie beharrlich sie selbst bleiben, zwei Männer im Anzug, die die Welt von ihrer Straße in Spitalfields aus beobachten, ihre Überreste sammeln, um daraus Kathedralen aus Licht und Schlamm zu schaffen.
- Anna van Praagh, “Gilbert and George: ‘Margaret Thatcher hat viel für die Kunst getan'”, The Daily Telegraph, 5. Juli 2009
- Slogan, den die Künstler von Beginn an übernommen haben, erwähnt insbesondere in Wolf Jahn, The art of Gilbert & George, or, An aesthetic of existence, Thames & Hudson, 1989
- Zitat der Künstler, veröffentlicht in “Gilbert & George deshock at Rivoli”, ITALY Magazine, Archiv vom 28. Januar 2013