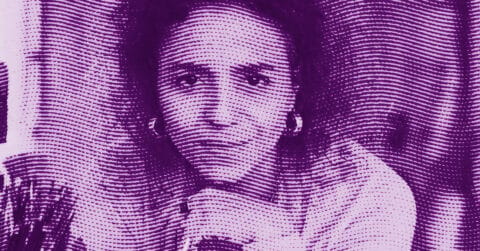Hört mir gut zu, ihr Snobs, ihr glaubt, ihr wisst alles über zeitgenössische Kunst mit euren kleinen Gewissheiten, ordentlich wie die Parterres von Versailles? Lasst mich euch von Günther Förg (1952, 2013) erzählen, diesem deutschen Künstler, der sein Leben damit verbracht hat, eure Vorurteile über moderne Malerei mit der Subtilität eines Elefanten im Porzellanladen zu sprengen, aber mit dem Genie eines visuellen Nietzsche.
Ich höre schon eure empörten Proteste: “Aber das sind doch nur Farbflecken!” Ach wirklich? Dann lasst mich euch in die schwindelerregenden Tiefen des Werks desjenigen entführen, der es gewagt hat, die Codes der modernistischen Abstraktion aufzugreifen, um sie dann zu sprengen, wie ein kultureller Kamikaze, der sich ins Allerheiligste der modernen Kunst eingeschlichen hätte.
Erste Lektion: fotografierte Architektur. Förg beschränkte sich nicht darauf, seine Kamera wie ein verlorener Tourist zur Documenta auf Gebäude zu richten. Nein, er jagte der Seele des architektonischen Modernismus durch seine zeitgenössischen Ruinen nach. Seine Fotos der Casa del Fascio von Giuseppe Terragni oder der Villa Wittgenstein sind keine bloßen Dokumente. Sie sind visuelle Autopsien einer toten Utopie, schonungslose Röntgenaufnahmen eines architektonischen Traums, der an der Mauer der Realität zerschellt ist. Und wenn er diese Bilder unter reflektierendem Glas ausstellt, wodurch der Betrachter sich selbst über die zerfallenen modernistischen Fassaden gelegt sieht, scheint es, als würde er uns sagen: “Schaut euch genau an, ihr seid die Erben dieses monumentalen Scheiterns.”
Aber das ist nur der Einstieg. Sprechen wir nun über seine Bleimalereien, jene Werke, die buchstäblich auf unserem Bewusstsein lasten wie die Last der Geschichte. Förg nimmt das schwerste, toxischste Material und macht es zur Trägerin einer paradoxen Schönheit. Es ist, als hätte Walter Benjamin beschlossen, seine “Thesen zum Begriff der Geschichte” direkt auf die Trümmer des Engels der Geschichte zu malen. Seine schnellen Pinselstriche auf dem Blei sind keine Faulheit, wie manche amerikanische Kritiker mit so kurzsichtigem Blick wie ihrem Bankkonto behaupten. Es ist eine existenzielle Dringlichkeit, ein Wettlauf gegen den Tod der Kunst, den er mit großen Acrylstrichen führt.
Und dann sind da noch seine Gitter, diese “Gitterbilder”, die direkt einem Alptraum von Mondrian entsprungen zu sein scheinen. Förg greift das modernistische Urmotiv, das Gitter, dieses Symbol der rationalen Ordnung, das Rosalind Krauss so brillant analysiert hat, auf und lässt es zittern wie ein Blatt im Sturm der Geschichte. Seine Linien sind nie vollkommen gerade, seine Quadrate niemals exakt quadratisch. Es ist ein Modernismus, der seine Fragilität eingesteht, der anerkennt, dass die Suche nach formaler Reinheit vielleicht eine gefährliche Illusion war.
Was mich an Förg fasziniert, ist seine Fähigkeit, gleichzeitig ein respektvoller Erbe und ein rebellischer Sohn des Modernismus zu sein. Er lehnt das Erbe von Barnett Newman oder Mark Rothko nicht ab wie ein wütender Teenager, der Familienfotos verbrennen würde. Nein, er verdaut sie, verwandelt sie, macht sie sich mit einer intellektuellen Gier zu eigen, die Roland Barthes erblassen lassen würde. Wenn er seine “zips” im Stil von Newman auf Blei malt, ist das kein fauler postmoderner Verweis, sondern eine Konfrontation, ein Kampf mit der Kunstgeschichte.
Und reden wir über diese Kunstgeschichte! Förg kennt sie bis ins kleinste Detail, nicht wie ein Museumsbetreuer, der tote Schmetterlinge ordnet, sondern wie ein Boxer, der den Stil seiner Gegner auswendig kennt. Er weiß genau, wo er zuschlagen muss, welche Codes er entstellen, welche Gewissheiten er erschüttern kann. Seine technische Meisterschaft ist nie umsonst, jeder Pinselstrich, jeder fotografische Ausschnitt ist eine philosophische Entscheidung.
Seine Installationen sind konzeptuelle Aufwärtshaken, die uns im Stehen K.O. schlagen. Wenn er direkt auf Wände malt und den Ausstellungsraum in eine Arena verwandelt, in der Farbe und Architektur aufeinandertreffen, dekoriert er nicht nur, sondern schreibt die räumliche Grammatik des Modernismus neu. Es ist, als hätte Heidegger eine Karriere als Wandmaler eingeschlagen und das In-Sein-der-Welt der Kunst mit großen bunten Farbrollen hinterfragt.
Die Fragilität, von der einige Kritiker über sein Werk sprechen, ist keine Schwäche, sondern eine subversive Kraft. In einer Kunstwelt, die von marktlichen Gewissheiten und konzeptuellen Posen besessen ist, wagt Förg zu zeigen, dass Schönheit aus Unsicherheit entstehen kann, dass Größe aus bewusster Unvollkommenheit hervorgehen kann. Seine körnigen Fotografien, seine hastig gemalten Bilder, seine Installationen, die mit Spiegelungen spielen, bilden zusammen eine Ästhetik des Zweifelns, die traditionelle Kanons der “schönen” Malerei sprengt.
Ich höre schon die Seufzer der Puristen: “Aber er ist nicht originell, er zitiert nur!” Ach ja? Und Picasso war originell, als er fröhlich afrikanische Kunst plünderte? Förgs wahre Originalität liegt darin, wie er seine Einflüsse in eine persönliche bildnerische Sprache verwandelt, wie ein Alchemist, der das Blei der Kunstgeschichte in zeitgenössisches Gold verwandelt.
Seine Arbeit mit Farbe ist besonders aufschlussreich. Wenn er diese dumpfen Töne, metallischen Grautöne, industriellen Blautöne verwendet, liegt das nicht an mangelnder Farbvorstellung. Es ist eine Palette, die die Geschichte des 20. Jahrhunderts erzählt, die die Erinnerung an Katastrophen und gescheiterte Utopien in sich trägt. Seine Farben sind Fossilien des Modernismus, geisterhafte Spuren eines Traums von Reinheit, der zum Albtraum wurde.
Förg war ein Künstler, der verstand, dass Kunst kein ruhiger Fluss ist, sondern eine Reihe gefährlicher Stromschnellen, die mit Intelligenz und Mut gemeistert werden müssen. Er wusste, dass Schönheit aus der Auseinandersetzung mit der Geschichte entstehen kann, dass künstlerische Wahrheit nicht im Vorwärtslaufen liegt, sondern im angespannten Dialog mit der Vergangenheit.
Also das nächste Mal, wenn Sie ein Werk von Förg sehen, begnügen Sie sich nicht damit, es als postmodernes Stil-Experiment zu betrachten. Schauen Sie lieber, wie er jeden Träger, sei es Blei, Fotografie oder architektonischen Raum, in ein Schlachtfeld verwandelt, auf dem die Zukunft der Kunst entschieden wird. Denn das ist Förgs wahres Erbe: uns zu zeigen, dass Kunst zugleich kritisch und poetisch, historisch und zeitgenössisch, intellektuell und sinnlich sein kann.
Und wenn Sie es immer noch nicht verstehen, ist das nicht schlimm. Förgs Kunst ist nicht zum Verstehen gemacht, sondern zum Erleben, wie ein Sturm, der uns daran erinnert, dass Schönheit nicht immer dort ist, wo man sie erwartet.