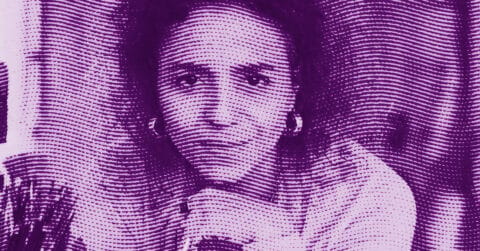Hört mir gut zu, ihr Snobs, die ihr die klimatisierten Galerien mit euren schwarzen Sonnenbrillen und euren gelehrten Anmerkungen zur zeitgenössischen Kunst heimsucht. Heute sprechen wir über Isa Genzken, diese sublime Hexe der deutschen Bildhauerei, die uns seit fast fünf Jahrzehnten die funkelnden Trümmer unserer zerfallenden Moderne ins Gesicht schleudert.
Stellen Sie sich für einen Moment vor, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir seien in einer einzigen Person wiedergeboren, eine Künstlerin, die die existenzielle Angst in greifbare Objekte meißelt, die uns mit der Intensität eines urbanen Unbehagens anstarren. Das ist Isa Genzken. Diese Frau, die es wagte, die zersplitterte Welt des Nachkriegsdeutschlands zu erfassen und sie in eine so persönliche Katastrophenästhetik zu verwandeln, dass sie universell wird.
Geboren 1948 in Bad Oldesloe, taucht Genzken in einer von Männern dominierten Kunstlandschaft auf, in der Bildhauerinnen so selten waren wie nüchterne Einhörner auf Künstlerfesten. Der amerikanische Minimalismus herrschte damals vor, und da kam diese germanische Amazone mit ihren “Ellipsoïden” und “Hyperbolos” aus den 1970er Jahren, jenen langgezogenen mathematischen Formen aus lackiertem Holz, die scheinbar “Fuck you” sagten zu Carl Andre und all den Machos, die glaubten, Bildhauerei müsse stoisch, unveränderlich und vor allem männlich bleiben.
Aber halten wir uns nicht an der Oberfläche dieser frühen Werke auf. Was diese geometrischen Skulpturen zum Klingen bringt, ist genau die existentielle Spannung, die sie verkörpern. Der Existentialismus lehrt uns, dass die Existenz der Essenz vorausgeht, und Genzken zeigt uns, wie Objekte in einem Zustand ständiger Verhandlung mit dem Raum, mit ihrer eigenen Materie, mit unserer Wahrnehmung existieren. Diese langen Holzformen, die scheinbar über dem Boden schweben, sind nicht nur formale Übungen, sie sind Erkundungen der ontologischen Bedingung des Objekts im Raum.
Sartre hätte geschätzt, wie Genzken das träge “An-sich” der traditionellen Skulptur in ein dynamisches und kontingentes “Für-sich” verwandelt. Diese Objekte sind da, aber sie weigern sich, ihre passive “Dinglichkeit” zu akzeptieren. Sie konfrontieren uns, fordern uns heraus und verlangen, dass wir sie nicht als feste Einheiten wahrnehmen, sondern als sich ständig entwickelnde räumliche Vorschläge. Diese frühen Werke erinnern uns daran, dass Kunst, wie das Dasein, ein nie abgeschlossenes Projekt ist, immer im Werden.
Wenn man Genzkens Weg in den 1980er-Jahren verfolgt, sieht man, wie sie die mathematische Eleganz aufgibt, um Beton zu erforschen, jenes banale Material des deutschen Wiederaufbaus. Ihre “Fenster” aus dieser Zeit sind Denkmäler der Leere, Rahmen, die nichts einfassen, Öffnungen ohne Aussicht. Diese Betonskulpturen rufen urbane Ruinen hervor und lehnen gleichzeitig Nostalgie ab. Sie sprechen von der existenziellen Absurdität einer Welt, die in stetigen Zyklen baut und zerstört.
Auch hier bietet uns der Existentialismus einen Leseschlüssel. Die menschliche Existenz ist für Camus wie Sisyphos, der ewig seinen Felsen hinaufwälzt. Genzken präsentiert uns architektonische Formen, die niemanden beherbergen, Strukturen, die in einem paradoxen Zustand zwischen Konstruktion und Verfall existieren. Diese Skulpturen erinnern uns daran, dass jeder Versuch, Sinn zu schaffen, mit der grundlegenden Absurdität der Existenz konfrontiert ist.
Dann kommt der Bruch, jener Moment, in dem Genzken anscheinend einen explosiven Cocktail aus jahrtausendealter Angst und konsumistischen Abfällen verschlungen hat. Ihre Assemblagearbeit, beginnend mit der Serie “Fuck the Bauhaus” im Jahr 2000, die aus Architekturmaquetten besteht, die aus Pizzakartons, Muscheln, Plastikspielzeug und bunten Klebebändern gebastelt sind, markiert einen radikalen Übergang. Man könnte es als Aufgabe ihrer früheren formalen Strenge interpretieren, doch vielmehr ist es eine Intensivierung ihrer existenziellen Suche.
Wenn uns die Existentialisten lehren, dass wir “zum Frei-sein verurteilt” sind, zeigt uns Genzken, was diese Freiheit in einer Welt bedeutet, die von konsumierbaren, wegwerfbaren Gegenständen übersättigt und dennoch allgegenwärtig ist. Ihre Praxis der Assemblage wird zu einer Form des materiellen Existentialismus, bei der Objekte aus ihrem kommerziellen Kontext herausgerissen und in neuen bedeutungsvollen Zusammenhängen neu zusammengesetzt werden.
Nehmen wir ihre Installation “Oil” für den deutschen Pavillon auf der Biennale von Venedig 2007. Der Eingang des Gebäudes, umhüllt von Gerüsten, das Innere bevölkert von zurückgelassenem Gepäck, hängenden Astronauten und allgegenwärtigen Spiegeln, all dies schafft eine Landschaft des ständigen Transits, einen Non-Lieu im Sinne des Anthropologen Marc Augé. Es ist eine tiefe Meditation über die zeitgenössische Entfremdung, über unsere kollektive Unfähigkeit, die von uns geschaffene Welt vollständig zu bewohnen.
Der Existentialismus von Sartre und Beauvoir erinnert uns daran, dass wir durch unser Handeln, durch unsere Entscheidungen, durch unser existenzielles “Projekt” definiert sind. Genzken trifft die Wahl, dem materiellen Chaos unserer Epoche mit der Transformation von Konsumkulturabfällen in komplexe und verstörende Skulpturen zu begegnen. Sie lehnt die Nostalgie eines sauberen, ordentlichen Minimalismus ebenso ab wie die Versuchung, sich in einem künstlerischen Elfenbeinturm zurückzuziehen.
Die merkwürdig bekleideten Puppen aus ihrer Serie “Schauspieler” (Acteurs) der letzten Jahre bieten vielleicht die klarste Manifestation ihrer existenziellen Reflexion. Diese humanoiden Figuren, gekleidet in exzentrischen Kostümen, posieren wie Schauspieler, eingefroren in einem absurden Stück. Sie erinnern uns daran, dass wir in einer Gesellschaft des Spektakels alle ständig eine Rolle spielen, Rollen, die uns auferlegt werden, während wir gleichzeitig versuchen, eine persönliche Authentizität aufzubauen.
Wie Simone de Beauvoir in “Das andere Geschlecht” schreibt: “Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht.” Genzkens Puppen scheinen zu sagen: “Man wird nicht als zeitgenössisches Subjekt geboren, man wird es durch eine chaotische Ansammlung kultureller Zeichen, Modetrends, erlernter Haltungen und identitätsstiftender Accessoires.” Diese anthropomorphen Skulpturen, weder ganz menschlich noch bloß Objekte, verkörpern die ontologische Zweideutigkeit, die im Zentrum des Existentialismus steht.
Kritikerinnen und Kritiker, die in Genzkens jüngster Arbeit nur einen oberflächlichen Kommentar zur Konsumkultur sehen, übersehen das Wesentliche. Ihre Ästhetik des Collage, der Überfülle und des Sammelsuriums ist nicht nur eine Kritik an der zeitgenössischen Oberflächlichkeit, sondern eine tiefgehende Erforschung der Art und Weise, wie Objekte unsere Erfahrung der Welt und uns selbst prägen.
Der Existentialismus lehrt uns, dass wir “in” einem spezifischen historischen und sozialen Kontext “verortet” sind, der unsere Entscheidungen einschränkt und sie zugleich bedeutsam macht. Genzken, als deutsche Künstlerin, die unmittelbar nach dem Krieg geboren wurde, ist in einer komplexen und turbulenten nationalen Geschichte verortet. Ihre jüngsten Werke können als Versuche gelesen werden, mit dieser Geschichte umzugehen, ohne darin unterzugehen, Kunst zu schaffen, die ihren Kontext anerkennt und ihn gleichzeitig transzendiert.
Genzkens Assemblagen nach dem 11. September, wie die Serie “Empire/Vampire, Who Kills Death” (2003), sind keine bloßen Reaktionen auf eine zeitgenössische Tragödie. Sie sind Teil einer umfassenderen Reflexion über historische Gewalt, über die Zyklen von Zerstörung und Wiederaufbau, die das 20. Jahrhundert prägten. Wenn sie Spielzeugsoldaten inmitten provisorischer und fragiler Architekturen platziert, erinnert sie uns daran, dass Krieg niemals wirklich vorbei ist und dass Frieden immer prekär bleibt.
Beauvoir schrieb, dass “das Drama der Frau in dem Konflikt zwischen dem grundlegenden Anspruch jedes Subjekts, sich immer als das Wesentliche zu setzen, und den Anforderungen einer Situation besteht, die sie als unwesentlich konstruiert”. Genzken, als Frau und Künstlerin in einer von Männern dominierten Umgebung, musste diesen Konflikt während ihrer gesamten Karriere navigieren. Ihre Werke können als beharrliche Bestätigungen ihrer wesentlichen Subjektivität gegenüber einer Welt gelesen werden, die versucht, sie zu marginalisieren.
Doch Genzken geht über die einfache Identitätspolitik hinaus. Ihre Arbeit lässt sich nicht auf ihre Position als Künstlerin reduzieren, so wenig wie der Existentialismus auf eine Theorie über isolierte Individuen reduzierbar ist. Vielmehr handelt es sich um eine Erforschung der Intersubjektivität, wie wir immer in Beziehung zu anderen und der materiellen Welt existieren, die wir teilen.
Die Serie “New Buildings for Berlin” (2001, 2006) bietet ein perfektes Beispiel für diese relationale Reflexion. Diese fantasievollen Architekturmaßstäbe mit ihren leuchtenden Farben und unerreichbaren Formen sind nicht einfach Kritiken der modernen Stadtplanung. Sie schlagen alternative Visionen vor, utopische Möglichkeiten, die existieren könnten, wenn wir den Mut hätten, unsere gebaute Umwelt radikal neu zu denken.
Der Existentialismus ermutigt uns, alternative Zukünfte zu imaginieren und anzuerkennen, dass die Welt auch anders sein könnte, als sie ist. Genzken lädt uns mit ihren unmöglichen Architekturen und unwahrscheinlichen Assemblagen zu dieser radikalen Vorstellungskraft ein. Sie zeigt uns, dass wir selbst in einer Welt, die mit vorgefertigten Objekten und auferlegten Strukturen gesättigt ist, noch Neues, Unerwartetes und Transformatives schaffen können.
In dieser Arbeit liegt eine Freude, eine Jubelgesang im chaotischen Zusammenfügen, der dem stereotypischen Bild des Existentialismus als düstere und pessimistischen Philosophie widerspricht. Ja, Genzken erkennt die Absurdität und Kontingenz unserer materiellen Existenz an, aber sie findet auch eine kreative Freiheit in dieser Anerkennung. Ihre Werke sind keine Monumente der Verzweiflung, sondern Feierlichkeiten der Möglichkeit.
Betrachten Sie ihre “Rose II” (2007), diese überdimensionale Stahlblume, die stolz vor dem New Museum in New York stand. Es ist ein Werk, das sowohl die Künstlichkeit umarmt, niemand würde diese Metallstruktur mit einer echten Rose verwechseln, als auch die transzendente Schönheit. Es erinnert uns daran, dass wir selbst in einer Welt voller hergestellter Objekte noch bewegt werden können, noch etwas fühlen können, das über das Nützliche und Kommerzielle hinausgeht.
Sartre sagt uns, dass wir das sind, was wir aus dem machen, was man aus uns gemacht hat. Genzken nimmt die Trümmer unserer materiellen Kultur, Wegwerfgegenstände, Baumaterialien, Modeaccessoires und macht daraus etwas Neues, etwas, das seine Ursprünge transzendiert, sie aber gleichzeitig anerkennt. Es ist eine Form existenzieller Alchemie, die die Banalität in Bedeutung verwandelt.
In einer Zeit, in der Kunst zunehmend als Ware, als finanzielle Investition oder als Statussymbol behandelt wird, bleibt Genzkens Werk hartnäckig unregierbar. Ihre Skulpturen verweigern es, auf passive Betrachtungsobjekte oder Demonstrationen technischer Virtuosität reduziert zu werden. Vielmehr verlangen sie eine Form existenziellen Engagements, eine Anerkennung, dass wir alle in dieselben komplexen und oft widersprüchlichen Systeme eingebunden sind, die sowohl funkelnde Wolkenkratzer als auch Berge von Plastikmüll hervorbringen.
Der Existentialismus lehrt uns, dass Authentizität aus der ehrlichen Anerkennung unserer Situation und einer bewussten Wahl darüber entsteht, wie wir auf diese Situation reagieren. Genzken, konfrontiert mit dem materiellen und ideologischen Chaos des späten 20. und frühen 21. Jahrhunderts, entscheidet sich nicht, sich davon abzuwenden, sondern taucht vollständig hinein. Sie verwandelt dieses Chaos in eine unverwechselbare künstlerische Praxis, die einfache Formeln und vorgefertigte Lösungen ablehnt.
Ihr Widerstand, an einem wiedererkennbaren Stil festzuhalten, ihre Bereitschaft, das Scheitern und das Unverständnis zu riskieren, indem sie ständig neue Richtungen verfolgt, zeugt von einem tief existenzialistischen Verständnis künstlerischer Kreativität. Wie Camus uns erinnert, muss man sich Sisyphos glücklich in seiner endlosen Arbeit vorstellen. Ebenso scheint Genzken eine Befriedigung in der unmöglichen, aber notwendigen Aufgabe zu finden, dem Chaos unserer zeitgenössischen Welt Gestalt zu geben.
In einer von bekannten Künstlern und industrialisierten Studiopraktiken dominierten künstlerischen Landschaft bleibt Genzken eine einzigartige und unverwechselbare Stimme. Sie erinnert uns daran, dass Kunst nicht nur die Herstellung ästhetisch ansprechender oder konzeptuell kohärenter Objekte ist, sondern ein existenzielles Engagement mit den Materialien, Geschichten und Möglichkeiten, die uns umgeben.
Wenn der Existentialismus eine Philosophie ist, die unsere radikale Freiheit selbst angesichts der härtesten Einschränkungen betont, dann ist Genzken wahrhaftig eine existentialistische Künstlerin. Ihr Werk zeigt uns, wie kreative Freiheit selbst inmitten der erdrückendsten kulturellen Unordnung entstehen kann, wie neue Bedeutungen aus dem Müll des Massenkonsums geschmiedet werden können.
Während so viel zeitgenössische Kunst entweder den Marktkräften nachgibt oder ihnen mit vorhersehbarer und unwirksamer Kritik entgegentritt, findet Genzken einen dritten Weg. Sie akzeptiert die materielle Welt, wie sie ist, übersättigt mit Gegenständen, fragmentiert, oft absurd, weigert sich jedoch zu akzeptieren, dass dies das Ende der Geschichte sei. In jedem chaotischen Arrangement, jeder architektonischen Skulptur, jeder seltsam gekleideten Schaufensterpuppe bekräftigt sie die Möglichkeit eines neuen Sinns, einer neuen Beziehung, einer neuen Perspektive.
Und ist das nicht das Herzstück des Existentialismus? Nicht die Verzweiflung angesichts der Absurdität, sondern die Anerkennung, dass gerade diese Absurdität unsere Sinnschöpfung so bedeutsam macht. In einem vorbestimmten Universum wäre Kunst nur eine Illustration vorbestehender Wahrheiten. In der kontingenten und offenen Welt, die uns der Existentialismus präsentiert, wird Kunst zu einem wesentlichen Akt der Sinnschöpfung.
Isa Genzken, mit ihrer Ablehnung von einfachen Formeln und dem Willen, sich dem materiellen Chaos, das uns umgibt, zu stellen, verkörpert dieses existentialistische Verständnis von Kunst. Ihr Werk erinnert uns daran, dass wir selbst unter den verwirrendsten Umständen immer die Freiheit haben zu erschaffen, zu transformieren, dem scheinbar Sinnlosen eine neue Bedeutung zu geben.
Also wenn Sie das nächste Mal einer ihrer aus dem Gleichgewicht geratenen Skulpturen oder einem ihrer chaotischen Assemblagen gegenüberstehen, versuchen Sie nicht einfach zu verstehen, was das Werk “bedeutet”. Fragen Sie sich vielmehr, wie es Sie einlädt, Ihre eigene Beziehung zur materiellen Welt neu zu überdenken, wie es Sie herausfordert, die Gegenstände um Sie herum anders zu sehen, wie es Sie ermutigt, neue Möglichkeiten in dem zu imaginieren, was bereits bestimmt scheint.
Denn genau hier, in dieser Einladung zu einer neuen Wahrnehmung, zu einer neuen Beziehung, liegt die wahre existentialistische Kraft von Genzkens Arbeit. Sie zeigt uns, dass wir selbst in unserer übermedialisierten und hyperkommerzialisierten Welt noch Momente echter Freiheit finden können, Gelegenheiten, dort Bedeutung zu schaffen, wo es nur Lärm zu geben schien.
Also ja, bewundern Sie die technische Virtuosität ihrer frühen Holzskulpturen, schätzen Sie die Kühnheit ihrer jüngsten Assemblagen, aber vergessen Sie nicht, dass das, was diese scheinbar disparaten Werke verbindet, eine konstante Auseinandersetzung mit unserer existenziellen Situation in einer sich ständig wandelnden materiellen Welt ist. Isa Genzken ist nicht nur eine Bildhauerin oder Assemblage-Künstlerin, sie ist eine visuelle Philosophin, die Objekte, Raum und unsere eigene Wahrnehmung nutzt, um uns die grundlegendsten Fragen über unser Sein in der Welt zu stellen.
Und in einer Kunstlandschaft, die zu oft von Zynismus oder leerem Spektakel dominiert wird, ist diese aufrichtige existenzielle Befragung ebenso erfrischend wie notwendig. Danke, Isa Genzken, dass Sie uns daran erinnern, dass Kunst immer noch eine Frage von Leben und Tod, von Sinn und Absurdität, von Freiheit und Zwängen sein kann, kurz gesagt, eine Frage der menschlichen Existenz in all ihrer chaotischen und wunderbaren Komplexität.