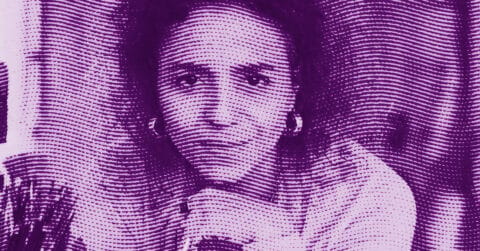Hört mir gut zu, ihr Snobs, in der Welt von Izumi Kato (1969) gibt es etwas zutiefst Verstörendes. Seine Kreaturen mit leeren Augen, die uns mit beunruhigender Intensität von ihren Gemälden und Sockeln aus beobachten, bewohnen einen Zwischenraum zwischen zwei Welten. Sie sind nicht nur künstlerische Figuren, sondern Präsenzformen, die uns unserer eigenen Fremdheit und unserer tief ambivalenten Natur als zugleich natürliche und künstliche Wesen gegenüberstellen.
Während sich die zeitgenössische Kunst oft in sterilen Konzeptspielereien verliert, beeindruckt Katos Werk durch seine tellurische Kraft und seine viszerale Authentizität. Seine embryonalen Kreaturen, weder ganz menschlich noch vollständig anders, tragen eine existentielle Ladung in sich, die ihre scheinbare Simplizität übersteigt. Sie führen uns zurück zu etwas Grundlegendem, Archaischem, während sie zugleich entschieden im Hier und Jetzt verankert sind.
Ich kann nicht anders, als an das zu denken, was Martin Heidegger das “Entbergen des Seins” nannte, wenn ich diesen anthropomorphen Figuren begegne. Diese Wesen mit ihren bulbusartigen Köpfen und schlanken Gliedmaßen stellen uns der Essenz dessen gegenüber, was es bedeutet, in einer Welt zu existieren, in der die Technologie unsere ursprüngliche Verbindung zur Natur überlagert hat. Katos Entscheidung, direkt mit seinen gummibehandschuhten Händen zu malen und die Vermittlung durch den Pinsel abzulehnen, resoniert tief mit Heideggers Kritik an der modernen Technik als einem Hindernis zwischen dem Menschen und seinem authentischen Verhältnis zur Welt.
Diese taktile Herangehensweise an die Schöpfung ist nicht bloß eine von vielen Techniken. Sie bildet das Fundament seiner künstlerischen Praxis, eine Methode, die es ihm ermöglicht, einen direkten, fast schamanischen Kontakt mit dem Material herzustellen. Wenn Kato die Farbe mit den Fingern aufträgt, geht es nicht nur darum, Textur- oder Materialeffekte zu erzeugen. Es ist ein Akt, der fast einem Ritual ähnelt, eine Weise, Präsenz durch physischen Kontakt mit der Leinwand heraufzubeschwören.
Katos Praxis ist auch eingebettet in eine Reflexion, die den Theorien von Maurice Merleau-Ponty zur Phänomenologie der Wahrnehmung entspricht. Seine Skulpturen aus Kampferholz, bei denen die Meißelspuren als Narben auf der Oberfläche sichtbar bleiben, erinnern uns daran, dass unser Verhältnis zur Welt vor allem leibhaftig, taktil und verkörpert ist. Die Abdrücke seiner Finger auf der Leinwand, die sichtbaren Gelenke seiner Skulpturen, all dies trägt zu jener Ästhetik des direkten Kontakts bei, die sein Werk kennzeichnet.
Was mich an Katos Arbeit besonders interessiert, ist, dass er einen subtilen und komplexen Dialog zwischen Tradition und Gegenwart schafft. Ursprünglich aus der Präfektur Shimane, einer Region Japans, in der der shintoistische Animismus tief in der lokalen Kultur verwurzelt ist, schöpft der Künstler aus diesem Erbe und erfindet es gleichzeitig radikal neu. Seine Kreaturen sind keine traditionellen Yokai, sondern eher Manifestationen einer zeitgenössischen Spiritualität, die versucht, sich in einer entzauberten Welt neu zu erfinden.
Katos Verwendung der Materialien ist besonders aufschlussreich für diese Spannung zwischen Alt und Modern. Nehmen Sie zum Beispiel seine ab 2012 entstandenen Skulpturen aus flexiblem Vinyl. Dieses Material, das typischerweise bei der Herstellung von Spielzeug verwendet wird, wird in seinen Händen zum Medium eines Ausdrucks, der an primitive Idole erinnert. Es gibt etwas zutiefst Beunruhigendes an diesen Figuren, die aus einer unvergänglichen Vergangenheit zu stammen scheinen und dennoch offensichtlich von unserer Industriegesellschaft produziert wurden.
Diese Dualität spiegelt sich auch in seiner Art und Weise wider, den Raum zu behandeln. Katos jüngste Installationen schaffen Umgebungen, die wie zeitgenössische Heiligtümer funktionieren. Wenn er seine Kreaturen von der Decke hängen lässt, wie bei seiner bedeutenden Ausstellung in der Galerie Perrotin New York im Jahr 2021, verwandelt er den Galerieraum in einen rituellen Ort, an dem seine schwebenden Figuren die Ausführenden einer Zeremonie sind, deren Codes wir nicht kennen. Gerade in dieser Spannung zwischen dem Heiligen und dem Profanen findet seine Arbeit ihre größte Kraft.
Der Künstler geht noch weiter in dieser Erforschung der Widersprüche unserer Zeit durch die Verwendung von Fundmaterialien. Die Steine, die er in der Nähe seines Studios in Hongkong sammelt, werden zu Bestandteilen zusammengesetzter Skulpturen, bei denen das rohe Material mit zeitgenössischen Textilien in Dialog tritt. Diese Zusammenstellungen schaffen unerwartete Brücken zwischen der natürlichen Welt und dem industriellen Universum, wie Totems für unser anthropozänes Zeitalter.
In einem besonders beeindruckenden Werk, das während seiner Ausstellung “LIKE A ROLLING SNOWBALL” im Hara Museum of Contemporary Art präsentiert wurde, kombiniert Kato einen rohen Stein mit einem synthetischen Textil, um eine Figur zu schaffen, die aus einer Zwischenwelt zu entspringen scheint. Der Stein, ein Ur-Element par excellence, wird durch seine Verbindung mit dem industriellen Stoff transformiert und erzeugt eine visuelle Spannung, die die Paradoxien unserer Zeit perfekt zusammenfasst.
Die bewusste Entscheidung des Künstlers, seine Werke unbetitelt zu lassen, ist kein Zufall. Sie zwingt uns, unsere Kategorisierungsreflexe aufzugeben und uns direkt dem Rätsel ihrer Präsenz zu stellen. Diese namenlosen Kreaturen blicken uns mit ihren leeren Augen an und laden uns zu einer Begegnung ein, die jenseits der Sprache stattfindet, in einem Raum, in dem Worte ihre definierende und kontrollierende Macht verlieren.
Diese Strategie des Unbenannten ist Teil eines größeren Ansatzes, der darauf abzielt, das Werk in einem Zustand maximaler Offenheit zu bewahren. Katos Figuren widerstehen jeder endgültigen Interpretation, sie schweben in einem Raum der Unbestimmtheit, der sie umso kraftvoller macht. Wie Robert Storr, der Kurator, der seine Arbeit 2007 für die Biennale von Venedig entdeckte, betonte, besitzen diese Werke eine “abrasive” Qualität, die sie von der üblichen japanischen Kunstproduktion unterscheidet.
Ich kann nicht anders, als in diesem Ansatz eine faszinierende Parallele zu Walter Benjamins Gedanken über die Aura des Kunstwerks im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit zu sehen. Katos Kreaturen bewahren, selbst wenn sie wie seine Vinylskulpturen in Serie produziert werden, eine mysteriöse Aura, die der mechanischen Reproduktion trotzt. Jede von ihnen scheint eine einzigartige Präsenz in sich zu tragen, die auf ihre Materialität nicht reduzierbar ist.
Diese Präsenz ist besonders spürbar in seinen großen Gemälden, in denen die Figuren wie Erscheinungen aus einem abstrakten Hintergrund zu entstehen scheinen. Die häufige Unterteilung der Leinwand in unterschiedliche chromatische Abschnitte schafft komplexe mentale Räume, in denen die Wesen zwischen verschiedenen Bewusstseinszuständen zu schweben scheinen. Diese malerische Strategie ruft die Überlegungen von Gilles Deleuze zur Malerei von Francis Bacon ins Gedächtnis, einem Künstler, den Kato übrigens zu seinen Einflüssen zählt.
Die jüngsten Werke des Künstlers zeigen eine faszinierende Entwicklung seiner Praxis. Die Figuren gewinnen an struktureller Komplexität, ohne ihre primitive Kraft zu verlieren. Die Assemblagen verschiedener Materialien erschaffen hybride Wesen, die scheinbar körperlich die Widersprüche unserer Zeit verkörpern. Diese Komplexifizierung seiner bildnerischen Sprache geht einher mit einer immer ausgefeilteren Reflexion über die Natur des Bildes und der Darstellung.
In seinen letzten Installationen erkundet Kato neue Wege, den Raum zu aktivieren. Seine Kreaturen sind nicht mehr nur Objekte der Betrachtung, sondern werden zu Akteuren einer Inszenierung, die den Ausstellungsraum in ein metaphysisches Theater verwandelt. Das Spiel von Licht und Schatten, die Anordnung der Werke im Raum, alles trägt dazu bei, eine immersive Erfahrung zu schaffen, die uns in ein paralleles Universum eintauchen lässt.
Der Künstler entwickelt außerdem eine immer tiefere Reflexion über den Begriff der Serie und Variation. Seine Figuren sind zwar immer erkennbar, unterliegen aber subtilen Metamorphosen, die sie zwischen verschiedenen Sein-Zuständen schwanken lassen. Diese systematische Erforschung formaler Möglichkeiten erinnert an Morandis Studien zur Stilllebenmalerei, jedoch übertragen in ein fantastisches und unheimliches Register.
Was Katos Arbeit heute besonders relevant macht, ist, dass sie uns zugleich unsere Entfremdung und unsere tiefe Verbundenheit mit der Welt um uns spüren lässt. Seine Kreaturen sind wie verzerrte Spiegel, die uns ein Bild unserer Menschlichkeit zurückwerfen, das zugleich vertraut und fremd ist. In einer Welt, in der uns die Technologie eine entkörperlichte Transzendenz verspricht, erinnert uns Kato beharrlich an unseren Zustand als verkörperte Wesen, die durch geheimnisvolle Bindungen mit der Erde verbunden sind.
Die wiederholte Verwendung organischer Materialien wie Holz und Stein, kombiniert mit industriellen Elementen, erzeugt eine fruchtbare Spannung, die mit den zeitgenössischen ökologischen Anliegen resoniert. Katos Kreaturen scheinen die Erinnerung an eine vorindustrielle Welt in sich zu tragen, während sie zugleich fest in unserer technologischen Gegenwart verankert sind. Sie erinnern uns daran, dass auch wir selbst hybride Wesen sind, Produkte einer langen natürlichen und kulturellen Geschichte.
In Katos Arbeit steckt etwas, das sich hartnäckig der Versuchung der Nostalgie widersetzt. Seine Kreaturen sind keine Überbleibsel einer idealisierten Vergangenheit, sondern lebendige Präsenz, die uns hier und jetzt herausfordert. Sie erinnern uns daran, dass das Primitive nicht hinter uns liegt, sondern in uns, dass das Heilige nicht verschwunden ist, sondern sich verwandelt hat, und dass es nicht unsere Aufgabe ist, eine verlorene Reinheit wiederzufinden, sondern neue Formen der Beziehung zur Welt zu erfinden.
Diese prospektive Dimension seiner Arbeit wird besonders deutlich in seinen Experimenten mit synthetischen Materialien. Das flexible Vinyl wird zum Beispiel nicht ironisch oder kritisch verwendet, sondern als authentisches Material, das seine eigenen Ausdrucksmöglichkeiten trägt. Kato gelingt es, ihm eine unerwartete Würde zu verleihen und es zum Medium einer neuen Form des Heiligen zu machen, die zu unserer Zeit passt.
Die neuesten Installationen des Künstlers treiben diese Reflexion über unser Verhältnis zum Heiligen in einer entheilten Welt noch weiter voran. Indem er immersive Umgebungen schafft, in denen seine Kreaturen den Raum wie gespenstische Präsenz zu bewohnen scheinen, lädt Kato uns ein, unsere Beziehung zum Unsichtbaren und zum Geheimnis neu zu überdenken. Diese Räume funktionieren als Kontaktzonen zwischen verschiedenen Dimensionen der Realität, Orte, an denen das Alltägliche und das Geheimnisvolle sich treffen und gegenseitig beeinflussen.
Die Kraft von Katos Werk liegt in seiner Fähigkeit, diese verschiedenen Dimensionen in Spannung zu halten, ohne sie je in einer einfachen Synthese aufzulösen. Seine Kreaturen bleiben rätselhaft und widerstehen jedem Versuch, sie auf eine eindeutige Bedeutung zu reduzieren. Sie erinnern uns daran, dass die kraftvollste Kunst jene ist, die die Spannung zwischen Sichtbarem und Unsichtbarem, zwischen Materiellem und Spirituellem, zwischen dem, was wir wissen, und dem, was wir niemals vollständig verstehen können, lebendig erhält.
Katos Werk stellt uns eine grundlegende Frage: Wie kann man poetisch in einer entzauberten Welt wohnen? Seine Kreaturen, gleichzeitig primitiv und futuristisch, natürlich und künstlich, schlagen uns einen möglichen Weg vor: nicht die unmögliche Rückkehr zu einem mythischen Ursprung oder die Flucht in eine technologische Zukunft, sondern die geduldige Erfindung neuer Formen der Präsenz in der Welt, neuer Weisen, zusammen zu sein, Menschen und Nicht-Menschen, in der geteilten Fremdheit unserer zeitgenössischen Existenz.