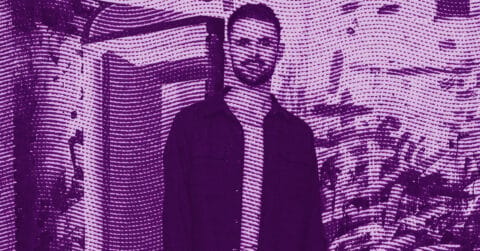Hört mir gut zu, ihr Snobs: Wenn ihr in der zeitgenössischen philippinischen Kunst noch diese postkoloniale Selbstzufriedenheit sucht, die viele asiatische Maler auszeichnet, die westlichen Galerien gefallen wollen, dann geht besser weiter. Jigger Cruz, geboren 1984 in Malabon City, wird euch weder den Komfort exotischer Nostalgie noch die Leichtigkeit einer vorhersehbaren Rebellion bieten. Dieser Maler, ausgebildet an der Far Eastern University und Schüler von Manuel Ocampo, hat sich als einer der relevantesten Künstler seiner Generation etabliert, indem er eine Form des Ikonoklasmus praktiziert, der eine ernsthafte Aufmerksamkeit verdient.
Cruz’ Praxis besteht im Wesentlichen darin, klassische Gemälde, Kopien flämischer Meister, Porträts in Renaissance-Manier, mit dicken Schichten Ölfarbe zu überdecken, die er direkt aus der Tube oder durch Spritztüten aufträgt. Das Ergebnis sind unruhige Oberflächen, Schichten leuchtender Farben, die das Originalbild fast vollständig auslöschen. Diese Technik, die manche schnell als Vandalismus bezeichnen würden, offenbart in Wirklichkeit ein scharfes Bewusstsein für das Gewicht der Geschichte in der zeitgenössischen künstlerischen Produktion. Cruz zerstört nicht aus anarchischem Zerstörungswillen; er erschafft eine visuelle Sprache über die Unmöglichkeit, dem westlichen Kanon zu entkommen, während er die Notwendigkeit betont, seine eigene Stimme darin zu verankern.
Um die Dringlichkeit von Cruz’ Geste zu verstehen, muss man auf die koloniale Geschichte der Philippinen und die schützende Figur von Juan Luna zurückblicken. Dieser philippinische Maler, der Ende des 19. Jahrhunderts in Europa ausgebildet wurde, verkörpert das Paradox des kolonialisierten Künstlers: von europäischen Institutionen anerkannt und auf Pariser Salons erfolgreich, bleibt Luna dennoch Gefangener eines Repräsentationssystems, das nicht seins ist. Sein Gemälde “La vie parisienne” (1892), heute im Nationalmuseum der Philippinen bewahrt, illustriert diese Ambivalenz perfekt [1]. Das Werk zeigt drei philippinische Männer: Luna selbst, José Rizal und Ariston Bautista Lin, die in einem Pariser Café eine Kurtisane beobachten. Diese drei Intellektuellen, zentrale Figuren der philippinischen Propagandabewegung für Unabhängigkeit, sind europäisch gekleidet und übernehmen die visuellen Codes der imperialen Metropole. Die Frau in der Mitte, oft als Metapher der philippinischen “Mutterheimat” interpretiert, bleibt passiv, Objekt des männlichen und kolonialen Blicks.
Dieses Gemälde verkörpert das Dilemma aller Künstler, die aus ehemals kolonialisierten Gebieten stammen: Wie kann man erschaffen, wenn die Werkzeuge der Schöpfung selbst, die Ölmalerei, die Perspektive, die Bildgattungen, dem Kolonisator gehören? Wie drückt man sich in einer Sprache aus, die weder für einen selbst noch von einem selbst entwickelt wurde? Luna wählte die brillante Assimilation, beherrschte die europäischen akademischen Techniken so gut, dass er viele seiner europäischen Zeitgenossen übertraf. Doch dieser Erfolg bleibt ambivalent, denn er setzt die Akzeptanz der ästhetischen Kriterien des Kolonisators voraus. Cruz, mehr als ein Jahrhundert nach Luna, bietet eine radikal andere Antwort. Indem er diese akademischen Gemälde mit roher Materie überzieht, die Gesichter und klassischen Landschaften unter Spritzern reiner Farbe verborgen hält, verweigert er die Schuld. Er versucht nicht zu beweisen, dass ein Philippiner genauso gut malen kann wie ein Europäer; er behauptet, dass diese Frage an sich nicht mehr gestellt werden muss.
Die Geste von Cruz lässt sich als eine Art “aggressive Archäologie” der Malerei beschreiben. Jedes seiner Gemälde bewahrt die Spuren des Originalbildes, manchmal durchscheinend sichtbar, manchmal völlig vergraben. Diese malerische Stratigraphie funktioniert als Metapher für die koloniale Geschichte der Philippinen: westliche Bezüge bleiben präsent, unentbehrlich, diktieren aber nicht mehr den letzten Sinn des Werkes. Die leuchtenden Farben, die Cruz übereinanderlegt, grelles Rosa, giftiges Grün und toxisches Gelb, schaffen eine neue visuelle Erzählung, die keine Zustimmung vom Zentrum mehr erwartet. Es handelt sich hier nicht um einen Neuanfang auf leerem Blatt, sondern um eine gewaltsame, bewusste und begeisterte Umschreibung.
Der Künstler selbst erkennt die implizite politische Dimension seiner Arbeit an. Auf die Frage nach seiner Praxis erklärt er: “Ich versuche einfach, über all das zu scherzen, mich mit der Kunstgeschichte zu verbinden, aber auch eine neue Szene und eine neue Oberfläche zu schaffen, um sie aus einer anderen Perspektive zu betrachten” [2]. Dieser “Scherz” darf nicht auf die leichte Schulter genommen werden. Er offenbart eine Subversionsstrategie, die durch Humor und Spott vermittelt wird, statt durch reine theoretische Diskurse. Cruz weigert sich, sich als Opfer der Geschichte zu positionieren; er wird zum spielerischen Manipulator, der die Last der Vergangenheit in formbares Material verwandelt.
Nun ist die zweite Denkrichtung zu betrachten, die Cruz’ Werk nahelegt: die philosophische Frage der schöpferischen Zerstörung. Hier denkt man unweigerlich an Friedrich Nietzsche und dessen fulminante Formel aus „Zur Genealogie der Moral”: “Damit ein Tempel errichtet wird, muss ein Tempel zerstört werden” [3]. Dieser Satz fasst die Logik in Cruz’ Praxis perfekt zusammen. Der deutsche Philosoph sprach nicht von einfachem nihilistischem Ikonoklasmus, sondern von einer ontologischen Notwendigkeit: Jede wirkliche Schöpfung verlangt die vorherige Zerstörung alter Werte. Man baut nicht auf dem Nichts, man baut auf Ruinen.
Cruz wendet dieses Prinzip buchstäblich auf die Malerei an. Seine Gemälde sind keine reinen Abstraktionen, die aus dem Nichts auftauchen; sie sind gewaltsame Zeugnisse, bei denen das Alte gleichzeitig ausgelöscht und erhalten wird. Diese Spannung zwischen Präsenz und Abwesenheit, zwischen Zerstörung und Konstruktion verleiht seiner Arbeit eine konzeptuelle Dichte, die sie vom amerikanischen abstrakten Expressionismus unterscheidet, mit dem man sie zu schnell in Verbindung bringen könnte. Während Jackson Pollock oder Willem de Kooning versuchten, die Malerei von jeglicher äußerer Referenz zu befreien, hält Cruz die Referenz absichtlich unter der Oberfläche. Die Geschichte der westlichen Kunst bleibt sichtbar, aber wie ein Geist, ein Gespenst, das ständig beschworen werden muss, um voranzukommen.
Die nietzscheanische Dimension dieser Arbeit geht über die bloße Metapher der Zerstörung hinaus. Sie berührt die Frage des Wertes selbst. Was macht den Wert eines Gemäldes aus? Seine technische Fertigkeit? Seine Fähigkeit, die Realität getreu zu reproduzieren? Seine Stellung in einer anerkannten Tradition? Cruz wischt diese Kriterien mit einer schnellen Bewegung des Spritzrohres vom Tisch. Indem er Kopien flämischer Meister übermalt, Gemälde, die bereits jeglicher Originalität entbehren, da es Kopien sind, stellt er die Authentizitätsfrage, die den westlichen Kunstmarkt begründet, frontal in Frage. Wird eine mit gestischer Malerei überdeckte Kopie authentischer als die Kopie selbst? Hat die ikonoklastische Geste von Cruz einen höheren Wert als die Fertigkeit des Kopisten?
Diese Fragen sind keine bloßen intellektuellen Spielereien. Sie berühren das Herz dessen, was es bedeutet, Künstler in einem postkolonialen Kontext zu sein. Der zeitgenössische philippinische Künstler kann die koloniale Geschichte seines Landes nicht ignorieren, ebenso wenig kann er vorgeben, in einem kulturellen Vakuum zu schaffen. Doch er darf sich auch nicht von dieser Geschichte lähmen lassen. Cruz’ Lösung besteht darin, die Gewalt seiner Geste voll und ganz anzunehmen: ja, er zerstört; ja, er übermalt; ja, er radiert aus. Aber gerade weil er bewusst und methodisch zerstört, schafft er die Voraussetzungen für eine echte Neuerung.
Die jüngste Entwicklung seiner Praxis bestätigt diese Deutung. Auf der Art Fair Philippines 2024 präsentierte Cruz stark reduzierte Werke. Weniger Schichten, weniger Farben, vereinfachte geometrische Formen. Der Künstler erklärt: “Ich habe das alles überwunden. Ich muss niemandem gefallen… Wenn man jung ist, muss man arrogant sein. Aber es war auch richtig, diese Phase, diesen Wachstumsprozess zu durchlaufen” [4]. Diese Aussage offenbart eine künstlerische Reife, die die Radikalität nicht preisgibt, sondern verlagert. Cruz gibt sein Dekonstruktionsprojekt nicht auf; er vollendet es nun mit sparsamerem Einsatz der Mittel, was paradoxerweise dessen Kraft verstärkt.
Die Farbe ist bei Cruz besonders interessant. Farbenblind nimmt er Töne anders wahr als die meisten Betrachter. Diese physiologische Besonderheit wird zum strategischen Vorteil: Befreit von chromatischen Konventionen kann er Farben nebeneinanderstellen, die das “normale” Auge als disharmonisch empfinden würde. Seine Grüntöne und Violettnuancen, die er nicht unterscheidet, erzeugen unerwartete visuelle Spannungen. Diese Unfähigkeit wird zur Fähigkeit, verwandelt eine vermeintliche Behinderung in ein stilistisches Markenzeichen. Wieder einmal kehrt Cruz das Stigma in kreative Kraft um.
Es muss auch die materielle, fast fetischistische Dimension seines Ansatzes erwähnt werden. Cruz malt nicht einfach nur; er formt die Farbe, schafft dicke Reliefs, die über den Rahmen hinausragen, die Leisten überfluten und das Bild in ein dreidimensionales Objekt verwandeln. Diese Betonung der rohen Materialität der Farbe, ihrer Textur, ihres Gewichts und ihrer physischen Präsenz kontrastiert heftig mit der zunehmenden Entmaterialisierung der zeitgenössischen Kunst. In einer Zeit, in der digitale Kunst und NFTs vorgeben, die Leinwandmalerei obsolet zu machen, bekräftigt Cruz die Sinnlichkeit des malerischen Materials. Seine Werke riechen, wiegen schwer, sind pastos. Sie widersetzen sich der fotografischen Reproduktion und verlangen eine direkte physische Auseinandersetzung.
Der Werdegang von Cruz, vom ehrgeizigen jungen Maler zum Familienvater, der Einfachheit und Ehrlichkeit sucht, illustriert auch eine implizite Kritik am Mythos des gequälten Künstlers. Zu oft wertet der Kunstmarkt Leiden, Angst und Tragik auf. Cruz hingegen beansprucht nun eine Form von Leichtigkeit und wiedergefundener Unschuld. Seiner Tochter beim Zeichnen von Kreisen und Dreiecken zuzusehen, erinnerte ihn daran, dass Schöpfung freudig, spontan und frei von theoretischer Last sein kann. Diese Entwicklung bedeutet nicht, die kritische Dimension seiner Arbeit aufzugeben, sondern eher eine Verschiebung: Kritik erfolgt nicht mehr durch das demonstrative Auftragen von Farbschichten, sondern durch die Präzision der minimalen Geste.
Das Werk von Jigger Cruz zwingt uns, die Beziehungen zwischen Zentrum und Peripherie in der globalisierten zeitgenössischen Kunst neu zu überdenken. Er lehnt sowohl selbstgefälligen Exotismus als auch bloße Imitation westlicher Modelle ab. Seine Lösung, Überdecken, Unkenntlichmachen und Neuaufbauen, ist weder eine harmonische Synthese noch eine reine Ablehnung, sondern ein Transformationsakt, bei dem die koloniale Geschichte zum Baumaterial wird und nicht zur lähmenden Last. Die Tempel der westlichen Kunstgeschichte werden auf seinen Leinwänden zerstört, doch ihre Ruinen bilden das Fundament neuer Gebäude. Diese Dialektik von Zerstörung und Schöpfung stellt Cruz ins Zentrum der zeitgenössischen Debatten über kulturelle Identität, Postkolonialität und künstlerische Autonomie. Seine Arbeit beweist, dass ein Künstler tief in seinem nationalen Kontext verwurzelt sein und dennoch eine universelle Sprache sprechen kann, dass er das koloniale Erbe annehmen kann, ohne sich ihm zu unterwerfen, und dass er methodisch zerstören kann, um mit Freiheit besser zu gestalten. In einer Zeit, die von Diskursen über die Dekolonisierung der Imaginationen gesättigt ist, bietet Cruz eine plastische, materielle und unbestreitbar wirksame Antwort: immer wieder drüber zu malen, bis das Originalbild unleserlich wird und endlich etwas unwiderstehlich Neues entsteht.
- Juan Luna, „La vie parisienne”, auch bekannt unter dem Titel „Intérieur d’un café”, 1892, Öl auf Leinwand, Nationalmuseum der Schönen Künste, Manila, Philippinen.
- Jigger Cruz, zitiert in Quiet Lunch Magazine, 2018.
- Friedrich Nietzsche, „Zur Genealogie der Moral”, 1887.
- Jigger Cruz, zitiert in The Nation Thailand, 2024.