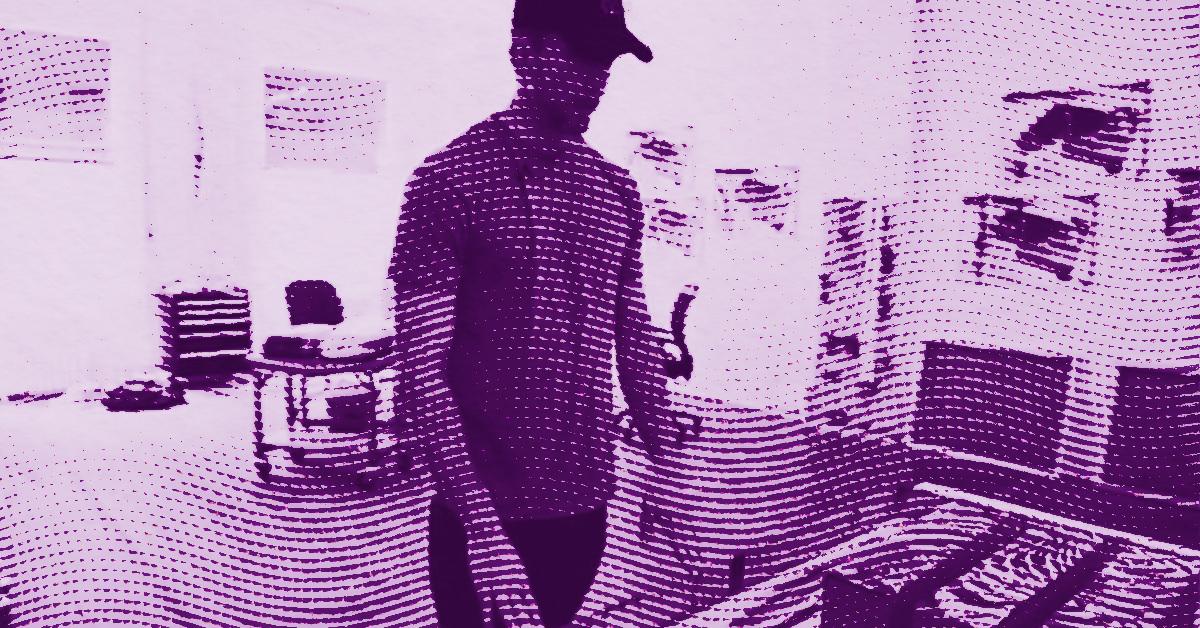Hört mir gut zu, ihr Snobs: Kelley Walker ist nicht nur ein weiterer zeitgenössischer amerikanischer Künstler, der mit der Aneignung von Bildern spielt. Er verkörpert eine Künstlergeneration, die im giftigen Ozean unserer Medienkultur navigiert, bewaffnet mit Scannern, Siebdruckrahmen und einem scharfen Bewusstsein für die perversen Mechanismen des Kapitalismus. Geboren 1969 gehört Walker zu der Kohorte, die mit der Explosion der Massenmedien und dem Aufkommen der Digitalisierung aufgewachsen ist, einer historischen Periode, in der Bilder exponentiell zu proliferieren begannen und allmählich ihren referenziellen Anker verloren, um reine Zirkulation zu werden.
Walkers Werk basiert auf einer einfachen, aber äußerst effektiven These: Was wird ein Bild, wenn es durch industrielle Reproduktionskreisläufe geht? Wie verwandeln sich kulturelle Zeichen in Waren und umgekehrt? Seine bekanntesten Serien, Black Star Press, Schema oder auch seine Spiegel-Rorschach, sind Versuche zur Materialität der Bilder und deren Zirkulation in der zeitgenössischen symbolischen Ökonomie.
In Black Star Press (2004-2005) greift Walker ein ikonisches Foto der Bürgerrechtsbewegung auf: jenes von Bill Hudson aus dem Jahr 1963 in Birmingham, das einen jungen schwarzen Demonstranten, Walter Gadsden, zeigt, wie er von einem Polizeihund angegriffen wird. Dieses Bild, das bereits von Andy Warhol in seinen Race Riot von 1963-1964 verwendet wurde, wird von Walker einer Reihe von Manipulationen unterzogen: Drehung, Umkehrung, Siebdruck in Coca-Cola-Farben und vor allem Überziehung mit mechanisch reproduzierten Schokoladengüssen (weiß, Vollmilch, dunkel). Die Geste ist nicht zufällig: Sie hinterfragt, wie die Geschichte der amerikanischen Rassismusgewalt abgemildert, “schokoladisiert” und zu einem konsumierbaren Produkt gemacht wird.
Die Serie Schema (2006) folgt einer ähnlichen Logik, verlegt das Feld jedoch auf die Sexualisierung schwarzer Frauenkörper. Walker verwendet Cover des Männermagazins King, auf denen schwarze Frauen in konventionellen erotischen Posen gezeigt werden, die er mit eingescannten und digital integrierten Zahnpastaspuren überzieht. Der Bezug zur Mundhygiene ist nicht zufällig: Er ruft sowohl Sauberkeit und Bleichen hervor als auch, als metaphorische Erweiterung, aseptische Medienprozesse.
Institutionelle Kritik als ästhetisches Programm
Walkers Ansatz ist Teil einer kritischen Tradition, die ihren Ursprung in der Konzeptkunst der 1960er- und 1970er-Jahre hat, sich jedoch durch das Bewusstsein für die Veränderungen des zeitgenössischen Kapitalismus auszeichnet. Im Gegensatz zu Künstlern der klassischen institutionellen Kritik beschränkt sich Walker nicht darauf, die Mechanismen der Kunstwelt zu kritisieren; er integriert sie in seine Praxis, schafft eine Kunst, die gleichzeitig als Ware und als Kritik der Kommerzialisierung funktioniert.
Diese ambivalente Haltung findet ihren vollendeten Ausdruck in seinen auf CD-ROM verbreiteten Werken, begleitet von der Anweisung, dass der Käufer die Bilder nach Belieben verändern, reproduzieren und verbreiten darf. Walker radikalisiert damit die Warenlogik bis zur Absurdität: Der Kunde wird zum Co-Produzenten, das Werk vervielfältigt sich ins Unendliche, das künstlerische Eigentum verflüchtigt sich. Diese Strategie erinnert an die Analysen, die Guy Debord in Der Gesellschaft des Spektakels [1] entwickelte, wo er zeigte, wie der fortgeschrittene Kapitalismus jede Erfahrung in ein konsumierbares Bild verwandelt. Bei Walker wird diese spektakuläre Logik bis zu ihrem Zerreißpunkt getrieben und offenbart ihre inneren Widersprüche.
Der amerikanische Künstler beschränkt sich nicht auf Kritik; er führt die Warenlogik selbst vor. Seine Objekt-Skulpturen, wie seine goldenen Medaillons in Form des Recyclingsymbols oder seine spiegelnden Rorschach-Bilder, funktionieren wie Luxusprodukte und offenbaren gleichzeitig die Mechanismen des Begehrens und der Projektion, die sie aktivieren. Der Betrachter wird in ein System eingebunden, das ihn zugleich als Voyeur, Konsumenten und Komplizen konstituiert.
Diese Strategie der “Überidentifizierung”, um einen Begriff von Slavoj Žižek zu verwenden, erlaubt es Walker, die Widersprüche des Systems aufzuzeigen, ohne sich in eine moralische Überlegenheitsposition zu begeben. Bei ihm gibt es keine Nostalgie nach einem goldenen Zeitalter der Kunst oder eine offene Kapitalismuskritik, sondern eher eine geduldige Erkundung der Grau- und Verhandlungsspielräume unserer Wünsche und Abneigungen.
Architektur des Gedächtnisses und Politik des Vergessens
Walkers Werk steht in ständigem Dialog mit der Geschichte der amerikanischen Kunst, jedoch auf eine besondere Weise, die an die Überlegungen des Historikers Pierre Nora zu den “Lieux de mémoire” erinnert. Bei Nora entstehen diese Erinnerungsorte gerade dann, wenn das lebendige Gedächtnis verschwindet, wenn künstlich das aufgebaut werden muss, was nicht mehr spontan existiert. Walker verfährt mit den Bildern ähnlich: Er holt sie aus dem Medienfluss hervor, genau in dem Moment, in dem sie zu vergessen drohen, doch diese Auferstehung geschieht durch ihre Verwandlung in ambivalente ästhetische Objekte.
Seine Anspielungen auf Warhol sind keine Hommage, sondern eine kritische Archäologie. Wenn Walker das von Warhol verwendete Foto von Birmingham aufgreift, versucht er nicht, dessen ursprüngliche politische Aufladung wiederherzustellen, sondern hinterfragt die Mechanismen, durch die diese Aufladung allmählich verblasst ist. Die Schokolade, die das Bild überzieht, funktioniert als subjektives Zeugnis: Sie verdeckt und enthüllt zugleich und schafft eine zeitliche Distanz, die es uns erlaubt, den Weg von den 1960er Jahren bis heute zu messen.
Diese Dialektik von Erinnerung und Vergessen durchzieht sein gesamtes Werk. In seiner Serie Disasters (2002) macht sich Walker Bilder von Katastrophen zueigen, die in den fotografischen Kompilationen von Time-Life veröffentlicht wurden, und überzieht sie mit Farbpunkten, die an die Gemälde von Larry Poons erinnern. Diese Punkte fungieren als visuelle “Verschlüsse”, die das Bild nahezu unleserlich machen und gleichzeitig die Aufmerksamkeit darauf lenken. Die Katastrophe wird zum dekorativen Motiv, aber gerade dieser Prozess offenbart unsere taube Beziehung zur medial vermittelten Gewalt.
Walkers Ansatz findet hier eine besondere Resonanz in den Arbeiten von Pierre Nora über die Umwandlung von Geschichte in Kulturerbe [2]. Wie der französische Historiker gezeigt hat, sind unsere zeitgenössischen Gesellschaften von Erinnerung besessen, gerade weil sie den direkten Kontakt mit ihrer Vergangenheit verloren haben. Walker scheint dieses Paradox visuell zu illustrieren: Seine Werke sind “Denkmäler” für im Verschwinden begriffene Bilder, aber Denkmäler, die die Künstlichkeit ihrer eigenen Konstruktion offenbaren.
Die erinnerungskulturelle Dimension seiner Arbeit erklärt, warum seine Werke solche Kontroversen ausgelöst haben, insbesondere während seiner Ausstellung im Contemporary Art Museum von St. Louis im Jahr 2016. Die Demonstranten, die den Rückzug seiner Werke forderten, warfen Walker vor, die Opfer rassistischer Gewalt zu “entmenschlichen”. Diese Kritik, obwohl emotional nachvollziehbar, verfehlt möglicherweise das wahre Anliegen: Walker entmenschlicht diese Bilder nicht, er offenbart deren bereits erfolgte Entmenschlichung in den mediatischen Kreisen. Seine künstlerische Geste funktioniert wie ein chemischer Entwickler, der Prozesse sichtbar macht, die normalerweise unsichtbar sind.
Der Modernismus auf dem Prüfstand der Digitalisierung
Walkers Praxis hinterfragt auch die ästhetischen Kategorien des Modernismus, insbesondere die Unterscheidung zwischen Original und Reproduktion, Authentizität und Simulation. Seine Werke funktionieren nach einer bewusst postauratischen Logik: Sie sind von Anfang an darauf ausgelegt, reproduziert, verändert und angepasst zu werden. Diese Position erweitert die Intuitionen von Walter Benjamin über die Kunst im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit, jedoch in einem Kontext, in dem diese Reproduzierbarkeit total und sofort geworden ist.
Der Einsatz von Software wie Photoshop oder Rhino 3D in seinem kreativen Prozess ist nicht nur ein technisches Werkzeug, sondern ein konstitutiver Bestandteil seiner Ästhetik. Walker delegiert bestimmte formale Entscheidungen an den Algorithmus und schafft eine Kunst der “Postproduktion”, in der die Unterscheidung zwischen Schöpfung und Manipulation verschwimmt. Dieser Ansatz bringt ihn Künstlern wie Seth Price oder Wade Guyton nahe, mit denen er im Kollektiv Continuous Project übrigens zusammengearbeitet hat.
Aber Walker begnügt sich nicht damit, die Möglichkeiten des Digitalen auszuloten; er zeigt auch deren Sackgassen auf. Seine Werke auf CD-ROM hinterfragen zum Beispiel die Fantasie der technologischen Demokratisierung: Was geschieht mit der Kunst, wenn jeder zum Produzenten von Bildern werden kann? Walkers Antwort ist nuanciert: Diese formale Demokratisierung geht einher mit einer ästhetischen Standardisierung, die auf anderer Ebene die Herrschaftslogiken reproduziert, die sie zu unterwandern vorgibt.
Seine Symbole des Recyclings, die immer wieder in seinem Werk auftauchen, funktionieren als Metaphern für diese zirkuläre Ökonomie der Bilder. Aber im Gegensatz zum materiellen Recycling erzeugt das symbolische Recycling keine Einsparung von Mitteln: Es führt vielmehr zu einer unendlichen Vermehrung von Zeichen, die sich letztlich gegenseitig aufheben. Walker zeigt so den potenziell entropischen Charakter unserer digitalen Kultur auf.
Diese Spannung zwischen technologischen Möglichkeiten und symbolischen Grenzen durchzieht sein gesamtes Werk. Seine Installationen in der Paula Cooper Gallery, in denen er Hunderte von Tafeln zeigt, die von Volkswagen-Werbung abgeleitet sind, verkörpern diese Problematik physisch: die formale Fülle grenzt an Sättigung, der informationsreiche Gehalt wandelt sich in weißes Rauschen. Die ästhetische Erfahrung schwankt zwischen Faszination und Erschöpfung und offenbart unsere zwiespältige Beziehung zur zeitgenössischen Informationsflut.
Hin zu einer Ästhetik der kritischen Komplizenschaft
Das Werk von Kelley Walker bietet weder eine Lösung noch eine Alternative zum zeitgenössischen Kapitalismus. Es enthüllt vielmehr dessen innerste Mechanismen, die Art und Weise, wie er unser Vorstellungsvermögen kolonisiert und unsere Wünsche formt. Diese Haltung mag unbequem, ja zynisch erscheinen, doch besitzt sie einen unbestreitbaren heuristischen Wert: Sie ermöglicht uns zu verstehen, wie wir alle mehr oder weniger zu aktiven Komplizen des Systems geworden sind, das wir zu kritisieren vorgeben.
Walker praktiziert das, was man eine “Ästhetik der kritischen Komplizenschaft” nennen könnte. Er positioniert sich nicht als außenstehend gegenüber den Marktdynamiken, sondern enthüllt deren Widersprüche von innen heraus. Seine Werke funktionieren wie Viren im System: Sie übernehmen dessen Codes, um sie besser zu stören. Diese Strategie ist nicht risikofrei, denn sie kann leicht von dem Markt, den sie kritisieren will, vereinnahmt werden, aber sie hat den Vorteil der Klarheit.
In einer Zeit, in der Bilder mit einer Geschwindigkeit und nach Logiken zirkulieren, die unsere Fähigkeit zum Verstehen bei Weitem übersteigen, bietet Walkers Kunst eine wertvolle reflexive Pause. Sie zwingt uns, zu verlangsamen, diese Bilder, die wir mechanisch konsumieren, genauer anzuschauen. Sie offenbart die historische und politische Dichte scheinbar harmloser Zeichen. Sie erinnert uns daran, dass hinter jedem Bild eine komplexe Ökonomie von Wünschen, Mächten und Affekten steckt.
Die zeitgenössische Kunst wurde oft der Gefälligkeit gegenüber den Marktdynamiken beschuldigt, die sie angeblich kritisiert. Walker akzeptiert diesen Widerspruch voll und ganz und macht ihn zum eigentlichen Material seiner künstlerischen Praxis. Diese paradoxe Ehrlichkeit ist vielleicht seine größte Stärke: Anstatt uns mit Illusionen über die mögliche Reinheit der Kunst zu wiegen, konfrontiert er uns mit unserer gemeinsamen Lage als Wesen, die in den Netzen des Waren-Spektakels gefangen sind. Diese Konfrontation, so unbequem sie auch sein mag, ist zweifellos eine notwendige Voraussetzung für jede wirkliche Transformation unseres Verhältnisses zur Welt und zu den Bildern.
In einem Kontext, in dem Fragen der Repräsentation und kulturellen Aneignung in künstlerischen Debatten zentral geworden sind, lädt Walkers Werk dazu ein, die moralisierenden Haltungen zu überwinden, um grundsätzlicher die materiellen und symbolischen Bedingungen der Bildproduktion zu hinterfragen. Seine Kunst beantwortet nicht die Frage, wer was darstellen darf, sondern enthüllt die Mechanismen, durch die diese Frage selbst durch zeitgenössische spektakuläre Logiken produziert und instrumentalisiert wird.
- Guy Debord, La Société du spectacle, Paris, Buchet-Chastel, 1967.
- Pierre Nora (Hg.), Les Lieux de mémoire, Paris, Gallimard, 1984-1992, 3 Bände.