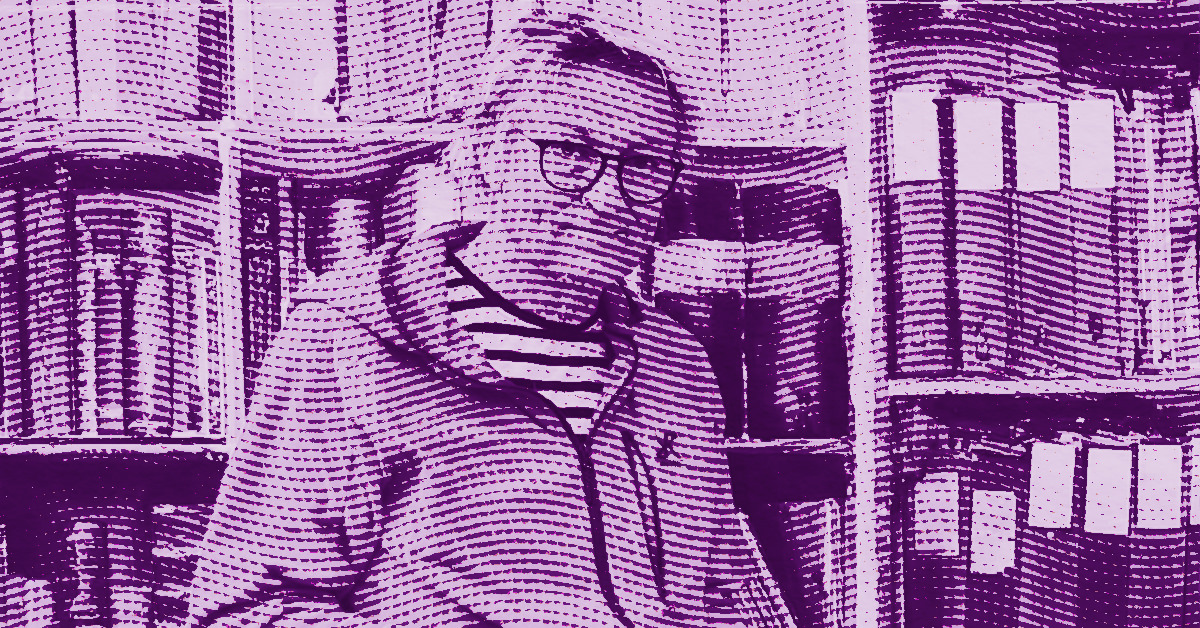Hört mir gut zu, ihr Snobs: Wenn ihr immer noch glaubt, Aquarell sei nur ein Sonntagshobby für nostalgische Rentner, dann habt ihr nie die 450 Zentimeter kontrollierten Chaos von Lars Lerin betrachtet. Dieser Schwede, geboren 1954 in den Wäldern von Munkfors, malt nicht Wasser, er formt Zeit, würde Tarkowski sagen. Und diese Metapher ist kein Zufall.
In der skandinavischen Kunstszene nimmt Lars Lerin eine einzigartige Position ein, die schnelle Einordnungen herausfordert. Ausgebildet an der Gerlesborg-Schule und dann an der Kunsthochschule Valand in Göteborg zwischen 1980 und 1984, hat er sich als einer der einflussreichsten Aquarellisten seiner Generation etabliert, der weit über die nordischen Grenzen hinausgeht und die europäische und amerikanische Seele berührt. Sein dauerhaftes Museum Sandgrund in Karlstad, eröffnet 2012, zeugt von dieser institutionellen Anerkennung, doch die wahre Größe seines Genies offenbart sich im direkten Kontakt mit seinen monumentalen Werken.
Denn Lerin vollführt eine stille Revolution in der Kunst des Aquarells. Wo man bürgerliche Zartheit erwartet, setzt er poetische Brutalität durch. Seine Formate, oft über 3 Meter, verwandeln die traditionelle Intimität des Mediums in ein immersives Erlebnis. “Ich male, was ich sehe, nicht was ich weiß”, erklärt er [1], ein beunruhigendes Echo der Gebote Turners, die er scheinbar für unsere ernüchterte Zeit neu erfindet.
Die Zeitlichkeit von Tarkowski oder die Kunst, den Augenblick zu formen
In der Arbeit von Lars Lerin gibt es eine zeitliche Qualität, die sofort an das filmische Universum von Andrej Tarkowski erinnert. Diese Verwandtschaft ist kein Zufall: Sie offenbart einen gemeinsamen Ansatz der Kunst als metaphysische Erforschung der menschlichen Existenz angesichts der natürlichen Unermesslichkeit.
Tarkowski theoretisierte in seinem Werk Die versiegelte Zeit den Film als Kunst der reinen Zeit, unterscheidbar von Eisensteins Montage durch die Fähigkeit, die reale Dauer einzufangen. Lerins Aquarelle verfolgen einen ähnlichen Ansatz: Sie stellen keinen eingefrorenen Moment dar, sondern tragen die Erinnerung an den Schaffensprozess in sich, diese “Nass-in-Nass-Technik” [2], die Wasser und Pigment nach ihren eigenen physikalischen Gesetzen interagieren lässt.
Diese besondere Zeitlichkeit zeigt sich in seinen Serien der Lofoten, einem norwegischen Archipel, wo er zwölf prägende Jahre lebte. Seine Visionen von Henningsvær oder seine Motive der Lofoten erfassen nicht die touristische Schönheit der Landschaften, sondern deren existenzielle Melancholie. Wie bei Tarkowski ist Dunkelheit nicht Lichtmangel, sondern Offenbarung einer tieferen Wahrheit. In Fjord (2015) fliegen die Möwen knapp über dem dunklen Wasser, während einige Gebäude am Ufer dicht gedrängt stehen, “unter dem Deckmantel der eindringenden Dunkelheit” [3]. Die Handschrift, die das Werk durchzieht, erzeugt einen Distanzierungseffekt, wie ihn Tarkowski benutzte, um den Betrachter in einem Zustand kontemplativer Fragestellung zu halten.
Der Einfluss Tarkowskis zeigt sich auch in der Behandlung der Architektur. Die isolierten Häuser von Lerin, diese “Caravanen, die neben einem Haus geparkt sind” oder diese “Garagen auf den Lofoten” erinnern an die Ruinenbauten des russischen Meisters, die immer kurz davorstehen, von der Natur zurückerobert zu werden. Diese architektonische Verletzlichkeit drückt “die existenzielle Bedingung in einer von der Dunkelheit des arktischen Winters umhüllten Umgebung” [3] aus, ein zentrales Thema in der Filmografie Tarkowskis, in der der Mensch ewig auf der Suche nach Sinn angesichts der kosmischen Unendlichkeit bleibt.
Doch vielleicht berührt Lerin Tarkovski am innigsten in seinem Bezug zum Gedächtnis. Seine Werke funktionieren durch das Ansammeln visueller und textueller Erinnerungen und schaffen so diese “Schnappschüsse von Erinnerungen, die Eindrücke von Leben und Wärme einfangen, wie sie vielleicht nicht mehr existieren” [4]. Diese Nostalgie ist nicht selbstgefällig: Sie wird zum Instrument der Erkenntnis, einem Mittel, um zu einer über der bloßen naturalistischen Darstellung liegenden poetischen Wahrheit zu gelangen.
Lerin praktiziert, was man eine “Archäologie des Moments” nennen könnte. Seine Reisetagebücher verwandeln sich in visuelle Meditationen, in denen die äußere Geografie innere Landschaften offenbart. Diese doppelte räumliche und zeitliche Erkundung entfaltet sich in seinen großen Kompositionen, in denen “verschiedene Schwarztöne, Ocker und französisches Ultramarin” [5] seltene chromatische Symphonien komponieren. Der Künstler sucht nicht die Nachbildung, sondern das Offenbaren und arbeitet “auf einem Pingpongtisch” [5] an diesen gigantischen Formaten, die das Atelier in ein Laboratorium zeitlicher Experimente verwandeln.
Die unheimliche Vertrautheit
Das Werk von Lars Lerin findet seine besondere Tiefe in dem, was Sigmund Freud das Unheimliche nennt, die unheimliche Fremdheit. Dieses 1919 entwickelte psychoanalytische Konzept beschreibt das beunruhigende Gefühl, das aufkommt, wenn das Vertraute plötzlich seine verborgene, geheime, potenziell bedrohliche Dimension offenbart.
Bei Lerin wirkt dieses unheimliche Fremde auf mehreren Ebenen. Zunächst in seiner Behandlung alltäglicher Gegenstände: Seine Stillleben aus “Porzellan und Glas” verwandeln Haushaltsgegenstände in rätselhafte Präsenz. Die von ihm gemalten Stühle werden zu “Porträts”, so die Kuratorin Bera Nordahl, die “persönliche und relationale Merkmale im Stil, der Abnutzung, dem Abstand zwischen den Stühlen und deren Richtung” [6] offenbaren. Diese leeren Sitzgelegenheiten tragen den gespenstischen Abdruck ihrer abwesenden Nutzer und erzeugen jene Spannung zwischen Anwesenheit und Abwesenheit, die für das freudsche Unheimliche charakteristisch ist.
Noch beunruhigender ist seine Arbeit an den Dioramen des Naturhistorischen Museums Göteborg, die die Essenz des unheimlichen Fremden offenbaren. Diese “präparierten Tiere”, die er “im Inneren der Vitrine” mit “dem hinter dem Fotografen im Glas reflektierten Hintergrund” [6] malt, schaffen eine Welt mit multiplen ontologischen Schichten. Was betrachten wir? Das ausgestopfte Tier? Seine bildliche Darstellung? Den Spiegel der lebendigen Welt in der Vitrine? Diese schwindelerregende Schichtung verweist direkt auf Freuds Analyse der Automaten und Wachsfiguren, jener Objekte, die die Grenze zwischen Lebendigem und Unbelebtem verwischen.
Die unheimliche Fremdheit bei Lars Lerin findet ihren packendsten Ausdruck in seinen entvölkerten Architekturen. Seine isolierten Häuser in der schwedischen oder norwegischen Landschaft sind niemals einfach nur pittoresk: Sie tragen eine unterschwellige Bedrohung in sich, die des Verlassenseins, des Verschwindens. Diese Bauten, “den stets präsenten Elementen ausgeliefert”, erinnern an das, was Freud als das Wiederauftauchen des Verdrängten identifiziert: Hier die fundamentale Prekarität unserer Verankerung in der Welt.
Die handschriftlichen Elemente, die seine Kompositionen durchziehen, fügen dieser unheimlichen Fremdheit eine weitere Dimension hinzu. Diese Textfragmente, oft unleserlich, fungieren als Eindringlinge des Unbewussten in die repräsentative Ordnung. Sie schaffen diese “andere Dimension, Assoziation zum Tagebuch, zu den Briefen” [7], die der Künstler beansprucht, erzeugen aber gleichzeitig eine kognitive Spannung beim Betrachter, der mit einer Botschaft konfrontiert wird, die er nicht vollständig entschlüsseln kann.
Diese Ästhetik der Ungewissheit erreicht ihren Höhepunkt in den Werken, in denen Lerin mentale Fotografie mit reiner Schöpfung vermischt. Er arbeitet “von direkten Eindrücken zu komplexeren Stücken”, wo er innehält und “nach einiger Zeit neu beginnt, um eine frischere Sicht zu bekommen” [7], und etabliert so eine Zeitlichkeit des Dazwischen, die unsere Wahrnehmungsmaßstäbe destabilisiert. Seine Landschaften sind weder ganz Erinnerung noch ganz Beobachtung: sie besetzen jenen Zwischenraum, den Freud als das bevorzugte Gebiet des unheimlich Identifizierten beschreibt.
Die Alchemie des Vergänglichen
Lerins Technik offenbart ein paradoxes Beherrschen: das Unkontrollierbare zu steuern. Dieser Ansatz “nass auf nass”, bei dem der Künstler “das gesamte Papier besprüht und seine Pigmente in intuitiven Farbwaschungen in den ersten Minuten verwendet, um diese atmosphärische Qualität zu erzielen” [8], etabliert einen permanenten Dialog mit dem Schöpfungsunfall. Diese Akzeptanz des Unvorhersehbaren ist Teil einer ästhetischen Tradition, die von Turner bis zu den abstrakten Expressionisten reicht, doch Lerin fügt seine besondere nordische Sensibilität hinzu.
Sein Verhältnis zur Farbe zeugt von dieser Suche nach einem Gleichgewicht zwischen Kontrolle und Loslassen. Er bevorzugt “verschiedene Schwarztöne, Ocker und französisches Ultramarin” [5] und baut seine Harmonien auf Erden und Schatten statt auf Glanz auf. Diese absichtlich begrenzte Palette erzeugt eine umso stärkere emotionale Intensität, je sparsamer deren Effekte eingesetzt werden. Seine Grautöne, “tief und dunkel oder ätherisch und glänzend, als würden sie das Bild auf magische Weise von innen heraus erleuchten” [9], offenbaren ein tiefes Verständnis der expressiven Kräfte der Monochromie.
Diese chromatische Ökonomie dient einem größeren ästhetischen Vorhaben: das Außergewöhnliche im Gewöhnlichen zu offenbaren. Lerin malt keine Postkartenlandschaften, sondern “existenzielle Bedingungen”, jene Momente, in denen der Mensch seiner grundlegenden Einsamkeit begegnet. Seine Promeneurs nocturnes bewegen sich “auf uns zu, watend durch tiefen Schnee entlang einer Straße, wo im Himmel darüber das Nordlicht funkelt” [3], doch all diese Schönheit bleibt “hinter dem Rücken des nächtlichen Wanderers, er sieht sie nicht und schätzt sie nicht. Er ist in sich selbst eingeschlossen in der Kälte”.
Diese Melancholie ist bei Lerin niemals selbstgefällig. Sie entspringt einer künstlerischen Klarheit, die ihre kathartische Funktion übernimmt. Wie er selbst erklärt: “Peindre et travailler avec des images (et des mots) est ma façon de gérer la vie, une sorte de méditation quotidienne, de routine” [7]. Die Kunst wird somit zum Instrument des psychischen Überlebens, Mittel, um existentielle Angst in kontemplative Schönheit zu verwandeln.
Diese Transformation vollzieht sich insbesondere durch die Gigantomanie seiner Formate. Seine Werke von “206 x 461 Zentimetern” zielen nicht auf spektakuläre Effekte, sondern auf totale Immersion. Sie schaffen eine visuelle Umgebung, die den Betrachter umhüllt und ihn zu einer physischen ebenso wie ästhetischen Erfahrung zwingt. Diese verkörperte Dimension der ästhetischen Rezeption erinnert daran, dass Lerins Kunst sich nicht nur an den Intellekt, sondern an die ganze Sensibilität des Menschen richtet.
Die Poetik der Abwesenheit
Im Zentrum der Ästhetik von Lars Lerin steht eine grundlegende Fragestellung über Abwesenheit und Verlust. Dieses Anliegen durchzieht sein gesamtes Werk, von seinen ersten Erkundungen im Värmland bis zu seinen jüngsten Besuchen im Lofoten-Archipel, die 2016 vom schwedischen Fernsehen dokumentiert wurden.
Abwesenheit zeigt sich zunächst in seinen menschenleeren Architekturen. Diese Häuser, Garagen, Fischlager sind niemals in dem Moment der Darstellung bewohnt. Sie tragen Spuren menschlicher Präsenz, Abnutzung, Patina und Einrichtungen, bleiben aber im Grunde leer. Diese Leere ist nicht neutral: Sie hinterfragt unsere Beziehung zum Ort, zur Verwurzelung, zur Beständigkeit menschlicher Dinge angesichts der natürlichen Gleichgültigkeit.
Abwesenheit wird besonders eindringlich in seinen Darstellungen häuslicher Gegenstände. Seine leeren Stühle fungieren wie Hohlporträts, die durch ihre Anordnung die menschlichen Beziehungen heraufbeschwören, die sie geformt haben. Diese Fähigkeit, dem Unbelebten eine Stimme zu verleihen, offenbart eine seltene poetische Sensibilität, die in der Lage ist, das Menschliche in seinen feinsten Spuren zu erkennen.
Doch vielleicht entwickelt Lerin seine poëtik der Abwesenheit am ausgefeiltesten in der Behandlung der Zeitlichkeit. Seine Landschaften erfassen niemals den gegenwärtigen Augenblick, sondern immer eine vergangene oder ausgesetzte Zeit. Diese Geisterzeitlichkeit drückt sich in seiner Technik selbst aus: das Aquarell fängt die Verdunstung des Wassers ein und verwandelt den Prozess des Verschwindens in ein ästhetisches Ereignis.
Diese Ästhetik des Vergehens findet ihren Höhepunkt in seinen jüngsten Werken, in denen der Künstler “ferne Länder sowie die Ecke der Straße im Värmland” [10] erkundet. Diese erweiterte Geographie verwässert seine Poetik nicht, sondern macht sie universell: Überall ist der Mensch mit denselben existenziellen Fragen konfrontiert, mit denselben Ängsten vor der vergehenden Zeit und den zerbröckelnden Gewissheiten.
Das Werk von Lars Lerin stellt somit eine fortwährende Meditation über die zeitgenössische menschliche Bedingung dar. In einer zunehmend urbanisierten und entmaterialisierten Welt hält er eine sinnliche und spirituelle Beziehung zur Natur und zur Zeit lebendig. Seine Aquarelle fungieren als Oasen der Kontemplation im beschleunigten Fluss unserer Zeit und erinnern daran, dass Kunst diese einzigartige Kraft besitzt, die Zeit zu verlangsamen und unsere Beziehung zur Realität zu vertiefen.
Diese Fähigkeit, das Universelle durch das Besondere zu berühren, erklärt den bedeutenden Erfolg Lerin in Skandinavien und darüber hinaus. Seine Ausstellungen ziehen Menschenmengen an, die in seinen Landschaften einen vergessenen oder verdrängten Anteil von sich selbst wiederfinden. Denn neben seiner unbestreitbaren technischen Virtuosität besitzt Lerin die seltene Gabe, die melancholische Schönheit der Welt zu offenbaren, eine Schönheit, die gerade aus dem Bewusstsein ihrer Zerbrechlichkeit entsteht.
Angesichts seiner großen Kompositionen erlebt der Betrachter das, was man als “nordische Erhabenheit” bezeichnen könnte, eine Mischung aus ästhetischer Erhebung und metaphysischer Angst, die für die skandinavische Sensibilität charakteristisch ist. Diese Ästhetik der Ambivalenz, in der Schönheit und Sorge untrennbar miteinander verschmelzen, zählt Lars Lerin zu den authentischsten Künstlern unserer Zeit, zu denen, die einfache Trostspenden ablehnen, um sich direkt den ultimativen Fragen der menschlichen Existenz zu stellen.
Sein Einfluss reicht inzwischen weit über den eingeschränkten Kreis der Aquarellliebhaber hinaus. Anerkannt von der Königlichen Akademie der Bildenden Künste Stockholm, Preisträger des August-Preises 2014 für sein Buch Naturlära, Fernsehepersönlichkeit des Jahres 2016 in Schweden, verkörpert Lerin die seltene Figur des populären Künstlers ohne ästhetische Kompromisse. Seine Fähigkeit, gleichzeitig die kulturelle Elite und die breite Öffentlichkeit zu erreichen, zeugt von der Authentizität seines künstlerischen Ansatzes.
Dieser Erfolg darf jedoch die Radikalität seines ästhetischen Projekts nicht verschleiern. Indem er die nordische Aquarellmalerei neu erfindet, bietet Lerin eine Alternative zur dominierenden Konzeptkunst unserer Zeit. Er fordert eine Rückkehr zu den sinnlichen Quellen der Schöpfung, diese “tägliche Meditation” [7], die das Atelier ebenso zu einem existenziellen wie ästhetischen Labor macht.
Diese besondere Position in der zeitgenössischen Kunstlandschaft ermöglicht es ihm, emotionale Gebiete zu erforschen, die von der offiziellen Kunst oft vernachlässigt werden. Seine Werke sprechen von Einsamkeit ohne Mitleidserregung, von Melancholie ohne Selbstgefälligkeit, von Angst ohne Verzweiflung. Sie offenbaren jene “existenzielle Nostalgie, die uns allen gemein ist” [4], die unsere technisierte Zivilisation zu verdrängen oder zu medizinisieren neigt.
Die Kunst von Lars Lerin erinnert uns somit daran, dass die primäre Funktion der Kunst die Erforschung der menschlichen Existenz in ihren grundlegendsten Dimensionen bleibt. Angesichts der Beschleunigung der zeitgenössischen Welt bieten seine Aquarelle eine alternative Zeit, jene der aktiven Kontemplation und der stillen Anerkennung unserer gemeinsamen Verwundbarkeit angesichts der Unermesslichkeit der Welt.
Diese Lektion der ästhetischen Weisheit platziert Lars Lerin unter die wesentlichen Schöpfer unserer Zeit, jene, die die humanistische Tradition der europäischen Kunst lebendig erhalten und gleichzeitig an zeitgenössische Sensibilitäten anpassen. Sein Werk bildet eine Brücke zwischen den uralten Anliegen des nordischen Menschen und den universellen Fragestellungen unserer späten Moderne, und bietet jedem die Möglichkeit, für einen Moment der Betrachtung jenen Teil der Ewigkeit wiederzufinden, den jede wahre Kunst birgt.
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Hanna August-Stohr, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “A new approach to Lofoten, Lars Lerin”, 2025
- Bera Nordal, Nordic Water Colour Museum, “Watercolour technique is a powerful tool”, 2011
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Museum Interview”, Art of Watercolor, 2013
- Susan Kanway, “Lars Lerin at American Swedish Institute”, Art As I See It Blog, 2016
- Konstantin Sterkhov, “Lars Lerin Interview”, Art of Watercolor, 2012
- Hanna August-Stohr, “The Watercolor Worlds of Lars Lerin”, American Swedish Institute, Minneapolis, 2016
- Galleri Lofoten, “Lars Lerin Exhibition Description”, Gallery Lofoten, 2025
- Sune Nordgren, “As Fast as The Eye”, The Royal Academy of Fine Arts, Stockholm, 2025