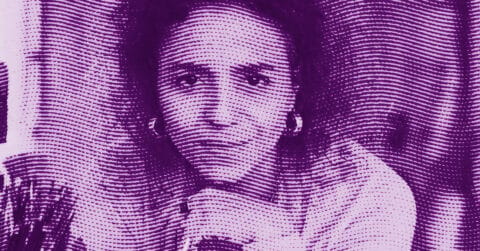Hört mir gut zu, ihr Snobs, es ist höchste Zeit, über Laura Owens zu sprechen, diese Künstlerin, die eure wohlmeinenden Gewissheiten über zeitgenössische Kunst fröhlich durcheinanderbringt. Aus ihrem Atelier in Los Angeles orchestriert sie eine stille Revolution, die all eure bequemen kleinen Schubladen zerschmettert.
Ihr dachtet, die Malerei sei tot? Dass nach der Abstraktion, dem Minimalismus und der Konzeptkunst nichts anderes übrigbleibt, als alte Rezepte zu recyclen? Lasst mich euch erzählen, wie diese gebürtige Ohioerin mit ihrem beißenden Humor und ihrem scharfen Verstand das malerische Medium bei jedem neuen Pinselstrich neu erfindet.
Owens zeichnet sich durch ihre hartnäckige Weigerung gegen Dogmen aus. Sie plündert fröhlich die Kunstgeschichte, entlehnt aus der Populärkultur, verdaut technologische Innovationen und verwandelt das Ganze in Werke, die jede Kategorisierung herausfordern. Aber Vorsicht, täuscht euch nicht von der scheinbaren Leichtigkeit ihrer Arbeit. Unter den säuerlichen Farben und spielerischen Mustern verbirgt sich eine tiefgründige Reflexion über die Natur der Kunst und unsere Beziehung zu Bildern.
Lasst uns Zeit nehmen, das von Jean Baudrillard entwickelte Konzept des “Simulakrum” zu erkunden, denn es erhellt genial das Werk von Owens. Für den französischen Philosophen ist unsere Zeit durch die Vermehrung von Bildern gekennzeichnet, die nur auf andere Bilder verweisen und einen Schwindel der Repräsentation schaffen, in dem der Begriff des Originals seine Bedeutung verliert. Die Gemälde von Owens nehmen diesen postmodernen Zustand voll an, aber mit einer unerwarteten Wendung: Sie machen daraus ein freudvolles Spielfeld.
Betrachten Sie ihre jüngsten Werke, in denen sie Druckplatten von Zeitungen aus den 1940er Jahren einarbeitet, die bei der Renovierung ihres Ateliers gefunden wurden. Diese Fragmente der Geschichte werden digitalisiert, in Photoshop bearbeitet, im Siebdruck neu gedruckt und dann von Hand weiterverarbeitet. Das Original und die Kopie, das Manuelle und das Mechanische, das Historische und das Zeitgenössische vermischen sich so sehr, dass sie ununterscheidbar werden. Genau das beschrieb Baudrillard als Hyperrealität, aber Owens verwandelt diesen potenziell beunruhigenden Zustand in eine Quelle des Staunens.
Dieser Ansatz zeigt sich besonders spektakulär in ihren monumentalen Installationen, wie der, die 2017 im Whitney Museum präsentiert wurde. Die Gemälde entfalteten sich dort wie ein visuelles Labyrinth, in dem jeder Betrachter seinen eigenen interpretativen Weg zeichnete. Täuschende Schatten, widersprüchliche Perspektiveffekte und Überlagerungen von Mustern schufen ein Erlebnis, das unsere gewohnten Bildleseweisen herausforderte.
Ein zweites philosophisches Konzept klingt kraftvoll in Owens’ Werk mit: die “Tod des Autors”, theorisiert von Roland Barthes. Laut dem französischen Literaturkritiker liegt die Bedeutung eines Werkes nicht in den Absichten seines Schöpfers, sondern in seiner Interpretation durch den Betrachter. Owens treibt diese Idee bis zu ihren extremsten Grenzen. Ihre Leinwände werden zu Räumen der Freiheit, in denen Referenzen ohne Hierarchie angesammelt werden: Ein Pinselstrich, der an Matisse erinnert, steht neben einem billigen Tapetenmuster, eine abstrakt-expressionistische Geste dialogisiert mit einer Illustration aus einem Kinderbuch.
Diese radikale Demokratisierung der visuellen Referenzen ist kein Zufall oder einfacher Relativismus. Es ist eine ästhetische und politische Position, die traditionelle Kunsthierarchien infrage stellt. Owens lehnt die Haltung der Künstlergottheit ab, die ihre Vision dem Betrachter aufzwingt. Stattdessen schafft sie Werke, die wie komplexe Spiegel funktionieren und jedem je nach Blickwinkel ein anderes Bild zurückgeben.
Nehmen Sie zum Beispiel ihre Serie von 2012-2013, in der überdimensionale Pinselstriche wie Bänder im Raum schweben, deren Schatten eine Illusion von Tiefe erzeugen und gleichzeitig ihre Künstlichkeit betonen. Vichy-Karo-Muster, Symbole kitschiger Häuslichkeit, dienen als Hintergrund für diese großartigen malerischen Gesten. Es ist, als würde sie sagen: “Ja, das alles ist künstlich, und na und? Ist das nicht großartig?”
Diese reine Freude am Malakt ist ansteckend. Owens zögert nicht, elektrische Farben zu verwenden, bewusst dekorative Muster und spektakuläre visuelle Effekte einzusetzen. Sie lehnt die Haltung des gequälten Künstlers ab und bevorzugt die des Zauberkünstlers, der seine Tricks verrät und uns gleichzeitig weiter erstaunt. Diese Haltung ist keine Naivität, sondern eine raffinierte Form von Aufrichtigkeit.
Die Künstlerin geht in ihrem Raumverständnis noch weiter. Bei 356 Mission, dem Ort, den sie von 2013 bis 2019 in Los Angeles leitete, hat sie Umgebungen geschaffen, die unsere Erfahrung der Malerei radikal veränderten. Die Werke waren nicht mehr isolierte Objekte zur Betrachtung, sondern Elemente einer Gesamterfahrung, bei der Architektur, Licht und sogar die Bewegung der Besucher zur ästhetischen Erfahrung beitrugen. Ihr Umgang mit Raum ist bemerkenswert. In ihren Installationen hängen die Bilder nicht einfach an der Wand, sondern aktivieren den umgebenden Raum. Die Schatten erzeugen virtuelle Erweiterungen der Werke, die Muster scheinen über die Begrenzungen des Rahmens hinauszugehen, Perspektiv-Effekte verändern unsere Wahrnehmung der Architektur. Die Ausstellung wird zu einer komplexen Choreografie, zu der der Betrachter aktiv eingeladen ist.
Diese partizipative Dimension ist grundlegend in ihrer Arbeit. Owens’ Gemälde sind keine autoritären Aussagen darüber, was Kunst sein sollte. Sie sind Einladungen zum Spielen, Erkunden und Hinterfragen unserer Gewissheiten. Sie schafft Werke, die als Weckvorrichtungen fungieren und uns dazu drängen, über das Sichtbare hinauszuschauen.
Ihre Trompe-l’oeil-Technik ist diesbezüglich besonders aufschlussreich. Die in ihren Werken dargestellten Schatten dienen nicht nur dazu, eine Tiefenillusion zu erzeugen, sondern werden zu autonomen Elementen, die mit unserer Wahrnehmung des Raums spielen. Diese Schatten werden manchmal mit fotografischer Präzision gemalt, manchmal stilisiert wie in einem Comic, wodurch eine ständige Spannung zwischen verschiedenen Darstellungsebenen entsteht.
Dieser spielerische Ansatz der Darstellung findet einen besonderen Widerhall in ihrer Art, natürliche Motive zu behandeln. Ihre Blumen- und Tierbilder streben nicht nach botanischem oder zoologischem Realismus. Im Gegenteil, sie umarmen eine Form der Fantasie, die an Kinderbuchillustrationen oder mittelalterliche Wandteppiche erinnert. Doch auch hier verbirgt diese scheinbare Naivität eine ausgefeilte Reflexion über die Natur der Darstellung.
In ihren jüngsten Werken erkundet Owens neue Dimensionen der malerischen Erfahrung. Sie integriert Klangelemente, mechanische Vorrichtungen und Lichteffekte, die ihre Gemälde in wahre immersive Umgebungen verwandeln. Diese technologischen Innovationen sind keine Spielereien, sondern natürliche Erweiterungen ihrer Forschung zu den Möglichkeiten der Malerei im digitalen Zeitalter.
Ihr Engagement mit der Technologie ist besonders interessant. Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Künstlern, die das Digitale dem Handwerklichen gegenüberstellen, sieht sie diese beiden Bereiche als komplementär an. Ihre Gemälde enthalten digitale Drucktechniken, Photoshop-Effekte und computergenerierte Muster, doch diese Elemente stehen stets im Dialog mit traditionellen malerischen Gesten. Das Digitale wird zu einem Werkzeug unter anderen in ihrem Künstler-Werkzeugkasten, auf derselben Stufe wie Ölfarbe oder Siebdruck.
Diese Hybridisierung der Techniken spiegelt eine breitere Sicht auf Kunst als einen Raum unendlicher Möglichkeiten wider. Für Owens gibt es keine Hierarchie zwischen den verschiedenen Ausdrucksmitteln. Ein gestischer Farbfleck kann neben einem mechanisch gedruckten Muster koexistieren, eine Anspielung auf die Kunstgeschichte kann mit einem Emoji in Dialog treten. Diese Demokratisierung von Referenzen und Techniken ist kein einfacher Relativismus, sondern eine tiefgehende ästhetische und ethische Position. Dieser Ansatz zeugt von einem tiefen Verständnis unserer Zeit, in der das Digitale keine Neuheit mehr ist, sondern ein konstitutives Element unserer Alltagsrealität. Owens’ Gemälde spiegeln diese Realität wider, ohne Nostalgie oder übermäßige Technophilie. Sie zeigen, wie Malerei technologische Innovationen aufnehmen und transformieren kann und gleichzeitig ihre Eigenständigkeit bewahrt.
Humor spielt eine zentrale Rolle in diesem Unternehmen der Auflösung von Grenzen. Owens’ Gemälde sind oft lustig, nicht auf zynische oder ironische Weise, sondern mit einer authentischen Freude am Absurden und Unerwarteten. Diese humorvolle Dimension ist nicht oberflächlich: Sie ist ein integraler Bestandteil ihrer Strategie, unsere Erwartungen zu destabilisieren und uns für neue Sichtweisen zu öffnen.
Nehmen wir ihre Serien von Gemälden, die auf Gittern und geometrischen Mustern basieren. Auf den ersten Blick scheinen sie in der modernistischen Tradition der geometrischen Abstraktion zu stehen. Doch bei genauerem Hinsehen entdeckt man Brüche, Verzerrungen, figurative Elemente, die diese Lesart stören. Die Gitter verwandeln sich in kariertes Schulpapier, die geometrischen Formen werden zu Fenstern oder Bildschirmen, die Farbflächen offenbaren digitale Texturen.
Diese Strategie der ständigen Störung der Erwartungen der Betrachter ist nicht zufällig. Sie spiegelt eine tief verwurzelte Überzeugung wider: Kunst soll uns nicht in unseren Gewissheiten bestärken, sondern uns vielmehr dazu bringen, unsere Wahrnehmungsgewohnheiten in Frage zu stellen. Jedes Gemälde von Owens ist eine Einladung zum Verlangsamen, zum aufmerksamen Beobachten und zum Entdecken der vielfältigen Bedeutungsebenen und Bezüge, die darin verborgen sind.
Das Werk von Laura Owens erinnert uns daran, dass Malerei kein erschöpftes Medium ist, sondern ein sich ständig erweiterndes Territorium. Sie zeigt uns, dass es möglich ist, in der künstlerischen Praxis sowohl tiefgründig ernst als auch fröhlich respektlos zu sein. Ihre Gemälde sind Einladungen, nicht nur darüber nachzudenken, was Kunst heute sein kann, sondern auch, wie wir sie erfahren und darüber sprechen können. In einer Welt der Kunst, die oft von Zynismus und Theorie beherrscht wird, bietet Owens eine erfrischende Alternative: eine Praxis, die Komplexität umarmt und gleichzeitig das reine Vergnügen der Schöpfung feiert. Ihre Werke erinnern uns daran, dass Kunst sowohl intellektuell stimulierend als auch unmittelbar befriedigend, konzeptuell streng und visuell bezaubernd sein kann.
Also ja, ihr Snobs, Laura Owens wirft eure wohlgeordneten Kategorien und bequemen Theorien über den Haufen. Und genau das braucht die zeitgenössische Kunst: weniger Posen und mehr Möglichkeiten, weniger Dogmen und mehr Entdeckungen. In ihrem Atelier in Los Angeles setzt sie weiterhin die Grenzen dessen, was Malerei sein kann, immer weiter und lädt uns alle ein, sie auf dieser freudigen und strengen Erforschung der unendlichen Möglichkeiten der Kunst zu begleiten.