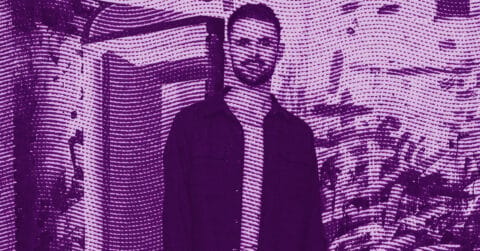Hört mir gut zu, ihr Snobs: Matthew Lutz-Kinoy ist kein gewöhnlicher Künstler, und diese Erkenntnis wird beim ersten Kontakt mit seinem vielgestaltigen Werk sofort klar. Geboren 1984 in New York und pendelnd zwischen Paris und Los Angeles, orchestriert dieser Mann eine Praxis, die jeden Versuch einer bequemen Kategorisierung herausfordert. Seine künstlerische Produktion entfaltet sich in einer Vielzahl von Medien, Keramik, großformatige Malerei, Performance, Tanz und Skulptur, und stellt so diverse Territorien dar, die er mit unersättlicher Neugier und offensichtlicher Gelehrsamkeit durchschreitet. Es wäre jedoch ein großer Fehler, diese technische Vielfalt als reinen Opportunismus oder amateurhafte Zerstreuung zu betrachten. Im Gegenteil, jedes Medium wird bei Lutz-Kinoy zum Träger einer tiefgründigen Reflexion über Repräsentation, Identität, körperliches Vergnügen und narrative Konstruktion. Seine Arbeit nährt sich reichlich aus historischen Referenzen, durchquert unbefangen Rokoko, abstrakten Expressionismus, Orientalismus sowie brasilianische und japanische Handwerkstraditionen und webt so ein komplexes Netz, in dem Vergangenheit und Gegenwart im produktiven Spannungsverhältnis stehen.
Ein Schlüssel zum Verständnis von Lutz-Kinoys Werk liegt in seiner innigen Beziehung zur klassischen japanischen Literatur, genauer gesagt zum Genji Monogatari von Murasaki Shikibu, das als einer der ersten Romane der Weltliteratur gilt. Dieses Monument der japanischen Literatur, geschrieben Anfang des elften Jahrhunderts, erzählt die Liebesabenteuer und das kultivierte Leben des Prinzen Genji am kaiserlichen Hof von Heian-kyo. Für Lutz-Kinoy ist dieses literarische Werk keine bloße oberflächliche Inspirationsquelle, sondern bildet tatsächlich eine narrative Struktur, die er in seine eigene künstlerische Produktion reinvestiert. 2015, bei seiner Ausstellung in São Paulo mit dem Titel Princess PomPom in the Villa of Falling Flowers, verwendet der Künstler explizit die Erzählung von Murasaki als konzeptionelle Basis. In einem Gespräch mit dem Kritiker Tenzing Barshee erklärt Lutz-Kinoy seinen Ansatz: “Es war interessant, Das Genji Monogatari als Struktur zu verwenden. Denn es nimmt die Form einer vorbestehenden Erzählung an, für die man keine Verantwortung tragen muss, sie existiert außerhalb von einem selbst und der eigenen Sinnbildung. Man kann sie also als formale Struktur nutzen, was einem erlaubt, freier zu arbeiten” [1]. Diese Aussage offenbart eine wesentliche Dimension seiner künstlerischen Praxis: die Nutzung vorbestehender Erzählungen als Gerüst, das eine verstärkte kreative Freiheit ermöglicht. Das Genji Monogatari ist somit nicht nur ein dekoratives Motiv oder eine elegante kulturelle Referenz, sondern ein strukturelles Instrument, das Lutz-Kinoy die Erforschung zeitgenössischer Themen, insbesondere Fragen von Geschlecht, körperlicher Transition und Vergnügen, durch das Prisma einer jahrtausendealten Narration erlaubt. Diese Strategie ermöglicht es ihm, einen Projektionsraum zu schaffen, in dem Körperliches und Narratives aufeinandertreffen, ohne dass das eine das andere dominiert.
Matthew Lutz-Kinoys Interesse an japanischer Literatur beruht nicht auf einfachem Exotismus oder unbewusster kultureller Aneignung. Der Künstler schlägt konzeptionelle Brücken zwischen den kulturellen Kontexten, die er durchläuft. In Brasilien beobachtet er die bedeutende japanischstämmige Gemeinschaft und verspürt eine Verbindung zwischen seinem eigenen Status als Fremder und dieser komplexen Migrationserzählung. Doch grundlegend findet er im Genji ein Modell, um das, was er „die körperliche Frivolität” nennt, die er in São Paulo insbesondere in queeren Räumen und während der Gay Pride beobachtet, mit „dem schweren Gewicht einer sozialen Erzählung” zu verknüpfen. Die im Genji entgeschlechtlichten Figuren in seiner malerischen Arbeit werden zu zeitgenössischen Avataren, die es ermöglichen, Bereiche identitärer und begehrensbezogener Fluidität zu erforschen. Die großformatigen Gemälde, die für diese Serie geschaffen wurden, zeigen mehrdeutige Figuren, oft als Hintergrund oder Paravents installiert, die den Betrachter einladen, die Geschichte „durch die Textur und nicht durch den Text” [2] zu durchdringen, wie die Dokumentation der Ausstellung im Kim? Contemporary Art Centre hervorhebt. Dieser haptische Ansatz, der das Berühren und die Materialität gegenüber dem linearen Lesen bevorzugt, zeugt von einem ausgefeilten Verständnis dafür, wie Erzählungen im dreidimensionalen Raum verkörpert werden können. Die auf die Leinwände genähten Quasten fügen eine taktile und ornamentale Dimension hinzu und schaffen das, was Lutz-Kinoy eine „Frivolität jenseits der Bildfläche” nennt, dabei aber „eine schwere Atmosphäre” aufrechterhält. Diese Spannung zwischen dekorativer Leichtigkeit und narrativer Dichte kennzeichnet sein gesamtes Genji-Konzept, das er nicht als Museumsobjekt, sondern als lebendige Matrix zur Gegenwartsreflexion nutzt.
Über diese literarische Dimension hinaus verankert sich Matthew Lutz-Kinoys Praxis tief im Universum des Tanzes und der Performance. Diese Ausrichtung ist nicht nebensächlich, sondern bildet tatsächlich das Herzstück seines künstlerischen Ansatzes. Ausgebildet im Theater und in der Choreographie denkt Lutz-Kinoy den Ausstellungsraum als potenziellen Bewegungsort, ein potentielles Theater, in dem sich Körper, der des Künstlers, die seiner Mitarbeiter, die der Zuschauer, entfalten und interagieren können. Seine Performances nehmen vielfältige Formen an: mehraktige Tanzproduktionen, wandernde Abendessen, programmierte Ereignisse innerhalb seiner Ausstellungen. Diese Vielfalt zeugt von einem erweiterten Performancebegriff, der sich nicht auf Tanz im engeren Sinne beschränkt, sondern jede Situation umfasst, in der der Körper Träger von Bedeutung und sozialer Beziehung wird. Kunsthistoriker verstehen sofort, dass wir es hier mit einem Künstler zu tun haben, für den Performance kein Medium unter anderen ist, sondern das ordnende Prinzip seines gesamten Schaffens.
Im Jahr 2013 präsentiert Lutz-Kinoy Fire Sale im OUTPOST Studios in Norwich, eine Performance, die exemplarisch seine Herangehensweise an Tanz als Objektivierungs- und Indexierungsprozess veranschaulicht. Der Künstler tanzt ausgiebig um eine brennende Kiste herum, bis sie vollständig verbrennt und dabei eine Reihe figurativer Keramikreliefs aus der Asche freilegt. Diese Performance stellt nach seinen eigenen Worten “ein Medley von [seinen] beliebtesten Tanzperformances” [3] dar und schafft somit einen Index früherer Arbeiten, der gleichzeitig objektiviert und auf gehärtete Objekte übertragen wird. Das Werk hinterfragt scharf die Problematik der Dokumentation der Performance, diesen unbequemen Bereich zwischen der Angst vor jedem Dokument und der Erfahrung der Arbeit selbst. Lutz-Kinoy lehnt die traditionelle Hierarchie ab, die die Performance als erstes Ereignis und deren Dokumentation als sekundäre Spur setzt. Stattdessen schafft er ein System, in dem die performative Geste direkt Objekte hervorbringt, die ihre eigene narrative Autonomie besitzen. Die Keramiken, die aus dem Feuer hervorgehen, sind nicht bloß Erinnerungen an den Tanz, sondern emanzipierte Werke, die ihre eigene Biografie entwickeln.
Dieser Ansatz findet eine theoretische Weiterführung in der Zusammenarbeit des Künstlers mit Silmara Watari, einer brasilianischen Keramikerin, die dreizehn Jahre lang Töpferei in Japan studiert hat. Gemeinsam produzieren sie Keramiken, die in einem Anagama-Ofen gebrannt werden, ein Prozess, der Bewegung und Zufall buchstäblich in das Material integriert. Der Brennvorgang dauert etwa fünf Tage, während denen sich Holzasche auf den keramischen Oberflächen ablagert, die auf circa 1250 Grad Celsius erhitzt sind, und unvorhersehbare Farben und Texturen erzeugt. Dieser Prozess wird selbst zu einer Form von Performance, bei der das Feuer durch den anthropomorphen Ofen “tanzt”, wie Tenzing Barshee beschreibt: “Die mit einem Stock oder einer Schaufel aufgewirbelte Asche, die eine Art Feuertanz ausführt, erzeugt Turbulenzen, durch die sich die Asche an den glühenden Keramiken anlagert. Die Ascheflocken reiten die heiße Luft wie Vögel oder ein Schmetterling” [4]. Dieses poetische Bild fängt das Wesen von Lutz-Kinoys Praxis ein: Bewegung wird im Material verankert, der Tanz versteinert, ohne seine kinetische Energie zu verlieren. Die Keramiken werden so zu dreidimensionalen Archiven der Geste, materiellen Zeugen eines performativen Prozesses, der die bloße Präsenz des Künstlers weit übersteigt.
Der Körper bleibt die prominenteste Figur in der gesamten Arbeit von Lutz-Kinoy, sei es durch die direkte Darstellung oder als Maßstab der Dimension. Diese Körper sind oft fragmentiert, zerteilt, im Ausstellungsraum verstreut, wodurch etwas entsteht, das man mit einem antiken Grab vergleichen könnte, in dem die verschiedenen Teile, Gehirn, Lunge und Leber, in separaten Gefäßen aufbewahrt würden. Diese körperliche Verteilung hat nichts Makabres; sie trägt vielmehr zu einer Reflexion darüber bei, wie sich der Körper in Objekten projiziert und umgekehrt. Die keramischen Gefäße, die in Bezug auf den menschlichen Körper nach den alten Töpfertraditionen hergestellt werden, werden zu anthropomorphen Erweiterungen, narrativen Prothesen, die es ermöglichen, die Verkörperung anders als in ihrer organischen Gesamtheit zu denken. Dieser Ansatz findet eine besondere Resonanz in den Beobachtungen des Künstlers zu den Körpern in Transition, denen er bei der Gay Pride in São Paulo begegnet, diese Körper “mit kleinen Brüsten, die wachsen”, diese drei Millionen Menschen, die eine “ganze Stadt” bilden. Lutz-Kinoy projiziert keine eigenen Phantasien auf diese Körper, sondern erkennt in ihnen einen “Raum des Potenzials, eine andere Art von Erzählung”, der seine Auffassung von Figuration als Projektionsraum und nicht als Metapher direkt informiert.
Die kollaborative Dimension von Lutz-Kinoys Praxis verdient ebenfalls besondere Aufmerksamkeit, denn sie ist nicht einfach anekdotisch, sondern konstitutiv für seine Methode. Der Künstler arbeitet regelmäßig mit anderen Kreativen zusammen, Tobias Madison für eine Theaterproduktion basierend auf dem Werk von Shuji Terayama, SOPHIE für den Soundtrack einiger Performances, Natsuko Uchino für keramische Projekte und Essensplanung. Diese Zusammenarbeiten sind keine bloßen Addition von Fähigkeiten, sondern Räume der Entfaltung von Wissen, die die involvierten Praktiken gegenseitig bereichern. Lutz-Kinoy reiht sich damit ein in eine Kette von Künstlern, für die Zusammenarbeit kein Kompromiss, sondern eine Erweiterung der kreativen Möglichkeiten ist. Dieser Ansatz, tief beeinflusst von den Geschichten queerer und kollaborativer Praktiken, erkennt an, dass künstlerische Schöpfung niemals rein individuell ist, sondern stets das Produkt von Netzwerken von Einflüssen, Lernprozessen und Austausch. Die mit Watari produzierten Keramiken tragen zum Beispiel die Spuren von dreizehn Jahren japanischer Studien der Keramikerin, der Geschichte der japanischen Einwanderung in Brasilien, der alten Techniken des Anagama-Ofens, aber auch von Lutz-Kinoys Sicht auf das, was er “die soziale Fantasie, die das Kunsthandwerk umgibt” nennt. Dieser letzte Ausdruck ist aufschlussreich: Dem Künstler geht es nicht so sehr um die reine Herstellungstechnik, sondern um die Geschichten und Wünsche, die sich um handwerkliche Objekte ansammeln, um deren Fähigkeit, kollektive Imaginationen zu vermitteln.
Die großformatigen Gemälde von Lutz-Kinoy, oft als Hintergrundleinwände, Wandteppiche oder hängende Decken installiert, schaffen immersive Umgebungen, die die traditionelle Frontalität der Malerei herausfordern. Diese Werke verlangen nicht danach, aus der Distanz betrachtet zu werden, sondern laden den Betrachter physisch dazu ein, ihren Raum zu bewohnen. Sie beanspruchen offen, nach den Worten des Künstlers selbst, “das Vergnügen, die Farbe, die Intimität, die Bewegung” als zentrale Fragen. Diese Anspruchnahme ist im Kontext der zeitgenössischen Kunst nicht unschuldig, wo das visuelle Vergnügen lange verdächtigt wurde, mit angeblicher Oberflächlichkeit oder dekorativer Gefälligkeit assoziiert zu sein. Lutz-Kinoy übernimmt diese hedonistische Dimension seiner malerischen Arbeit voll und ganz und lehnt die implizite Hierarchie ab, die konzeptuelle Strenge über sinnlichen Genuss stellt. Seine Leinwände umarmen die raffinierte Raffinesse des 18. Jahrhunderts und integrieren gleichzeitig Elemente des abstrakten Expressionismus und orientalistische Einflüsse, wodurch komplexe visuelle Schichtungen entstehen, in denen historische Ebenen ohne zeitliche Hierarchie koexistieren.
Was in der Gesamtproduktion von Matthew Lutz-Kinoy auffällt, ist die Art und Weise, wie jedes Medium die anderen in einem System kommunizierender Gefäße nährt. Performances informieren die Keramiken, die die Gemälde informieren, welche wiederum erneut die Performances informieren und so ein kreatives Ökosystem schaffen, in dem kein Medium dominiert. Diese Horizontalität im Umgang mit den verschiedenen Techniken zeugt von einem reifen Verständnis von künstlerischer Schöpfung als Prozess und nicht als Produktion isolierter Objekte. Der Künstler positioniert sich selbst im Zentrum dieser Praxis, nicht als autoritärer Demiurg, sondern als Dirigent eines Spektrums von Möglichkeiten, der gleichzeitig seine eigene Rolle bei der Werkproduktion leitet und untergräbt. Diese Selbstreflexivität, dieses scharfe Bewusstsein seiner eigenen künstlerischen Position verhindert jede naive oder selbstgefällige Lesart seiner Arbeit.
Das Werk von Lutz-Kinoy hinterfragt auch implizit, aber beständig die inneren und äußeren Strukturen, die Kunst, Gesellschaft und das Selbst organisieren. Indem er die Geschichte der Repräsentation vom Rokoko bis zum abstrakten Expressionismus durchquert und hohe und niedrige Kultur sowie handwerkliche Tradition und zeitgenössische Praktiken kombiniert, macht er die Willkür dieser Kategorisierungen deutlich. Seine Ausstellungen werden als skulpturale Räume realisiert, in denen verschiedene physische Formen und Medien, Keramiken, Gemälde, Zeichnungen, interagieren, um eine spezifische Räumlichkeit zu schaffen. Die zeichnerischen Rollen fungieren als narrative Geräte anstelle von Sprache und erklären schematisch die Struktur der Ausstellung, ohne auf konventionellen Text zurückzugreifen. Dieser Ansatz erkennt an, dass Bedeutung sowohl durch die räumliche Organisation der Werke als auch durch ihren intrinsischen Inhalt konstruiert wird.
Es scheint, dass Matthew Lutz-Kinoy eine künstlerische Praxis von seltener konzeptioneller Kohärenz entwickelt, trotz oder vielmehr dank seiner formalen Vielfalt. Sein Werk baut geduldig ein Territorium auf, in dem Bewegung und Stillstand, Erzählung und Materie, Vergangenheit und Gegenwart, Orient und Okzident, Vergnügen und Politik nebeneinander existieren, ohne sich gegenseitig zu neutralisieren. Indem er die klassische japanische Literatur als narrative Struktur und den Tanz als ordnendes Prinzip nutzt, bietet der Künstler eine Alternative zu den dominanten Diskursen der zeitgenössischen Kunst, die oft Gefangene eines amnesischen Präsenzdenkens oder einer oberflächlichen technologischen Faszination sind. Lutz-Kinoy erinnert uns daran, dass die dringendsten Fragen der Gegenwart, Identität, Geschlecht, Begehren und Zugehörigkeit, durch Formen aus der Vergangenheit artikuliert werden können, sofern man sie intelligent und sensibel reaktiviert. Seine Arbeit ist ein eindrucksvoller Beweis dafür, dass Gelehrsamkeit nicht im Widerspruch zur Sinnlichkeit stehen muss, dass konzeptionelle Strenge mit visueller Großzügigkeit koexistieren kann und dass zeitgenössische Kunst noch überraschen kann, indem sie die Einfachheiten des Zynismus oder der oberflächlichen Ironie ablehnt. In einer Welt, die von sofortigen Bildern und konventionellen Gesten übersättigt ist, baut Lutz-Kinoy langsam und geduldig ein Universum auf, in dem jedes Element zählt und in dem Schönheit niemals umsonst, sondern stets Trägerin mehrfacher Bedeutungen ist. Sein Werk lädt uns ein, langsamer zu werden, genauer hinzusehen, zu berühren statt nur zu sehen, zu tanzen statt stillzustehen. Und in dieser Einladung liegt vielleicht sein wertvollster Beitrag zur Kunst unserer Zeit.
- Matthew Lutz-Kinoy, Interview mit Tenzing Barshee, “Social Fantasy”, Mousse Magazine, Nr. 56, 2017.
- Dokumentation der Ausstellung “Matthew Lutz-Kinoy: Princess pompom in the villa of falling flowers”.
- Tenzing Barshee, “Fire Sale”, Ausstellungstext, Mendes Wood DM, São Paulo.
- Ebd.