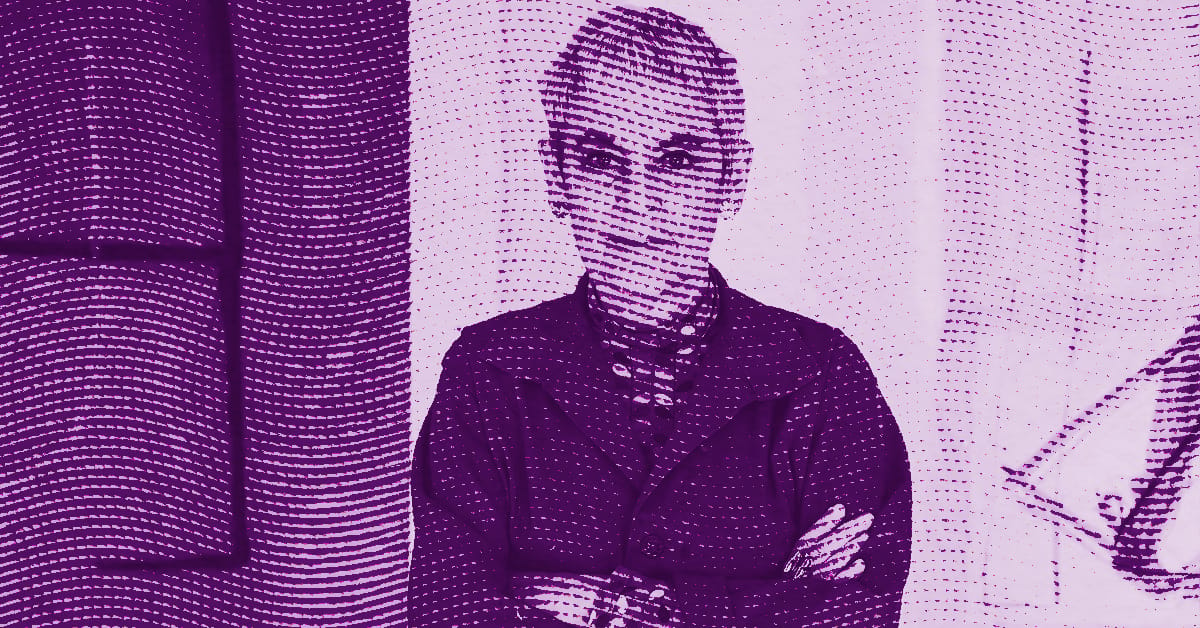Hört mir gut zu, ihr Snobs: Mira Schor malt, wie man ein Manifest schreibt, schreibt, wie man einen Kampf malt, und in dieser doppelten Praxis liegt die ganze Kraft ihres Werkes. Die 1950 geborene New Yorker Künstlerin, ausgebildet am California Institute of the Arts, wo sie 1972 am legendären Womanhouse teilnahm, repräsentiert jene Generation von Schöpferinnen, die sich weigerten, zwischen Denken und Materie, zwischen Feminismus und Formalismus zu wählen. Ihr Werdegang fügt sich in eine Reihe von Künstlerinnen-Theoretikerinnen ein, die verstanden haben, dass Kunst nicht stumm sein darf und dass Worte ohne das Fleisch der Malerei nicht ausreichen.
Das Werk von Schor entfaltet sich in einem Territorium, wo Sprache zum Bild wird und das Bild die Last der Sprache trägt. Ihre Gemälde aus den 1970er Jahren, diese in Kalifornien entstandenen Story Paintings, zeigen nackte Frauen, die sich in üppigen Landschaften bewegen, oft begleitet von wilden Tieren, insbesondere Bären. Diese Kompositionen sind keine bloßen Illustrationen einer harmonischen Beziehung zur Natur: Sie hinterfragen die Stellung der Weiblichkeit außerhalb der historisch ihr zugewiesenen häuslichen Rahmen. Die Frau erscheint hier nicht als ein zu zähmendes Wesen, sondern als eine Kraft, die gleichberechtigt mit dem Wilden kommuniziert. Diese Sichtweise findet ein starkes Echo in der Literatur, besonders bei Autorinnen, die die verbotenen Gebiete der weiblichen Erfahrung erforscht haben.
Charlotte Perkins Gilman beschreibt in ihrer Kurzgeschichte The Yellow Wallpaper, veröffentlicht 1892, eine Erzählerin, die beginnt, auf allen vieren zu kriechen und tierische Verhaltensweisen annimmt, um der häuslichen Gefangenschaft zu entkommen, die sie verrückt macht[1]. Dieser grundlegende Text der amerikanischen feministischen Literatur offenbart, wie das Patriarchat die Frau mit dem Tier assoziiert, um sie besser zu entwerten und in die Rolle eines irrationalen Wesens zu zwängen, das Kontrolle und Überwachung benötigt. Doch wo Gilman die Pathologie eines unterdrückerischen Systems aufzeigt, bietet Schor eine Aneignung an. In ihren kalifornischen Gemälden ist die Animalität kein Stigma mehr, sondern Befreiung. Die Frau, die den Bären umarmt und sich in der wilden Natur bewegt, lehnt das Häusliche ab, um das anzunehmen, was Jack Halberstam als “wild” bezeichnete, jene Lebensweisen am Rand etablierter Normen.
Diese Konvergenz zwischen Schors malerischem Werk und feministischer Literaturkritik ist kein Zufall. In ihrem 2001 veröffentlichten Essay “Figure/Ground” analysiert Schor, wie der utopische Modernismus die “Viskosität” der Malerei und Weiblichkeit fürchtete, jene feuchte und organische Qualität, die sich der männlichen konzeptuellen Strenge widersetzt. Ihre 1997 erschienene Sammlung Wet: On Painting, Feminism, and Art Culture verteidigt genau jene Materialität, die die zeitgenössische, von Männern dominierte Kunst verdrängen wollte. Schor schreibt aus ihrer Doppelposition als Malerin und Kritikerin, eine unbequeme Position, die sie zu einer dissidenten Stimme in einem Umfeld macht, in dem Theorie und Praxis oft künstlich getrennt werden.
Die Literatur durchdringt das Werk von Schor weit über diese thematischen Bezüge hinaus. Ihre Gemälde integrieren häufig Text, Sprachfragmente, die weder Bildunterschriften noch Illustrationen sind, sondern integrale Bestandteile der Komposition. Robert Berlind, Maler und Kritiker, schrieb 2009, dass Schor “eine Intimistin ist, deren Offenheit an die von Emily Dickinson erinnert” [2]. Dieser Vergleich mit der amerikanischen Dichterin ist nicht zufällig. Wie Dickinson weigerte sich Schor, die konventionellen poetischen Formen ihrer Zeit zu akzeptieren, und lehnt die einfachen Dichotomien zwischen Abstraktion und Figuration, zwischen politischem Engagement und visuellem Vergnügen ab. Ihre Gemälde aus den 1990er und 2000er Jahren sind bevölkert von Wörtern, Sätzen, sprachlichen Fragmenten, die im bildlichen Raum schweben wie verkörperte Gedanken. Sprache bei Schor ist niemals transparent: Sie ist Material, Farbe und Form.
Diese Praxis findet eine besondere Resonanz im Kontext der konzeptuellen Kunst, die die New Yorker Szene der 1970er und 1980er Jahre dominierte. Wo die Konzeptkünstler darauf abzielten, die Kunst zu entmaterialisieren, sie auf die reine Idee zu reduzieren, beharrte Schor hartnäckig auf der Präsenz der Malerei, ihrer Sinnlichkeit und Körperlichkeit. 2012 schrieb die Kritikerin Roberta Smith in der New York Times, dass Schors Gemälde “dem Leben und der Arbeit des Geistes eine seltene und sardonische visuelle Form geben” [3]. Diese Formulierung erfasst perfekt die produktive Spannung, die das Werk belebt: Zwischen Geist und Körper, zwischen Konzept und Empfindung weigert sich Schor, sich festzulegen.
Schors feministische Haltung beschränkt sich nicht nur auf die in ihren Gemälden behandelten Themen. 1986 gründete sie gemeinsam mit Susan Bee M/E/A/N/I/N/G, eine Kunstzeitschrift, die Künstlerinnen und Kritikern, die vom vorherrschenden Diskurs ausgeschlossen wurden, eine Stimme gab. Über zehn Jahre bot diese Veröffentlichung einen alternativen Diskussionsraum, fernab der Diktate von Zeitschriften wie October, die den Tod der Malerei verkündeten. Das Archiv von M/E/A/N/I/N/G wurde 2007 von der Beinecke Library der Yale University erworben, eine institutionelle Anerkennung ihrer historischen Bedeutung. Diese verlegerische Tätigkeit steht in der Tradition von Künstler-Schriftstellerinnen, die es ablehnten, anderen die Definition ihrer Praxis zu überlassen.
In ihrem jüngeren Werk, insbesondere seit der ersten Wahl von Donald Trump 2016, hat Schor die politische Dimension ihrer Arbeit verstärkt. Ihre Interventionen auf den Seiten der New York Times, wo sie Überschriften und Artikel annotiert, korrigiert und kommentiert, stellen eine Form des künstlerischen Aktivismus dar, der die Grenzen zwischen Kunst und sozialem Kommentar verwischt. Diese Gesten erinnern daran, dass die Künstlerin nicht in ihrem Elfenbeinturm bleiben kann, wenn die Welt brennt. Die schreiende weibliche mythologische Figur, die in ihren politischen Zeichnungen erscheint, erinnert an die Furien der griechischen Mythologie, jene Rachedämonen, die Verbrechen gegen die natürliche Ordnung bestraften.
Die Kunstgeschichte durchdringt Schors Werk ebenfalls auf komplexe Weise. Als Tochter von Ilya und Resia Schor, polnisch-jüdischen Künstlern, die 1941 in die USA flohen, wuchs Mira umgeben von Kunst und europäischer Kultur auf. Sie wurde am Lycée Français de New York ausgebildet, einer Institution, die ihr eine seltene internationale Perspektive im amerikanischen Kunstmilieu vermittelte. 1969 lieh ihr die Malerin Yvonne Jacquette ein Buch über Rajput-Malerei und -Poesie, das nach ihren eigenen Worten “einen enormen Einfluss” auf ihre Arbeit hatte. Diese Referenz an die indische malerische Tradition, in der Text und Bild seit Jahrhunderten miteinander verflochten sind, beleuchtet Schors formale Herangehensweise. Sie ordnet sich in eine Genealogie ein, die den westlichen modernistischen Kanon weit übersteigt.
Am California Institute of the Arts studierte Schor bei Judy Chicago und Miriam Schapiro im Feminist Art Program, aber auch bei dem Bildhauer Stephan Von Huene, der sie ermutigte, einen nahezu psychoanalytischen Ansatz im Dialog mit dem Werk zu entwickeln. Diese hybride Ausbildung, zwischen feministischer Aktivismus und vertiefter formaler Reflexion, prägte ihre künstlerische Identität. Sie weigert sich seit jeher, das eine dem anderen zu opfern, zwischen Schönheit und Politik, zwischen visuellem Vergnügen und kritischem Engagement zu wählen. Gerade diese doppelte Forderung macht ihr Werk zu einem unbequemen Terrain für die Tempelhüter, seien es reine Formalisten oder dogmatische Aktivisten.
Die Gemälde von Schor sind in der Regel kleinformatig, intim und erfordern eine genaue Betrachtung. In einer Welt, die von monumentalen und spektakulären Bildern übersättigt ist, stellt diese Wahl eines bescheidenen Formats an sich schon einen Akt des Widerstands dar. Ihre Bilder laden zur Langsamkeit ein, zur Kontemplation, zum aufmerksamen Lesen der Bedeutungsschichten, die sich dort ansammeln. Die Farbe spielt dabei eine entscheidende Rolle: Schor verwendet oft erdige Töne, Ockertöne, tiefe Rottöne, die gleichermaßen an Körper und Erde erinnern. Diese Farbpalette lehnt konzeptionelle Sterilität ab und favorisiert eine bewusste Sinnlichkeit.
Die Ausstellung “California Paintings: 1971-1973”, die 2019 in der Galerie Lyles & King gezeigt wurde, enthüllte der Öffentlichkeit eine wenig bekannte Facette ihrer Arbeit. Diese Gouachen auf Papier, entstanden während ihrer Ausbildungsjahre, zeigen eine Künstlerin, die sich ihrer formalen und politischen Anliegen bereits voll bewusst ist. Frauen erscheinen dort in Posen, die zwischen Verwundbarkeit und Stärke schwanken, oft in Interaktion mit Naturelementen wie Bäumen, Blumen oder Tieren, die niemals nur als Dekor dienen, sondern eigenständige Akteure der Komposition darstellen. Die Kritikerin Ksenia M. Soboleva stellte fest, dass diese Werke die weibliche “Wildheit” neu definierten, nicht mehr als Pathologie, sondern als legitime Lebensweise.
Schor’s schriftstellerische Praxis begleitet und nährt ihre malerische Praxis, ohne sie jemals zu verdrängen. Ihre Essays, gesammelt in Wet und später in A Decade of Negative Thinking, veröffentlicht 2009, stellen einen bedeutenden Beitrag zur feministischen Kunsttheorie dar. Sie verteidigt darin eine Position, die von ihren Kritikern manchmal als essentialistisch bezeichnet wird, indem sie sich weigert, die Bezugnahme auf den weiblichen Körper und die gelebte Erfahrung von Frauen zugunsten eines reinen Konstruktivismus aufzugeben. Diese Kontroverse offenbart die Spannungen innerhalb des akademischen Feminismus, zwischen denen, die in jeder Bezugnahme auf den Körper eine Kapitulation vor dem Patriarchat sehen, und denen, wie Schor, die meinen, den Körper zu verleugnen heiße, die männliche Sichtweise zu akzeptieren, die ihn auf reines Material reduziert.
In ihrem Essay “Patrilineage”, der in The Feminism and Visual Culture Reader, herausgegeben von Amelia Jones, erneut publiziert wurde, untersucht Schor, wie Künstlerinnen systematisch aus künstlerischen Genealogien ausgelöscht werden, wie ihre Einflüsse und Innovationen Männern zugeschrieben werden, und wie Kunstgeschichte sich als Abfolge von Vätern und Söhnen konstruiert. Ihre eigene Arbeit bemüht sich, diese verborgenen weiblichen Linien sichtbar zu machen, indem sie in ihren Pressemitteilungen die Einflüsse weiblicher Künstlerinnen anführt statt der immer wiederkehrenden männlichen Referenzen. Diese Geste, scheinbar einfach, ist eine politische Intervention in die Mechanismen künstlerischer Legitimation.
Die kritische Rezeption des Werks von Schor verdeutlicht die Schwierigkeiten, denen Künstlerinnen begegnen, die einfache Kategorisierungen ablehnen. Zu politisch für die Formalistinnen, zu sehr an der Malerei für die Konzeptualistinnen, zu intellektuell für einige, zu sensibel für andere, nimmt Schor einen Zwischenraum ein, der irritiert. Diese marginale Position ist keineswegs ein Handicap, sondern vielleicht ihre größte Stärke. Sie ermöglicht eine ungewöhnliche Perspektive, eine Freiheit gegenüber Modeerscheinungen und Dogmen. Ihre jüngsten Ausstellungen in Paris, an der Bourse de Commerce im Jahr 2023 und in verschiedenen europäischen Institutionen, zeugen von einer internationalen Anerkennung, die die Spaltungen der New Yorker Kunstszene übersteigt.
Das Erbe von Schor bemisst sich nicht nur an ihrem malerischen und kritischen Schaffen. Als Lehrerin an der Parsons School of Design hat sie Generationen von Künstlerinnen ausgebildet und ihnen diese doppelte Forderung nach formaler Strenge und politischem Engagement vermittelt. Ihr Einfluss zeigt sich auch durch M/E/A/N/I/N/G, das ein Modell für alternative Publikationen bot und bewies, dass es möglich ist, Diskussionsräume außerhalb der dominierenden institutionellen Kreise zu schaffen. Diese pädagogischen und redaktionellen Beiträge, die in der Kunstgeschichte, die Objekte gegenüber Prozessen bevorzugt, oft unsichtbar bleiben, sind dennoch ein wesentlicher Teil ihres Vermächtnisses.
Mira Schor verkörpert eine seltene und kostbare Form kulturellen Widerstands. In einer Kunstwelt, die zunehmend den Marktmechanismen unterworfen ist und in der das Spektakuläre und sofort Lesbare dominieren, hält sie eine anspruchsvolle, reflektierende Praxis lebendig, die auf Nuancen achtet. Ihre doppelte Praxis als Künstlerin und Theoretikerin entspringt nicht einer Unfähigkeit zur Wahl, sondern einem tiefen Verständnis, dass Denken und Tun untrennbar sind, dass Kunst sich nicht durch den Diskurs rechtfertigt, der Diskurs aber die Kunst erhellt, ohne sie je zu ersetzen. Ihr Werk erinnert uns daran, dass Malerei ein ebenso rigoroser Denkort sein kann wie jeder philosophische Text, und dass Worte die Sinnlichkeit der Farbe besitzen können. In dieser Zeit der Hyper-Spezialisierung, in der jede und jeder in ihrer beziehungsweise seiner Schublade bleiben muss, zeigt uns Schor andere Wege, vielleicht verschlungener, aber unendlich viel reichhaltiger. Sie lehrt uns, dass die Weigerung, sich zwischen Feminismus und Formalismus, zwischen Engagement und Schönheit, zwischen Körper und Geist zu entscheiden, keine Unentschlossenheit, sondern eine ethische und ästhetische Position ist, die sie voll und ganz einnimmt. Ihr Werk bildet ein Gegenmittel gegen alle Fundamentalismen, seien sie ästhetischer oder politischer Natur, und lädt uns ein, die grauen Zonen zu bewohnen, jene fruchtbaren Territorien, in denen Widersprüche sich nicht aufheben, sondern gegenseitig nähren. Damit gehört Mira Schor zu jener seltenen Künstlerinnengeneration, die nicht gefallen will, sondern Möglichkeitsräume eröffnet, die keine endgültigen Antworten geben, sondern die richtigen Fragen stellen, solche, die zugleich irritieren und befreien.
- Charlotte Perkins Gilman, The Yellow Wallpaper, The New England Magazine, 1892
- Robert Berlind, zitiert in der Biographie von Mira Schor, 2009
- Roberta Smith, “Voice and Speech”, The New York Times, 2012