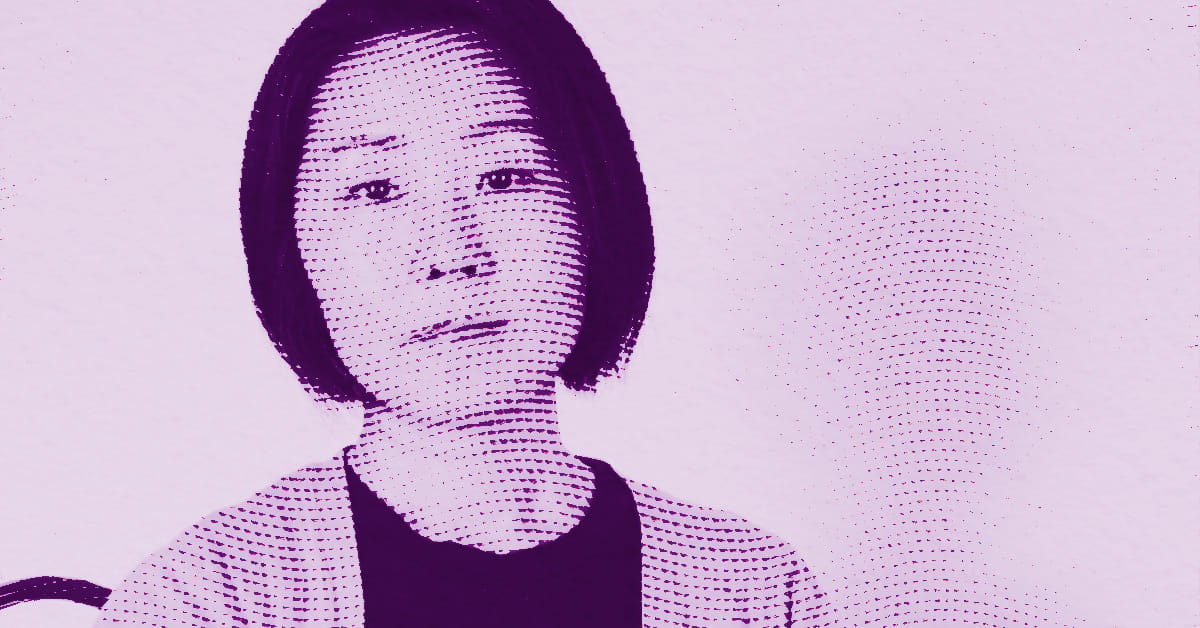Hört mir gut zu, ihr Snobs, ich muss Ihre Aufmerksamkeit auf das bemerkenswerte Werk von Naoko Sekine lenken, einer japanischen Künstlerin, deren Arbeit die etablierten Konventionen der zeitgenössischen Kunst mit unbestreitbarer Subtilität und intellektueller Tiefe herausfordert und die zusammen mit zwei weiteren Preisträgern den renommierten Luxembourg Art Prize im Jahr 2023 erhalten hat, eine internationale künstlerische Auszeichnung.
Sekine ist eine Virtuosin des Paradoxons, die zwischen Immanenz und Transzendenz mit einer Unbekümmertheit jongliert, die Ihre bevorzugten Konzeptkünstler neidisch machen würde. Ihre Werke, diese spiegelnden Strukturen, in denen sich reale und imaginäre Linien kreuzen, sind nicht einfach Objekte der Betrachtung, sondern Apparate, die uns zwingen, unsere Beziehung zu Raum und Zeit neu zu denken.
Nehmen Sie “Mirror Drawing-Straight Lines and Nostalgia” (2022), diese monumentale Komposition von fast drei mal drei Metern. Das Werk erinnert an die urbanen Landschaften New Yorks, gesehen durch das Prisma von Mondrian, doch Sekine treibt das Erlebnis noch viel weiter. Die neun unabhängigen Paneele unterschiedlicher Größe, aus denen das Ganze besteht, schaffen physische Linien, die Teil der Komposition werden. Indem sie die Graphitoberfläche wie einen Edelstein poliert, verwandelt sie das undurchsichtige Material in eine reflektierende Fläche, die den Betrachter und den umgebenden Raum einlädt, in das Werk einzutauchen.
Dieser Ansatz erinnert mich seltsam an die Überlegungen von Maurice Blanchot zum literarischen Raum, wo der Schriftsteller hinter seinem Werk verschwindet, um der reinen Erfahrung der Sprache Platz zu machen. In L’Espace littéraire (1955) schrieb Blanchot: “Das Werk zieht denjenigen, der sich ihm widmet, zu dem Punkt, an dem es auf die Probe der Unmöglichkeit gestellt wird” [1]. Sekine materialisiert diesen Punkt der Unmöglichkeit in ihren spiegelnden Flächen, schafft eine Schwelle, an der Bild und Realität verschmelzen, an der sich der Betrachter gleichzeitig innen und außen befindet, wie schwebend in einem schwindelerregenden Dazwischen.
Wenn Blanchot von “der wesentlichen Einsamkeit des Werkes” sprach, bezog er sich auf diese Fähigkeit der Kunst, einen autonomen Raum zu schaffen, der paradoxerweise erst durch die Begegnung mit dem Betrachter lebendig wird. Die Werke von Sekine verkörpern diese Spannung perfekt: Ihre reflektierenden Oberflächen absorbieren und verwandeln die Umgebung, was jede Erfahrung einzigartig und kontingent macht. Es ist eine Kunst, die Fixierung ablehnt und die ständige Bewegung der Wahrnehmung beansprucht.
In “Stacks Ⅱ” (2023) spielt Sekine mit unserer Raumwahrnehmung, indem sie zwei Arten von Linien nebeneinanderstellt: solche, die physisch durch das Zusammenfügen der Paneele entstehen, und solche, die per Hand gezeichnet sind. Dieser Dialog zwischen Materiellem und Dargestelltem erinnert nicht ohne Grund an Blanchots Überlegungen zur Unterscheidung zwischen der gewöhnlichen Sprache, die die Wörter zugunsten ihrer Bedeutung verschwinden lässt, und der literarischen Sprache, die die Wörter in ihrer materiellen Gestalt erscheinen lässt.
Was mir an Sekine gefällt, ist ihre Art, Serendipität in ihren kreativen Prozess einzubeziehen. Wenn sie von den “Zufällen” spricht, die während der Entstehung auftreten und die sie als Elemente des Werkes integriert, spürt man eine Künstlerin, die mit dem Material im Dialog steht, anstatt ihm eine vorgefertigte Vision aufzuzwingen. Dieses Vorgehen erinnert unwiderstehlich an die Prinzipien des japanischen Wabi-Sabi, einer Ästhetik, die Unvollkommenheit und Vergänglichkeit wertschätzt.
Die Inspiration, die Sekine aus den prähistorischen Höhlen in Frankreich zieht, die sie 2013 besucht hat, ist besonders aufschlussreich. Diese anonymen Künstler vor 30.000 Jahren nutzten bereits die natürlichen Reliefs der Wände, um ihre Tierdarstellungen zu ergänzen und schufen eine Verschmelzung von Natur und menschlichem Eingriff. Sekine setzt diese jahrtausendealte Tradition fort, indem sie die Körperlichkeit ihrer Trägermaterialien in die endgültige Komposition einbezieht. Kunst ist nicht mehr eine einfache Darstellung, die auf ein neutrales Trägermaterial aufgebracht wird, sondern eine Zusammenarbeit mit der Materialität der Welt selbst.
Kommen wir nun zur Serie “Colors”, in der Sekine aus Werken wie “Les Licornes” von Gustave Moreau oder “Model by The Wicker Chair” (“Modèle de la chaise en osier”) von Edvard Munch Farbpalletten extrahiert, um pointillistische Kompositionen von erstaunlicher Komplexität zu schaffen. Was mich hier besonders interessiert, ist weniger die Referenz zu diesen Malern, sondern die musikalische Struktur, die diesen Werken zugrunde liegt.
Denn hier ist das zweite Konzept, das das Werk von Sekine erleuchtet: die zeitgenössische minimalistische Musikalität. In ihren Schriften verweist die japanische Künstlerin ausdrücklich auf die Komposition “Music for 18 Musicians” des amerikanischen Komponisten Steve Reich als grundlegende Inspirationsquelle für ihr künstlerisches Vorgehen. Dieses Schlüsselwerk des musikalischen Minimalismus, geschaffen 1976, präsentiert eine besondere Struktur, bei der achtzehn Instrumentalisten und Vokalisten gemeinsam einen raffinierten Klangteppich erzeugen, ohne Leitung eines Dirigenten. Dieser kompositorische Ansatz spiegelt sich in Sekines künstlerischer Praxis wider durch sein nicht-hierarchisches Verständnis des Ganzen: Jedes musikalische Element (bzw. visuelle bei Sekine) bewahrt seine Autonomie und trägt gleichzeitig zur globalen Kohärenz des Werks bei.
Der Komponist John Cage bemerkte über Reichs Musik: “Es gibt keinen Anfang-Mitte-Ende, sondern eher einen Prozess, einen Prozess, der sich entfaltet” [2]. Diese Beschreibung könnte ebenso gut auf Sekines Werke angewandt werden, besonders auf ihre Serie “Colors”, in der jeder Farbpunkt, präzise in einem Koordinatensystem platziert, eine visuelle Erfahrung schafft, die mehr ist als die Summe ihrer Teile.
Reich selbst erklärte: “Musik als allmählicher Prozess erlaubt mir, mich auf den Klang selbst zu konzentrieren” [3]. Ähnlich lädt Sekine uns dazu ein, uns auf das reine visuelle Erlebnis zu konzentrieren, statt auf die Darstellung oder Botschaft. Ihre Farbpunkte erzeugen optische Vibrationen, die an Reichs rhythmische Schläge erinnern, dieses Pulsieren, das aus der Wiederholung ähnlicher, aber leicht versetzter Muster entsteht.
In “Colors-The Unicorns (383)” (2023) bilden die Farbpunkte, was Sekine eine “kreisförmige Struktur” nennt, bei der kein Element das andere dominiert. Wie in Reichs Musik, wo Instrumente ohne feste Hierarchie in die Komposition ein- und austreten, schaffen Sekines Farben ein Netzwerk von Interaktionen, in dem der Betrachter Bewegungen, Vibrationen und optische Mischungen wahrnimmt, die materiell auf der Oberfläche nicht existieren. Das Werk vervollständigt sich im Auge und Geist des Betrachters, ebenso wie Reichs Musik im Ohr des Zuhörers lebendig wird.
Dieser Gedanke der kreisförmigen Struktur im Gegensatz zur traditionellen pyramidenförmigen Struktur der repräsentativen Kunst ist besonders interessant. Sekine lehnt die Idee eines zentralen Motivs ab, dem alle anderen Elemente untergeordnet sind, und bevorzugt stattdessen eine Konstellation von Elementen, die auf Augenhöhe miteinander interagieren. Diese Herangehensweise spiegelt die prozessuale minimalistische Musik wider, in der sich Muster überlagern und allmählich verändern und so ein immersives Erlebnis schaffen, das natürliche Zyklen evoziert.
Die großen minimalistischen Komponisten haben oft erklärt, dass sie nicht imitieren wollen, sondern lediglich die Prozesse verstehen [4]. Das könnte das Motto von Sekine sein, die nicht danach strebt, Bilder getreu zu reproduzieren, sondern die Wahrnehmungsprozesse zu verstehen und zu offenbaren, die unserer Erfahrung der Welt zugrunde liegen. Ihre “Mirror Drawings” spiegeln wortwörtlich die Umgebung wider, in der sie ausgestellt sind, und verwandeln jede Ausstellung in ein einzigartiges, kontextabhängiges Erlebnis.
Und was ist mit ihrem Interesse am Bunraku, diesem traditionellen japanischen Marionettentheater? Auch hier findet sich diese Faszination für Systeme, in denen verschiedene Elemente (Puppenspieler, Rezitatoren, Musiker) ihre Unabhängigkeit bewahren und gleichzeitig eine einheitliche Erfahrung schaffen. Die Trennung zwischen dem Rezitator und der Marionette, zwischen der Stimme und der Bewegung, schafft einen Zwischenraum, in den die Fantasie des Zuschauers eintauchen kann, genau wie in Sekines Werken, wo körperliche und gezeichnete Linien eine konzeptuelle Zwischenzone erzeugen.
“Edge Structure” (2020) illustriert diesen Ansatz perfekt. In diesem Werk schneidet Sekine eine abstrakte Zeichnung entlang ihrer Konturen aus, entnimmt dann ein Quadrat aus dem Inneren und ordnet die Elemente neu, um eine neue Komposition zu schaffen. Dieser Prozess der Dekonstruktion und Rekonstruktion erinnert an die Art und Weise, wie prozessuale Musik ihre Motive zerlegt und wieder zusammensetzt. Die visuelle Künstlerin und der Komponist erforschen beide, wie die Transformation bestehender Strukturen neue wahrnehmungsmäßige Möglichkeiten offenbaren kann.
Die amerikanische minimalistische Musik ist bekannt für die “hörbare Gradualität” ihrer musikalischen Prozesse [5]. Diese Transparenz des Prozesses findet sich auch bei Sekine, die die Mechanismen der Entstehung ihrer Werke nicht verbirgt, sondern im Gegenteil hervorhebt. Die Fugen zwischen den Platten, die Spuren des Polierens, die aufeinanderfolgenden Schichten von Materialien, alles ist sichtbar und schafft eine materielle Ehrlichkeit, die den Betrachter direkt anspricht.
Was mir an diesen parallelen künstlerischen Ansätzen gefällt, ist ihre Fähigkeit, Werke zu schaffen, die sowohl intellektuell anregend als auch sinnlich fesselnd sind. Die minimalistische Musik bleibt trotz ihrer konzeptuellen Strenge tief bewegend und körperlich erfahrbar. Ebenso bieten Sekines Werke trotz ihrer theoretischen Raffinesse eine unmittelbare und viszerale visuelle Erfahrung: Diese spiegelnden Oberflächen, die das Licht einfangen und den Raum verwandeln, erzeugen ein fast tastbares Gefühl.
“Square Square” (2023) mit seinen versetzten Rechtecken und verschiedenen Linientypen schafft das, was ich als “visuelle Polyphonie” bezeichnen würde, bei der sich verschiedene Wahrnehmungsschichten überlagern, ohne je vollständig zu verschmelzen. Diese Schichtung erinnert an die “Phasenverschiebungstechnik” der minimalistischen Musik, bei der zwei identische Muster, die mit leicht unterschiedlichen Geschwindigkeiten gespielt werden, allmählich komplexe rhythmische Konfigurationen erzeugen.
Ich höre Sie schon flüstern: “Wieder so ein intellektueller Künstler, der Kunst für Theoretiker macht.” Weit gefehlt. Was Sekine vor konzeptioneller Trockenheit bewahrt, ist ihre unerschütterliche Bindung an die Sinnlichkeit des Materials. Diese spiegelpolierten Oberflächen, diese Linien, die ihr Aussehen je nach Winkel und Lichtquelle verändern, diese Farbpunkte, die auf unserer Netzhaut vibrieren, all das schafft eine unmittelbare ästhetische Erfahrung, die die Intellektualisierung übersteigt.
Hier liegt die wahre Originalität von Naoko Sekine: in ihrer Fähigkeit, scheinbar widersprüchliche Ansätze zu versöhnen. Das Konzeptuelle und das Sinnliche, die Ebene und das Volumen, das Fixe und das Bewegte, das Kontrollierte und das Zufällige existieren in ihren Werken, ohne sich gegenseitig aufzuheben. Wie in der zeitgenössischen minimalistischen Musik, wo mathematische Strenge paradoxerweise eine fast mystische meditative Erfahrung erzeugt, nutzen Sekines Werke die geometrische Präzision, um uns für eine flüssigere und intuitivere Wahrnehmung der Welt zu öffnen.
Wenn Kunst in unserer von Bildern übersättigten Welt noch eine Rolle spielt, dann genau diese: uns daran zu erinnern, dass unsere Wahrnehmung keine bloße passive Aufzeichnung der Realität ist, sondern eine aktive Konstruktion, in der Materialität und Bewusstsein untrennbar miteinander verwoben sind. Sekines Werke machen diese Wahrnehmungsmechanismen sichtbar und laden uns zu einem neuen Dialog mit der sichtbaren Welt ein, einem Dialog, in dem wir nicht mehr nur Zuschauer sind, sondern aktive Teilnehmer an der Schaffung von Bedeutung.
Also, das nächste Mal, wenn Sie ein Werk von Naoko Sekine sehen, halten Sie einen Moment inne. Beobachten Sie, wie das Licht auf diesen polierten Oberflächen spielt, wie Ihr eigenes Spiegelbild sich mit den vom Künstler gezogenen Linien vermischt, wie sich die Farbflächen je nach Entfernung und Blickwinkel verändern. Und vielleicht hören Sie in diesem stillen Dialog zwischen dem Werk und Ihrer Wahrnehmung die fernen Echos jener musikalischen Strukturen, die die Künstlerin so inspiriert haben, jene minimalistischen rhythmischen Pulsschläge, die wie unsere Herzschläge die Zeit unserer Existenz markieren.
- Maurice Blanchot, Der literarische Raum, Gallimard, 1955.
- John Cage, Silence: Lectures and Writings, Wesleyan University Press, 1961.
- Steve Reich, Schriften zur Musik, 1965, 2000, Oxford University Press, 2002.
- Steve Reich, Interview mit Jonathan Cott, The Rolling Stone Interview, 1987.
- Steve Reich, Music as a Gradual Process in Writings on Music, 1965-2000, Oxford University Press, 2002.