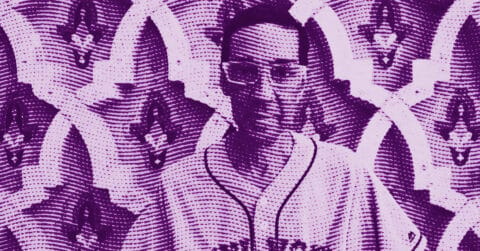Hört mir gut zu, ihr Snobs, es ist höchste Zeit, dass wir zusammen das Phänomen Neo Rauch auseinandersetzen, diesen rätselhaften deutschen Maler, der uns eine malerische Welt anbietet, die ebenso verstörend wie unwiderstehlich ist. Zwischen seinen in einer Choreographie des Absurden erstarrten Figuren und seinen industriellen Landschaften in Farben, die süß wie vergiftete Bonbons sind, hält uns Rauch einen verzerrenden Spiegel vor, in dem Moderne und Geschichte aufeinandertreffen, ohne sich wirklich zu umarmen.
1960 in Leipzig geboren und Waisenkind mit vier Wochen nach dem tragischen Tod seiner Eltern bei einem Eisenbahnunfall, verkörpert Rauch die Figur des Künstlers, der durch Abwesenheit geformt wurde. Diese ursprüngliche Leere scheint in ihm eine zeitliche Spalte geöffnet zu haben, einen Zwischenraum, in dem Epochen mit der stillen Gewalt eines luziden Albtraums aufeinandertreffen. Es ist kein Zufall, dass seine Figuren immer scheinen, in einem Zwischenzustand zu schweben, wie aufgehängt zwischen zwei Bewusstseinszuständen.
Jede Leinwand von Rauch ist eine Theaterszene, in der ein Stück aufgeführt wird, dessen Akteure selbst das Drehbuch nicht kennen. Diese Figuren mit dem Aussehen von Automaten, gekleidet in anachronistische Uniformen oder altmodische Arbeitskleidung, sind mit Aufgaben beschäftigt, deren Bedeutung sich uns entzieht. Sie sind wie Schlafwandler in einer Welt, die unserer ähnelt, aber anderen physikalischen und sozialen Gesetzen folgt.
Was sofort in Neo Rauchs Werk auffällt, ist seine zwiespältige Beziehung zur Architektur und zum Raum. Es ist unmöglich, nicht an Gaston Bachelards fulminante Analyse der Poetik des Raumes zu denken, wenn man diese schwindelerregenden Kompositionen betrachtet, in denen Innen- und Außenräume sich ohne offensichtliche Logik durchdringen. Wie Bachelard schrieb: “Der vom Vorstellungsvermögen erfasste Raum kann nicht der gleichgültige Raum sein, der dem Maß und der Reflexion des Geometers überlassen ist. Er wird erlebt” [1]. Bei Rauch ist dieser erlebte Raum der einer fragmentierten, kaleidoskopischen kollektiven Erinnerung, in der Fabriksschornsteine neben barocken Kirchen stehen und Perspektiven wie Kartenhäuser zusammenfallen.
Die industriellen Landschaften, die oft den Hintergrund seiner Gemälde bilden, erinnern an jene “Topophilie”, von der Bachelard spricht, jene “Liebe zum Raum”, die sich an Orten festmacht, die vom Bewusstsein bewohnt sind. Nur dass diese Orte bei Rauch von einer postsowjetischen Melancholie durchdrungen sind, als seien sie von den nicht gehaltenen Versprechen einer modernen Industriezeit heimgesucht, die mit der Berliner Mauer zusammengebrochen ist. Die Fabriksschornsteine, die seine Bilder durchziehen, sind nicht nur architektonische Elemente, sondern Totems einer untergegangenen Religion, der des technologischen Fortschritts als kollektivem Heil.
Die Farben von Rauch bilden eine eigene Sprache. Diese Bonbon-Rosatöne, diese sauren Gelbs und elektrischen Blautöne stehen im Kontrast zur Ernsthaftigkeit der dargestellten Szenen. Es ist, als hätte Rauch beschlossen, Tragödien mit der Palette einer Eiswerbung für italienisches Eis aus den 50er Jahren zu malen. Diese chromatische Diskrepanz erzeugt einen Distanzierungseffekt, der stark an das epische Theater von Bertolt Brecht erinnert. Wie Brecht selbst erklärte: “Die Verfremdung wandelt die zustimmende Haltung des Zuschauers, die auf Identifikation beruht, in eine kritische Haltung um” [2]. Bei Rauch zwingt uns diese Distanzierung, über unsere eigene Beziehung zur jüngeren Geschichte, insbesondere der geteilten Deutschland, nachzudenken.
Neo Rauch steht an der Schnittstelle mehrerer malerischer Traditionen, die er aufnimmt, um sie besser zu unterwandern. Natürlich spürt man den Einfluss des sozialistischen Realismus in der Monumentalität mancher Figuren, aber entkleidet von jeglichem kämpferischen Heldentum, als wären sie ihrer ideologischen Substanz beraubt. Es gibt auch etwas Surreales, aber ein Surrealismus, der auf den heiteren Traumfluss eines Dalí verzichtet hat, um eine dunklere, kontrolliertere, fast klinische Vision anzunehmen. “Der Surrealismus lebt in der Widersprüchlichkeit”, schrieb André Breton [3], und genau in diesem widersprüchlichen Zwischenraum befindet sich das Werk von Rauch, weder ganz figurativ noch abstrakt; weder nostalgisch noch futuristisch; weder narrativ noch hermetisch.
Nehmen wir zum Beispiel sein Gemälde “Die Fuge” (2007). Im Vordergrund hantieren zwei Figuren mit seltsamen Instrumenten, während im Hintergrund eine unwahrscheinliche Architekturstruktur gleichzeitig zu kollabieren und sich zu errichten scheint. Der Titel bezieht sich auf die musikalische Form der Fuge, diese komplexe kontrapunktische Konstruktion, bei der die Stimmen im Echo zueinander sprechen, aber auch auf die Idee der Flucht oder des Zwischenraums. Diese Mehrdeutigkeit ist typisch für Rauch, der es liebt, mit den verschiedenen möglichen Lesarten seiner Werke zu spielen.
Die politische Ambivalenz von Neo Rauch verdient es, näher betrachtet zu werden. Aufgewachsen in der DDR (Deutsche Demokratische Republik), ausgebildet im ostdeutschen akademischen System vor dem Mauerfall, hat Rauch ein totalitäres System aus erster Hand erlebt, das er bewusst nicht glorifiziert. Aber im Gegensatz zu anderen Künstlern seiner Generation hat er auch nicht vorbehaltlos die Werte des kapitalistischen Westens angenommen. Diese Zwischenposition brachte ihm Kritik ein, besonders vom Kunsthistoriker Wolfgang Ullrich, der ihm eine Neigung zu einer Form von Konservatismus vorwarf. Rauch antwortete mit einem Gemälde, das einen Kritiker zeigt, der in einen Nachttopf defäkiert, ein Beweis dafür, dass politische Neutralität nicht gleichbedeutend mit Temperamentslosigkeit ist!
Diese politische Dimension findet sich bis hin zu seiner Technik wieder. Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Künstlern, die die Ausführung ihrer Werke an Assistenten delegieren, malt Rauch jeden Quadratzentimeter seiner Leinwände selbst. Diese Weigerung, die Arbeitsteilung zu akzeptieren, kann als eine Form des Widerstands gegen das kapitalistische Produktionssystem gelesen werden, eine fast handwerkliche Verbundenheit zur Materialität des Werkes. Wie Hannah Arendt in “Vita activa oder Vom tätigen Leben” hervorhebt: “das Werk unserer Hände, im Gegensatz zur Arbeit unseres Leibes, der homo faber, der macht, der werkelt, im Gegensatz zum animal laborans, das schuftet und assimiliert, schafft die unendliche Vielfalt der Objekte, deren Summe die menschliche Kunstfälschung bildet” [4]. Rauch steht entschieden auf der Seite des homo faber, des Herstellers, der Materie in Bedeutung verwandelt.
Was mir an Rauch gefällt, ist, dass er Welten erschafft, die einer rigorosen internen Logik zu gehorchen scheinen, dabei aber für den Betrachter grundsätzlich undurchsichtig bleiben. Seine Gemälde sind wie geschlossene, autarke Systeme, die unsere Verständniss nicht brauchen, um zu existieren. Diese Autonomie des Kunstwerks hatte Theodor Adorno theoretisch beschrieben, indem er “die Rätselhaftigkeit” als ein wesentliches Merkmal wahrer Kunst bezeichnete: “Kunstwerke teilen mit Rätseln diese Ambiguität, bestimmt und unbestimmt zu sein. Sie sind Rätsel, weil sie das brechen, was sie sein könnten, während sie es bewahren” [5].
Die wiederkehrenden Figuren in Rauchs Werk, die Männer in Uniform, die anonymen Arbeiter, die Frauen mit androidehaften Zügen, sind keine Figuren im narrativen Sinn, sondern eher Archetypen, Verkörperungen existenzieller Haltungen. Sie erinnern mich an das, was Carl Jung über Archetypen sagte: “Der Archetyp ist eine Tendenz, Darstellungen eines Motivs zu formen, Darstellungen, die sich in den Details erheblich unterscheiden können, ohne ihr Grundmuster zu verlieren” [6]. Rauch schöpft aus diesem Reservoir ursprünglicher Bilder, um eine Welt zu erschaffen, die uns gleichzeitig vertraut und fremd erscheint.
In “Hüter der Nacht” (2014), einem bei David Zwirner ausgestellten Gemälde, findet sich diese archetypische Qualität wieder. Ein Mann in dunklem Anzug steht in einer nächtlichen Landschaft und hält das, was wie eine Laterne aussieht. Ist er ein Wächter? Ein Beobachter? Ein Führer? All diese Interpretationen sind möglich, aber keine erschöpft die Bedeutung des Bildes. Gerade diese offene Interpretierbarkeit macht den Reichtum von Rauchs Werk aus.
Neo Rauch selbst beschreibt seinen kreativen Prozess als eine Form der Trance, einen meditativen Zustand, in dem Bilder aus einem “weißen Nebel” auftauchen, den er greifen und an die Oberfläche bringen muss. “Ich betrachte mich als eine Art peristaltisches Filtersystem im Fluss der Zeit”, sagte er [7]. Diese organische Metapher ist aufschlussreich: Der Künstler als Körper, durch den Ströme fließen, die er filtert und verwandelt, statt als allmächtiger Demiurg.
Diese Demut gegenüber dem Schaffensprozess steht im Kontrast zur Arroganz vieler zeitgenössischer Künstler, die sich als Propheten einer Weltanschauung darstellen. Rauch dagegen scheint zu akzeptieren, ein Medium einer Realität zu sein, die ihn übersteigt und die er intellektuell nicht zu beherrschen vorgibt. “Ein Gemälde sollte klüger sein als sein Maler”, behauptet er [8] und kehrt damit die traditionelle Hierarchie zwischen Künstler und Werk um.
Was mich an Rauchs Werk zutiefst berührt, ist seine Fähigkeit, Bilder zu schaffen, die unserer Zeit der beschleunigten visuellen Konsumierung widerstehen. In einer Welt, die von Bildern übersättigt ist, die mit einem Klick erschöpft sind, verlangen seine Gemälde Zeit, Aufmerksamkeit, eine Form des Loslassens. Sie erinnern uns daran, dass wirkliches Sehen ein Akt ist, der unser ganzes Wesen einbezieht, nicht nur unsere Netzhaut. Wie John Berger schrieb: “Sehen kommt vor den Worten. Das Kind schaut und erkennt, bevor es sprechen kann” [9]. Rauch führt uns zurück zu dieser ursprünglichen, vorverbale Sicht, in der uns die Welt in all ihrer Fremdheit erscheint.
Neo Rauch ist ein Maler, dessen Werk sich einfachen Kategorien entzieht. Weder ganz zeitgenössisch, noch anachronistisch; weder abstrakt, noch streng gegenständlich; weder konzeptuell, noch naiv, er besetzt ein einzigartiges Terrain in der aktuellen Kunstlandschaft. Und vielleicht ist das sein größter Erfolg: ein sofort erkennbares malerisches Universum geschaffen zu haben, eine Parallelwelt, die ihren eigenen physikalischen und metaphysischen Gesetzen gehorcht.
Für Sie, die Sie seine Gemälde mit einer Mischung aus Faszination und Verwirrung betrachten, suchen Sie nicht so sehr danach, sie zu verstehen, sondern lassen Sie sich von ihnen mitreißen. Wie Tore zu einer alternativen Realität, in der unsere jüngste Geschichte, mit ihren zusammengebrochenen Utopien und unerfüllten Träumen, nach einem anderen Drehbuch nachgespielt wird. Es ist eine Welt, in der Ost und West, Vergangenheit und Zukunft, Alltag und Mythisches in einer seltsamen disharmonischen Harmonie koexistieren. Eine Welt, die uns daran erinnert, dass unsere Realität, die wir für gegeben halten, vielleicht nur eine von vielen möglichen Versionen ist, die in uns wohnen.
Also das nächste Mal, wenn Sie ein Gemälde von Rauch in einem Museum oder einer Galerie sehen, nehmen Sie sich die Zeit, sich darin zu verlieren. Lassen Sie sich von diesen unwahrscheinlichen Farben, diesen gebrochenen Perspektiven, diesen schwebenden Figuren aus der Fassung bringen. Denn wie Klee so treffend sagte: “Kunst reproduziert nicht das Sichtbare, sie macht sichtbar” [10]. Und was Rauch sichtbar macht, ist vielleicht dieser unentbehrliche Fremdheitsteil, der im Herzen unserer Moderne liegt.
- Bachelard, Gaston. Die Poetik des Raumes. Paris: Presses Universitaires de France, 1957.
- Brecht, Bertolt. Kleines Organon für das Theater. Paris: L’Arche, 1963.
- Breton, André. Manifest des Surrealismus. Paris: Gallimard, 1924.
- Arendt, Hannah. Zustand des modernen Menschen. Paris: Calmann-Lévy, 1961.
- Adorno, Theodor W. Ästhetische Theorie. Paris: Klincksieck, 1974.
- Jung, Carl Gustav. Der Mensch und seine Symbole. Paris: Robert Laffont, 1964.
- Rauch, Neo, zitiert in “Neo Rauch: Comrades and Companions”, Dokumentarfilm von Nicola Graef, 2016.
- Rauch, Neo, Interview mit Paul Laster, Conceptual Fine Arts, 2019.
- Berger, John. Sehen, das Sehen. Paris: Alain Moreau, 1976.
- Klee, Paul. Theorie der modernen Kunst. Paris: Denoël, 1985.