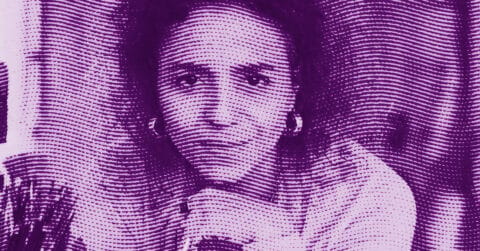Hört mir gut zu, ihr Snobs. Nick Brandt, geboren 1964 in London, ist nicht nur ein einfacher Tierfotograf, der Zebras mit dem Teleobjektiv aus seinem klimatisierten 4×4 fotografiert. Er ist der Theodore Géricault unserer Zeit, der nicht das Floß der Medusa festhält, sondern den letzten Untergang unserer natürlichen Welt. Und wenn Sie denken, dieser Vergleich sei übertrieben, dann haben Sie die Kraft seines Werkes nicht verstanden.
Beginnen wir mit seiner revolutionären Herangehensweise an die Tierfotografie. Während die meisten Tierfotografen sich hinter ihren gigantischen Teleobjektiven verstecken, um spektakuläre Actionszenen einzufangen, macht Brandt genau das Gegenteil. Er nähert sich seinen Motiven mit einer einfachen Pentax 67II und Festbrennweiten, als würde er Studio-Porträts machen.
Seine Technik ist von einer Kühnheit, die an Wahnsinn grenzt. Stellen Sie sich einen Moment lang vor, was es bedeutet, einen Löwen aus wenigen Metern Entfernung mit einer Mittelformatkamera zu fotografieren, die bei jedem Auslösen Lärm macht wie ein Presslufthammer. Das ist keine Fotografie, das ist ästhetisches Russisch Roulette. Aber genau diese körperliche Nähe verleiht seinen Bildern ihre metaphysische Kraft. Wenn Sie seine Schwarzweiß-Porträts von Elefanten betrachten, sehen Sie nicht einfach Dickhäuter, sondern Wesen mit Bewusstsein, die Sie vom Rand des Aussterbens aus anblicken.
Die Art und Weise, wie er Schwarzweiß einsetzt, ist meisterhaft. Es ist keine einfache ästhetische Wahl, um “künstlerisch” zu wirken, wie es viele mittelmäßige Fotografen tun. Nein, sein Schwarzweiß ist so scharf wie eine Rasierklinge. Er befreit seine Bilder von jeglicher chromatischen Ablenkung, um uns zu zwingen, das Wesentliche zu sehen: die pure Präsenz dieser Kreaturen, ihre intrinsische Würde, ihre absolute Verletzlichkeit. Das ist es, was der Philosoph Emmanuel Levinas “das Antlitz des Anderen” nannte, diese Präsenz, die uns eine unvermeidliche ethische Verantwortung auferlegt.
In seiner Serie “On This Earth” zeigt uns Brandt Tiere, die bereits wie Geister erscheinen. Die Zebras tauchen aus dem Nebel auf wie Gespenster einer schwindenden Vergangenheit. Die Giraffen zeichnen sich gegen den Himmel ab wie Hieroglyphen einer Sprache, die wir gerade vergessen. Jedes Bild ist eine visuelle Elegie, ein memento mori für das Anthropozän. Dieser Ansatz erinnert an die Arbeiten von Bernd und Hilla Becher über Industrieanlagen, aber anstatt die Überreste der Industriellen Revolution zu dokumentieren, katalogisiert Brandt die Opfer dieser gleichen Revolution.
Doch mit “This Empty World” erreicht seine Arbeit eine wahrhaft prophetische Dimension. Diese Serie ist ein Schlag in den Magen unseres kollektiven Bewusstseins. Brandt baut dort riesige Kulissen inmitten der Savanne auf, Tankstellen, Baustellen, Straßen, die visuelle Kollisionen zwischen der natürlichen Welt und unserer industriellen Zivilisation schaffen, die “Blade Runner” wie eine romantische Komödie erscheinen lassen. Die technische Meisterleistung ist verblüffend: Er installiert Kameras mit Bewegungssensoren, wartet monatelang, bis sich die Tiere an die Strukturen gewöhnen, ergänzt dann die Kulissen und fügt Menschen hinzu. Das Ergebnis ist von einer nie dagewesenen symbolischen Gewalt.
Nehmen Sie dieses Bild eines Elefanten, der sich auf einer nächtlichen Baustelle verirrt hat. Die Arbeiter, in ihre Handys vertieft, ignorieren seine majestätische Präsenz völlig. Das künstliche Licht schafft eine alptraumhafte Atmosphäre, die an Hopper-Gemälde erinnert, aber statt urbaner Einsamkeit inszeniert sie Umweltentfremdung. Der Elefant wird zu einem monumentalen memento mori, eine Mahnung dessen, was wir in unserem rasanten “Fortschritts”-Rennen zu verlieren drohen.
Diese Serie greift die Theorien der Anthropologin Anna Tsing über die sogenannten “Ruinen des Kapitalismus” auf. Aber Brandt geht weiter: Er beschränkt sich nicht darauf, diese Ruinen zu dokumentieren, sondern schafft visuelle Allegorien, die uns zwingen, uns mit unserer eigenen Barbarei auseinanderzusetzen. Jedes Bild ist eine Anklage, eine Prophezeiung, eine Klage.
Die Serie “Across The Ravaged Land” geht noch weiter in der Reflexion über unsere Zerstörungskraft. Die Bilder von Wächtern, die die Stoßzähne von gewilderten Elefanten halten, besitzen eine tragische Kraft, die an die Pietàs der Renaissance erinnert. Aber anstelle der Mutter Christi, die den Leichnam ihres Sohnes hält, sehen wir Menschen, die die Überreste von Kreaturen halten, die für menschliche Eitelkeit massakriert wurden. Dies wäre vom Philosophen Theodor Adorno als ein “dialektisches Bild” bezeichnet worden, ein Bild, das die grundlegenden Widersprüche unserer Zivilisation offenbart.
Die Porträts von im Natronsee versteinerten Tieren sind vielleicht die verstörendsten Bilder dieser Serie. Diese verkalkten Kreaturen, eingefroren in Posen, die an die Gipsabgüsse von Pompeji erinnern, werden zu Monumenten unserer kollektiven Gleichgültigkeit. Es ist Géricault trifft Joel-Peter Witkin, das Erhabene und der Horror verschmolzen in einem Bild.
Mit “The Day May Break” hebt Brandt seine Kunst auf ein neues Niveau konzeptioneller Komplexität. Diese Serie von Porträts von Menschen und Tieren im Nebel, alle Opfer des Klimawandels, ist unerträglich schön. Der künstliche Nebel, der seine Motive umgibt, ist kein bloßer ästhetischer Effekt, sondern eine visuelle Metapher für unser kollektives Blindsein. Jedes Bild ist wie ein Renaissancegemälde aufgebaut, mit akribischer Aufmerksamkeit für Komposition und Licht, doch die Botschaft ist entschieden zeitgenössisch.
Die Porträts werden von herzzerreißenden Zeugenaussagen begleitet: Bauern, die aufgrund der Dürre ihr Land verloren haben, Familien, die durch katastrophale Überschwemmungen vertrieben wurden, Tiere, die gerade noch vor dem Aussterben gerettet wurden. Das ist es, was der Philosoph Jacques Rancière als “partage du sensible” bezeichnet, eine Umverteilung dessen, was sichtbar und sagbar in unserer Gesellschaft ist. Brandt gibt denen eine Stimme und ein Gesicht, die im Diskurs über den Klimawandel gewöhnlich unsichtbar bleiben.
Seine letzte Serie „SINK / RISE”, fotografiert auf Fidschi, ist vielleicht seine kühnste Schöpfung bis heute. Diese Unterwasserporträts von Inselbewohnern, die vom Anstieg des Meeresspiegels bedroht sind, besitzen eine eiskalte Ironie. Die Sujets werden bei alltäglichen Aktivitäten fotografiert, sitzend auf Sofas, stehend auf Stühlen, aber unter Wasser. Es ist magischer Realismus trifft Umwelt-Dokumentarfilm. Die Bilder erinnern an die Installationen von Bill Viola, aber statt Spiritualität zu erforschen, konfrontieren sie die brutale Realität des Klimawandels.
Was an „The Echo of Our Voices”, seiner neuesten Serie, besonders auffällt, ist die Art und Weise, wie er die Klimakrise mit der Flüchtlingskrise verbindet. Durch die Fotografie syrischer Familien in Jordanien, dem zweitwasserärmsten Land der Welt, zeigt Brandt, wie Umwelt- und menschliche Katastrophen untrennbar verbunden sind. Die Porträts von Familien, die auf Stapeln von Kisten in den Himmel ragen, besitzen eine außergewöhnliche symbolische Kraft, eine Vertikalität, die sowohl Prekarität als auch Resilienz suggeriert.
Brandts Technik ist ebenso rigoros wie seine Vision unerbittlich. Für „This Empty World” entwickelte er einen komplexen Prozess, der ausgeklügelte Beleuchtungssysteme, Bewegungssensoren und monumentale Kulissen einschließt. Jedes Bild ist das Ergebnis von monatelanger Vorbereitung und Warten. Diese klösterliche Geduld erinnert an die großen Fotografen des 19. Jahrhunderts, dient jedoch einer sehr zeitgenössischen Dringlichkeit.
Einige Kritiker reduzieren seine Arbeit auf “Konservierungsfotografie” oder “Umweltfotoreportage”. Was für ein Unsinn! Brandt ist ein Konzeptkünstler, der Fotografie als Medium nutzt, um eine neue visuelle Mythologie des Anthropozäns zu schaffen. Seine Bilder sind keine Dokumente, sie sind Visionen, Prophezeiungen, visuelle Manifeste.
Die Art und Weise, wie er künstliches Licht in seinen nächtlichen Szenen verwendet, ist besonders bemerkenswert. Diese grellen Lichter, die an die Gemälde von Georges de La Tour erinnern, schaffen eine Atmosphäre eines apokalyptischen Theaters. Die projizierten Schatten werden ebenso wichtig wie die Motive selbst und erzeugen eine komplexe visuelle Choreographie, die an die Radierungen von Piranesi erinnert.
Was Brandt von so vielen anderen zeitgenössischen Fotografen unterscheidet, ist seine absolute Ablehnung des Zynismus. In einer Kunstwelt, in der Ironie zur Standardpose geworden ist, wagt er es, bis ins Mark aufrichtig zu sein. Sein Zorn ist echt, sein Mitgefühl ist echt, seine Verzweiflung ist echt. Das ist es, was der Philosoph Jean-Paul Sartre Engagement nannte, eine Kunst, die sich nicht damit begnügt, die Welt zu spiegeln, sondern sie zu transformieren sucht.
Seine Arbeit mit der Big Life Foundation, die er 2010 mitbegründete, zeigt, dass er sich nicht nur darauf beschränkt, die Zerstörung zu dokumentieren, sondern konkret handelt, um sie zu bekämpfen. Diese Verschmelzung von Kunst und Aktivismus erinnert an die Avantgarden des frühen 20. Jahrhunderts, jedoch mit noch größerer Dringlichkeit. Denn im Gegensatz zu den Surrealisten, die das Leben verändern wollten, kämpft Brandt buchstäblich dafür, es zu bewahren.
Die Art und Weise, wie er die Zeitlichkeit in seinen Bildern behandelt, ist faszinierend. Seine Fotografien scheinen gleichzeitig in mehreren Zeitlichkeiten zu existieren: Sie dokumentieren die Gegenwart, prophezeien die Zukunft und beklagen die Vergangenheit. Das ist es, was der Kunsthistoriker Aby Warburg “Überleben” nannte, die Art und Weise, wie bestimmte Bilder die Erinnerung an ältere Formen in sich tragen.
Technisch gesehen hat sein Wechsel von Film zur Digitalfotografie für “This Empty World” und die folgenden Serien nichts an der Kraft seiner Vision verändert. Während seine frühen Schwarzweißbilder an die Fotografie des 19. Jahrhunderts erinnerten, schaffen seine jüngeren Farbwerke eine eigene visuelle Sprache. Die gesättigten Farben seiner nächtlichen Szenen sind ebenso künstlich wie unsere gegenwärtige Beziehung zur Natur.
Für diejenigen, die noch denken, Fotografie sei nur ein einfaches Dokument, ist Brandts Arbeit ein wohltuender Schlag ins Gesicht. Seine Bilder sind komplexe Konstruktionen, die ebenso viel Planung und Nachdenken erfordern wie ein Geschichtsgemälde. Der Unterschied ist, dass die Geschichte, die er malt, sich gerade vor unseren Augen abspielt, und wir alle sind Komplizen davon.
Seine Inszenierung mindert in keiner Weise die Wahrhaftigkeit seiner Arbeit. Im Gegenteil, wie Walter Benjamin betonte, ist Fiktion manchmal der beste Weg, um zur Wahrheit zu gelangen. Brandts inszenierte Szenen offenbaren eine tiefere Wahrheit als jeder traditionelle Dokumentarfilm.
Die Arbeit von Nick Brandt ist eine brutale Erinnerung an unsere kollektive Sterblichkeit. Seine Bilder zwingen uns, uns dem zu stellen, was wir gewöhnlich zu ignorieren versuchen: unserer Verantwortung für die Zerstörung der natürlichen Welt. Wenn Sie die Bedeutung seiner Arbeit nicht verstehen, sind Sie Teil des Problems. Sein Werk ist nicht dazu da, uns zu trösten oder zu unterhalten, sondern uns aus unserer konsumistischen Betäubung zu wecken, bevor es zu spät ist.