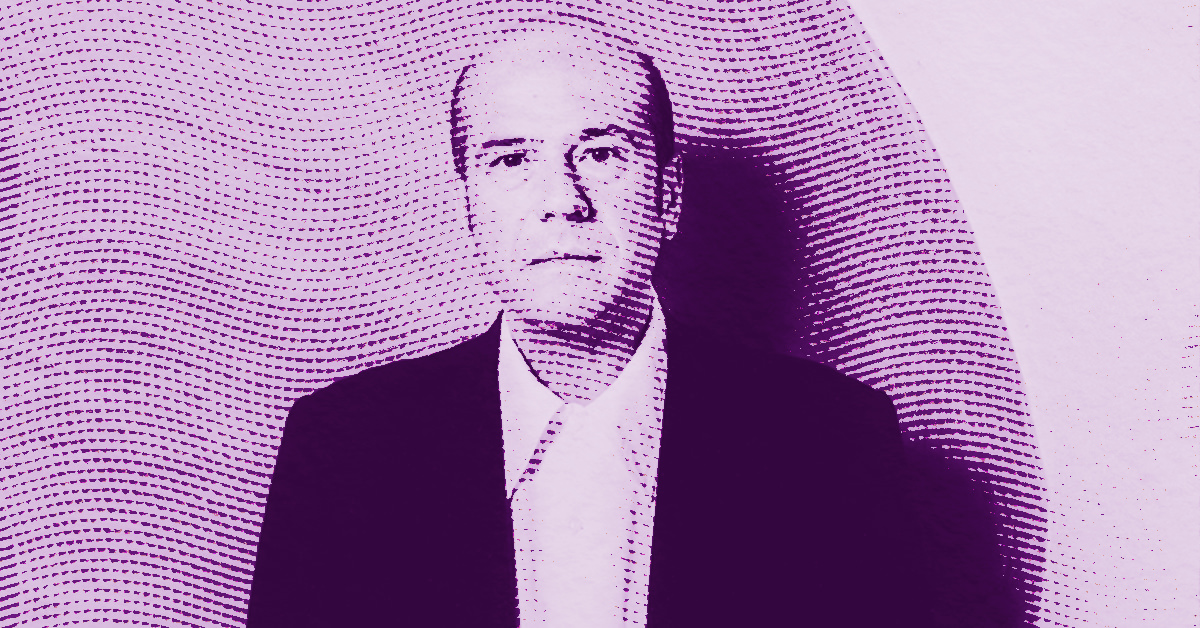Hört mir gut zu, ihr Snobs. In dieser sterilen Welt der zeitgenössischen Kunst existieren noch bewahrte Territorien, in denen reine Emotion dem kommerziellen Kalkül und den konzeptuellen Posen widersteht. Nicola De Maria ist ein hartnäckiger Hüter dieser Gebiete. Seit mehr als vierzig Jahren entfaltet dieser 1954 in Foglianise geborene Mann eine chromatische Welt auf den Wänden der ganzen Welt, in der Poesie auf Architektur trifft, in der Malerei ihren Rahmen sprengt, um den Raum zu erobern und unsere Beziehung zum Ort neu zu erfinden.
Auf diesem Kunstmarkt, wo Trends mit der Geschwindigkeit eines Algorithmus aufeinander folgen, hält De Maria eine verblüffende Konstanz aufrecht. Seine Serie Regno dei Fiori [1], die in den 1980er Jahren begann, blüht heute noch mit einer Hartnäckigkeit, die an das Heilige grenzt. Diese “Blumenreiche” sind keine einfachen gemalten Gärten, sondern psychische Territorien, in denen der Künstler eine persönliche Mythologie aus Primärfarben, stilisierten Sternen und symbolischen Häusern entfaltet.
Der Werdegang von De Maria beginnt mit Widerstand. Ausgebildet in Medizin mit einer Spezialisierung in Psychiatrie, die er nie ausüben wird, entscheidet er sich 1977 für die Malerei im konzeptuellen Turin der 1970er Jahre, als alle den Tod der Malerei verkündeten. Der erste Akt der Rebellion: im selben Jahr sein erstes Wandbild in Mailand zu schaffen und an der Biennale in Paris teilzunehmen. Ein prophetischer Akt eines Mannes, der Grenzen zwischen Disziplinen und Medien ablehnt.
Seine Anerkennung erfährt er 1979 durch die Aufnahme in die von Achille Bonito Oliva theoretisierte Bewegung der Transavanguardia. An der Seite von Sandro Chia, Francesco Clemente, Enzo Cucchi und Mimmo Paladino verkörpert De Maria dennoch einen eigenständigen Weg: Während seine Kollegen ironische oder neorealistische Figurationen erforschen, entwickelt er eine lyrische Abstraktion, die im kollektiven Unbewussten wurzelt. Diese Differenz ist nicht zufällig. Sie offenbart einen Künstler, der von Anfang an Etiketten ablehnt, um seinen eigenen Weg zu vertiefen.
Das kollektive Unbewusste
Nicola De Marias Werk offenbart ein intuitives Verständnis der Mechanismen des kollektiven Unbewussten, die Carl Gustav Jung [2] theoretisiert hat. Diese psychoanalytische Dimension seiner Arbeit geht über die bloße dekorative Verwendung universeller Symbole hinaus und erzielt eine echte Aktivierung von Jungs Archetypen. Dieser beschrieb das kollektive Unbewusste als “ein von der Menschheit geteiltes Fundament, das die Archetypen enthält: universelle Modelle”, die sich in mythologischen Erzählungen und künstlerischen Schöpfungen manifestieren. Bei De Maria findet diese Theorie eine selten kohärente malerische Anwendung.
Seine Sterne sind keine einfachen ornamental Motive, sondern Manifestationen des Archetyps des inneren Kosmos, jener Orientierungssuche in der psychischen Unermesslichkeit, die Jung als grundlegend beim Menschen identifizierte. Die Häuser, die seine Leinwände durchziehen, rufen den Archetyp des Zufluchtsorts hervor, des temenos heiligen Raums, in dem Individuation vollzogen werden kann. Was die allgegenwärtigen Blumen betrifft, verkörpern sie den Archetyp der fortwährenden Wiedergeburt, des ewigen Zyklus, der Natur und Psyche gleichermaßen regiert.
Diese Lektüre von Jung wird bereichert, wenn man die Wandtechnik des Künstlers beobachtet. Seine “Space Paintings”, die die Wände der Galerien bevölkern, reproduzieren den von Jung beschriebenen Individuationsprozess: Der Betrachter, in diese farbenfrohen Umgebungen eingetaucht, erlebt eine Transformationsphase, in der die Grenzen zwischen dem Ich und dem Raum vorübergehend aufgelöst werden. Diese Auflösung ist nicht pathologisch, sondern therapeutisch und ermöglicht dem persönlichen Unbewussten den Dialog mit dem kollektiven Unbewussten.
Der Gebrauch der Primärfarben durch De Maria folgt ebenfalls dieser archetypischen Logik. Rot symbolisiert die vitale Energie, die Libido im Sinne Jungs. Blau ruft das geistige Unendliche, die Transzendenz hervor. Gelb strahlt das Sonnenbewusstsein, die Klarheit der Erleuchtung aus. Diese Farben werden in dicken Schichten aufgetragen, entsprechend der Technik der alten Fresken, wobei nicht die chromatische Raffinesse, sondern die primäre Wirkung auf die Psyche angestrebt wird.
Jung beobachtete, dass “die Archetypen manchmal in ihren primitivsten und naivsten Formen erscheinen (in Träumen), manchmal auch in einer viel komplexeren Form, die auf bewusster Ausarbeitung beruht (in Mythen)”. Die Kunst von De Maria bewegt sich ständig zwischen diesen beiden Polen. Seine Zeichnungen auf Papier bewahren die Spontaneität des Traums, während seine Wandinstallationen die Komplexität des ausgearbeiteten Mythos erreichen.
Diese psychoanalytische Dimension erklärt, warum die Werke von De Maria eine so besondere Wirkung auf den Betrachter haben. Sie richten sich nicht nur an das Auge, sondern an dieses “Gedächtnis der Spezies”, das Jung im kollektiven Unbewussten verortete. Angesichts eines Regno dei Fiori betrachten wir keine bloße dekorative Abstraktion, sondern ein zeitgenössisches Mandala, das unsere tiefsten psychischen Strukturen aktiviert. De Maria selbst bringt es treffend zum Ausdruck, wenn er sich als “jemanden beschreibt, der Gedichte mit seinen mit Farben getauchten Händen schreibt” [3]. Diese Formulierung offenbart das Bewusstsein des Künstlers, aus einer universellen Sprache zu schöpfen, die über die reine Maltechnik hinausgeht.
Die Installation Angeli proteggono il mio lavoro (1986), die für seine erste amerikanische Ausstellung geschaffen wurde, veranschaulicht diesen Ansatz perfekt. Indem De Maria direkt auf die Wände und die Decke des Ausstellungsraums malt, verwandelt er die Architektur in einen farbigen Mutterleib, in dem der Betrachter eine positive Regression hin zu den Archetypen von Schutz und Wiedergeburt erlebt. Dieses Werk beschränkt sich nicht darauf, den Raum zu dekorieren: Es heiliget ihn neu, indem es unser kollektives Gedächtnis an den geschützten Ort aktiviert.
Architektur als spirituelles Territorium
Die zweite grundlegende Dimension von De Marias Werk liegt in seinem revolutionären Verhältnis zur Architektur und Raumlichkeit. Dieser Ansatz hat seine Wurzeln in der italienischen Tradition der Wandmalerei, wird jedoch auf eine zeitgenössische Logik umgedeutet, die den architektonischen Forschungen der italienischen Renaissance entspricht. So wie Brunelleschi im 15. Jahrhundert die Baukunst revolutionierte, indem er die Architektur “einer Regel unterwarf, die die Proportionsverhältnisse zwischen den verschiedenen Teilen des Gebäudes bestimmt”, entwickelt De Maria ein malerisches System, das die Beziehung zwischen Werk und räumlicher Umgebung völlig neu denkt.
De Marias Innovation besteht darin, die Architektur nicht als einfachen Träger, sondern als kreativen Partner zu behandeln. Seine Wandmalereien beschränken sich nicht darauf, die Wände zu bedecken: Sie verändern deren Wesen. Wenn er die Wände und Decken einer Galerie bemalt, dekoriert er den Raum nicht, sondern gründet ihn symbolisch neu. Dieser Ansatz erinnert an die Revolution Brunelleschis, der nach Kunsthistorikern “besonders die Strenge und Schlichtheit der Pläne pflegt”, um “einen sehr harmonischen optischen Effekt zu erzielen”.
Die Freskentechnik, die De Maria beansprucht, stellt eine direkte Verbindung zu den Meistern der italienischen Renaissance her, jedoch nach einer umgekehrten Logik. Während die Freskenmaler der Renaissance versuchten, die Illusion von Tiefe auf einer ebenen Fläche zu erzeugen, verwendet De Maria reine Farbe, um die traditionelle Wahrnehmung des architektonischen Raums aufzuheben. Seine farbigen Wände fliehen nicht mehr zu einem Fluchtpunkt, sondern strahlen zum Betrachter hin aus und erzeugen einen Effekt räumlicher Expansion, der die Architektur in ein inneres Universum verwandelt.
Diese räumliche Revolution findet ihren vollendeten Ausdruck in seinen öffentlichen Installationen, insbesondere Regno dei fiori: nido cosmico di tutte le anime (2004), geschaffen für die Luci d’Artista in Turin. Indem De Maria die Straßenlaternen auf dem Piazza San Carlo in leuchtende Blumen verwandelt, vollführt er einen architektonischen Akt von seltener Kühnheit: Er erfindet die Stadtbeleuchtung neu als ein poetisches System, das die Wahrnehmung des öffentlichen Raums verwandelt. Diese Intervention beschränkt sich nicht darauf, den Platz zu verschönern: Sie offenbart seine verborgene spirituelle Dimension.
De Marias räumlicher Ansatz stimmt mit den Forschungen zeitgenössischer italienischer Architekten überein, die laut Analysten “Tradition und Innovation verbinden” und “eine mutige Nutzung zeitgenössischer Materialien” entwickeln. Während die zeitgenössische Architektur jedoch Glas und Stahl verwendet, benutzt De Maria reine Farbe als architektonisches Material. Seine natürlichen Pigmente, aufgetragen nach traditioneller Freskentechnik, schaffen Oberflächen, die die Licht- und Akustikeigenschaften des Raumes buchstäblich verändern.
Diese architektonische Dimension erklärt, warum De Maria oft lieber an historischen Orten ausstellt als in neutralen White Cubes. Er benötigt den Dialog mit einer vorbestehenden Architektur, um seine eigene räumliche Vision zu offenbaren. Seine Eingriffe in Paläste, Kirchen oder umgewandelte Industrieanlagen schaffen fruchtbare Spannungen zwischen Alt und Neu, Sakralem und Profanem.
Für ihn wird die Farbe zu einer echten architektonischen Sprache. Jeder Farbton besitzt eine spezifische räumliche Funktion: Rottöne weiten den Raum und erzeugen ein Gefühl warmer Intimität, Blautöne erheben ihn in die spirituelle Unendlichkeit, Gelbtöne erleuchten ihn mit einem inneren Licht. Diese funktionale Farbverwendung erinnert an die Forschungen der modernen Architektur über die psychologische Wirkung von Materialien, wird jedoch nach einer rein malerischen Logik angewandt.
Die Installation wird bei De Maria zu einer totalen Kunst, die Malerei, Architektur und Poesie umfasst. Seine Titel, oft lang und poetisch, beschreiben das Werk nicht, sondern stellen eine verbale Erweiterung dar. “La testa allegra di un angelo bello” oder “Universo senza bombe” funktionieren wie Mantras, die die räumliche Wahrnehmung des Betrachters lenken. Diese an Wänden gemalten oder geschriebenen Worte schaffen eine literarische Dimension des Raumes, die an die heiligen Inschriften religiöser Architektur erinnert.
Dieser ganzheitliche Raumansatz offenbart bei De Maria eine Vorstellung von Kunst als Transformation der gelebten Welt. Seine Werke werden nicht nur betrachtet: Sie verändern physisch und psychologisch die Erfahrung des Ortes. In diesem Sinne erfüllt De Maria den Traum der modernen Architektur, Räume zu schaffen, die ihre Bewohner verwandeln, jedoch durch rein künstlerische Mittel.
Der Widerstand des Sensiblen
In einem Kunstmarkt, der von Neuheit und Transgression besessen ist, setzt De Maria die Beständigkeit einer Forschung entgegen, die immer wieder die gleichen grundlegenden Fragen vertieft. Seine “Teste Orfiche”, präsentiert auf der Biennale von Venedig 1990 [4], monumentale Leinwände mit über fünf Metern Breite, offenbaren eine künstlerische Reife, die ihre Obsessionen voll und ganz annimmt. Diese Werke suchen weder Provokation noch Modeeffekt, sondern graben unerlässlich die Frage der reinen Emotion in der Malerei aus.
Die amerikanische Kritik hat De Maria manchmal sein Ablehnen der postmodernen Ironie und der kritischen Dekonstruktion vorgeworfen. Dieses Missverständnis offenbart vielmehr die Einzigartigkeit seiner Position: In einer von Misstrauen gegenüber Emotionen dominierten Kunstwelt hält er unerschütterlichen Glauben an die transformative Kraft der Kunst. Seine Werke der 2000er und 2010er Jahre bestätigen diese Ausrichtung mit expliziten Titeln wie “Universo senza bombe” oder “Salvezza possibile con l’arte”.
Diese Position ist keineswegs naiv. Sie ergibt sich aus einer besonderen Klarheit hinsichtlich der zeitgenössischen Herausforderungen der Kunst. De Maria versteht, dass die wahre Subversion heute darin besteht, ästhetische Werte wiederherzustellen, die durch den vorherrschenden Zynismus diskreditiert wurden. Seine Verwendung von Primärfarben und einfachen Formen beruht nicht auf regressivem Primitivismus, sondern auf einer ausgeklügelten Strategie des kulturellen Widerstands.
Die jüngste Entwicklung seiner Arbeit bestätigt diese Ausrichtung. Seine Papierarbeiten vervielfachen poetische Notationen und musikalische Referenzen, schaffen visuelle Partituren, in denen jede Farbe einer Note und jede Form einem Rhythmus entspricht. Diese bewusste Synästhesie reiht De Maria ein in die Reihe großer Koloristen, die von Kandinsky bis Rothko die Malerei zu einer totalen Kunst machen wollten.
Seine jüngsten Installationen entwickeln auch eine ökologische Dimension, die seine Aussage bereichert, ohne sie zu verraten. Regno dei fiori musicali. Universo senza bombe (2023) integriert klangliche Elemente, die den Ausstellungsraum in eine vollständige sinnliche Umgebung verwandeln. Diese Entwicklung hin zur totalen Kunst respektiert die tiefgründige Logik eines Künstlers, der immer Grenzen zwischen Disziplinen abgelehnt hat.
Die Langlebigkeit von De Marias Karriere, seine Ausstellungen in den größten internationalen Institutionen und seine regelmäßige Präsenz in öffentlichen Sammlungen zeugen von einer Anerkennung, die über Modetrends hinausgeht. Seine Kunst überdauert Generationen, weil sie sich an anthropologische Grundbedürfnisse richtet: das Bedürfnis nach Schönheit, Spiritualität und Verbindung mit den Lebenskraften.
Diese Beständigkeit in einer flüchtigen Kunstwelt offenbart De Marias prophetische Relevanz. Vor vierzig Jahren schien seine Wahl der Malerei im konzeptuellen Turin anachronistisch. Heute, da neue Generationen das Bedürfnis nach Spiritualität und Naturverbundenheit wiederentdecken, erscheint sein Werk visionär. Seine “Blumenreiche” bieten psychische Zufluchtsorte in einer zunehmend entmenschlichten Welt.
Kunst als säkulare Gebet
Das Werk von Nicola De Maria vollbringt die Meisterleistung, die spirituelle Dimension der Kunst ohne kitschigen Mystizismus wiederherzustellen. Seine Installationen schaffen säkulare Räume der Einkehr, in denen ästhetische Kontemplation auf meditative Erfahrung trifft. Diese spirituelle Dimension beruht auf keinem religiösen Dogma, sondern auf einem fundamentalen Vertrauen in die heilende Kraft der Schönheit.
Wenn De Maria “Regno dei Fiori” malt, stellt er keine Blumen dar, sondern schafft die Bedingungen für eine psychische Blüte beim Betrachter. Seine reinen Farben wirken wie visuelle Mantras, die die geistige Unruhe beruhigen und mit den natürlichen Rhythmen verbinden. Diese therapeutische Funktion der Kunst steht im Einklang mit zeitgenössischen Forschungen zur Kunsttherapie, wird jedoch durch rein ästhetische Mittel vollzogen.
Die zwanghafte Wiederholung der gleichen Motive, Sterne, Häuser und Blumen, erzeugt eine hypnotische Wirkung, die den Zugang zu veränderten Bewusstseinszuständen erleichtert. Diese Wiederholung ist keine Monotonie, sondern ein schöpferisches Wiederaufgreifen, das die Verständnistiefe allmählich vertieft. Jeder neue “Regno dei Fiori” enthüllt neue Aspekte dieses scheinbar unerschöpflichen poetischen Universums.
Das Einfügen von poetischen Wörtern und Sätzen in seine Gemälde fügt eine literarische Dimension hinzu, die das ästhetische Erlebnis bereichert. Diese Texte beschreiben nicht das Bild, sondern schaffen einen verbalen Gegenpol, der die Meditation lenkt. Wenn De Maria schreibt: “La montagna mi ha nascosto la luna, cosa devo fare?” (Der Berg hat mir den Mond verborgen, was soll ich tun?), stellt er keine nebensächliche Frage, sondern formuliert die grundlegende existentielle Sorge des Menschen angesichts der kosmischen Unermesslichkeit.
Diese spirituelle Dimension erklärt die Anziehungskraft von De Marias Werk auf sehr unterschiedliche Publikumsschichten. Seine Installationen ziehen ebenso zeitgenössische Kunstliebhaber wie spirituelle Suchende, Kinder ebenso wie ältere Menschen an. Diese Querbeziehung zeigt die Richtigkeit seiner Intuition: Wahre Kunst spricht das Universelle in jedem Menschen an.
De Marias Kunst bietet eine konkrete Alternative zum zeitgenössischen Nihilismus. Angesichts einer desillusionierten Welt erhält er die Möglichkeit wach, durch Schönheit eine Erfahrung des Heiligen zu machen. Seine “Universen ohne Bomben” sind keine naiven Utopien, sondern Labore zur Erprobung friedvoller Seinsweisen. In seinen Installationen hängt für einige Augenblicke die Gewalt der Welt aus und wird durch eine fragile, aber reale Harmonie ersetzt.
Dieses Werk erinnert uns daran, dass Kunst trotz ihrer Vermarktung noch immer die Kraft zur spirituellen Transformation besitzt, die allen Aneignungen widersteht. Indem Nicola De Maria diese heilige Dimension der Kunst lebendig hält, vollbringt er einen kulturellen Widerstandsakt von erheblicher Tragweite. Er beweist uns, dass es auch im 21. Jahrhundert noch möglich ist, Werke zu schaffen, die die Seele erheben, ohne die Intelligenz zu verleugnen.
Die ewige Gegenwart der Schöpfung
Eine offensichtliche Erkenntnis drängt sich auf: Wir stehen vor einem bedeutenden Künstler, dessen Werk in den kommenden Jahrzehnten noch mehr Anerkennung gewinnen wird. Seine Fähigkeit, eine jahrtausendealte malerische Tradition lebendig zu erhalten und gleichzeitig auf zeitgenössische Herausforderungen anzupassen, offenbart eine seltene künstlerische Meisterschaft. Sein Verzicht auf konzeptionelle Bequemlichkeiten und sinnlose Provokationen zeugt von einer ethischen Anspruchshaltung, die die zeitgenössische Kunst ehrt.
Nicola De Marias Werk lehrt uns, dass die wahre Avantgarde manchmal darin besteht, das zu bewahren, was die Moderne zu zerstören droht. Indem er die Verbindung zwischen Kunst und Spiritualität, zwischen Malerei und Architektur, zwischen Individuellem und Kollektiv lebendig erhält, leistet er eine wesentliche kulturelle Schutzarbeit. Seine “Reiche der Blumen” sind Zufluchten, in denen ästhetische und spirituelle Werte bewahrt werden, die unsere Zeit zu schnell aufgegeben hat.
Dieses Werk lädt uns auch ein, unsere Bewertungskriterien der zeitgenössischen Kunst zu überdenken. Formelle Neuheit, kritische Transgression und ironische Dekonstruktion sind nicht die einzigen Qualitätsmaßstäbe für künstlerische Güte. Geduldige Vertiefung einer Forschung, Treue zu einer poetischen Vision, die Fähigkeit zu berühren und zu erheben besitzen eine gleichwertige und vielleicht sogar höhere Legitimität.
Nicola De Maria beweist uns, dass es auch im entfremdeten Kontext der Postmoderne noch möglich ist, eine Kunst zu schaffen, die den Menschen mit seinen höchsten Bestrebungen versöhnt. Seine Installationen schenken uns Momente der Gnade, die die Brutalität des Alltags ausgleichen und diesen “Hunger nach Schönheit” nähren, den die meisten unserer Zeitgenossen heimlich empfinden.
Angesichts seiner Werke verstehen wir, dass wahre Kunst sich nicht damit begnügt, die Welt darzustellen: Sie verwandelt sie, indem sie ihre verborgenen Potenziale offenbart. De Marias “bombenfreie Universen” sind keine Fluchten, sondern Vorzeichen einer möglichen Welt, in der die Schönheit über die Gewalt siegen würde. In diesem Sinne erfüllt diese Kunst ihre höchste prophetische Funktion: Sie erhält die Hoffnung auf eine bessere Zukunft und gibt uns die spirituellen Mittel, sie zu gestalten.
Nicola De Marias Werk erinnert uns daran, dass Kunst trotz aller historischen Wechselfälle ein privilegierter Zugang zum Heiligen bleibt. In einer Welt, die ihre traditionellen spirituellen Orientierungspunkte verloren hat, bieten seine Installationen Rückzugsräume, in denen jeder Kontakt mit jener transzendenten Dimension wiederfinden kann, die das Wesen der Menschlichkeit ausmacht. Diese anthropologische Funktion der Kunst, von den Avantgarden des 20. Jahrhunderts für endgültig aufgehoben gehalten, findet bei De Maria eine beunruhigende Aktualität, die uns über unsere eigenen spirituellen Bedürfnisse nachdenken lässt.
So wird Nicola De Maria weit über die ästhetischen Streitereien seiner Zeit hinaus die Meisterleistung vollbracht haben, die zeitgenössische Kunst mit ihrer ewigen Bestimmung zu versöhnen: die verborgene Schönheit der Welt zu enthüllen und den Menschen Gründe zur Hoffnung zu geben. Dieses Werk, das bereits fünf Jahrzehnte durchschritten hat, wird uns noch lange auf unserer gemeinsamen Suche nach einer Kunst begleiten, die zugleich zeitgenössisch und zeitlos, anspruchsvoll und zugänglich, lokal und universell ist.
- Galerie Lelong & Co., “Nicola De Maria – Regno dei Fiori”, Ausstellungskatalog, Paris, 1988
- Carl Gustav Jung, Der Mensch und seine Symbole, Robert Laffont, Paris, 1964
- ABC-Arte, Interview mit Nicola De Maria, Turin, 2018
- Laura Cherubini, Flaminio Gualdoni, Lea Vergine (Hrsg.), Biennale di Venezia – Padiglione Italia, offizieller Katalog, Venedig, 1990