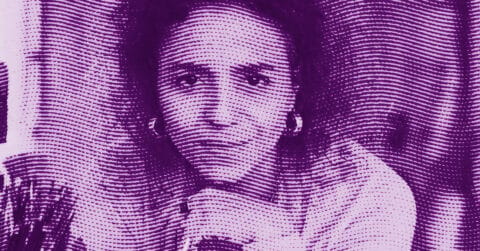Hört mir gut zu, ihr Snobs, das Marketing hat endlich die Kunst verschlungen. Richard Orlinski (geboren 1966 in Paris) verkörpert perfekt diesen Sieg des Kapitalismus über die schöpferische Kunst. Der ehemalige Immobilienmakler, der 2004 zum “Künstler” wurde, bietet uns das traurige Schauspiel einer totalen Industrialisierung der Kunst, die zu einem reinen Konsumgut für eine Gesellschaft verkommt, die nach oberflächlicher Unterhaltung giert.
In diesem künstlerischen Maskenspiel spielt Orlinski die Rolle des perfekten Unternehmers des 21. Jahrhunderts, der mit einer Geschicklichkeit auf den Codes der Popkultur surft, die Andy Warhol selbst erblassen lassen würde. Doch während Warhol die Wiederholung und mechanische Reproduktion als scharfe Kritik an der Konsumgesellschaft nutzte, umarmt Orlinski die reine Warenlogik ohne kritische Distanz. Seine geometrischen Tiere in grellen Farben, seriengefertigt wie Autos auf einer Fließbandproduktion, verkörpern den endgültigen Sieg des Handels über die Kunst.
Dieser Ansatz verweist uns direkt auf die Überlegungen von Theodor Adorno zur Kulturindustrie. In seiner “Dialektik der Aufklärung” zeigte der deutsche Philosoph bereits auf, wie die Standardisierung der Kunst sie ihrer kritischen Substanz entleert und in bloße Unterhaltung verwandelt. Orlinski treibt diese Logik bis zum Höhepunkt: Seine Skulpturen sind nichts anderes als glorifizierte Merchandising-Produkte, unendlich variiert, um jedes Budget zu bedienen, vom kleinen Mickey zu 45 Euro bis hin zum monumentalen Gorilla zu mehreren Millionen.
Der Künstler bekennt stolz seine Absicht, die Kunst “zu demokratisieren”, doch diese vermeintliche Demokratisierung ist in Wirklichkeit nur eine totale Unterwerfung unter die Gesetze des Marktes. Sein “Konzept” Born Wild, das als Marke beim INPI (Institut national de la propriété industrielle in Frankreich) eingetragen ist, illustriert perfekt diese absichtliche Verwechslung von künstlerischer Schöpfung und Marketing. Seine unaufhörlichen Kooperationen mit Luxusmarken und seine Auftritte in Reality-TV-Sendungen oder Radioshows komplettieren die Umwandlung der Kunst in eine bloße Erweiterung der Werbewelt.
Walter Benjamin hatte uns in “Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit” gewarnt: die mechanische Reproduktion drohte, der Kunst ihre “Aura” zu rauben, jene Einzigartigkeit, die ihren kulturellen Wert ausmacht. Orlinski geht noch weiter: Er macht diesen Aura-Verlust zu seinem Geschäftsmodell. Seine industriell reproduzierten Skulpturen versuchen nicht einmal mehr, die Illusion irgendeiner künstlerischen Authentizität aufrechtzuerhalten. Sie tragen ihren Status als Waren offen zur Schau, wie jene Pac-Man-Figuren, die er in Serie für das größte Glück von “Sammlern” anbietet, die nach finanziellen Investitionen suchen.
Orlinskis wahre Leistung ist nicht künstlerisch, sondern unternehmerisch. Er hat begriffen, dass in unserer Gesellschaft des Spektakels, um Guy Debord zu zitieren, das Bild über die Substanz triumphiert. Die künstlerische Leere seiner Produktionen ist dann zweitrangig, solange die Marketingverpackung ausreichend glanzvoll ist. Seine glänzenden Gorillas und chromglänzenden Panther sind nur luxuriöse Avatare einer Gesellschaft, die endgültig jede künstlerische Anspruchsqualität zugunsten reiner Unterhaltung aufgegeben hat.
Diese Industrialisierung der Kunst erreicht ihren Höhepunkt in seinem “Atelier”, das mehr als 150 Personen beschäftigt. Das ist weit entfernt von einem traditionellen Künstleratelier: Es ist eine wahre Serienproduktionsfabrik, in der Werke wie beliebige Konsumgüter hergestellt werden. Die Hand des Künstlers ist verschwunden, ersetzt durch standardisierte industrielle Verfahren, die eine perfekt auf den Markt abgestimmte Produktion garantieren.
Verteidiger Orlinskis werden vielleicht anführen, dass er nur den Spuren von Jeff Koons oder Damien Hirst in dieser Industrialisierung der Kunst folgt. Doch während diese letzten noch eine gewisse kritische Reflexion über den Status des Kunstwerks im Zeitalter seiner totalen Vermarktlichung bewahren, begnügt sich Orlinski damit, die abgegriffenen Codes der Popkultur ohne jede kritische Distanz zu reproduzieren. Seine geometrischen Tiere sind nichts weiter als dreidimensionale Logos, eingetragene Marken, die sich als Merchandising-Produkte wie jede Zeichentrickfigur variieren lassen.
Es ist aufschlussreich, dass seine größten kommerziellen Erfolge Kooperationen mit Disney oder Luxusmarken sind. Kunst ist nichts weiter als ein Vorwand zum Verkauf, eine kulturelle Verpackung, die es ermöglicht, den bitteren Beigeschmack reiner kommerzieller Transaktionen zu kaschieren. Wenn Orlinski erklärt, er wolle die “Codes” der zeitgenössischen Kunst “brechen”, unterwirft er sich in Wirklichkeit nur viel strengeren Codes des Marketings und der Rentabilität.
Diese völlige Unterwerfung unter die kommerziellen Zwänge zeigt sich in einer Ästhetik der Leichtigkeit. Seine Skulpturen sind so gestaltet, dass sie sofort gefallen, ohne Verständnisanstrengung, ohne Auseinandersetzung mit irgendeiner künstlerischen Andersartigkeit. Es ist eine Kunst, die “zugänglich” sein will, aber diese Zugänglichkeit ist nur ein anderer Name für eine Absenkung des Niveaus, für eine Standardisierung, die jegliche Rauheit, jegliche wahre Einzigartigkeit beseitigt.
Ironischerweise präsentiert sich Orlinski als Rebell, der die Konventionen der Kunstwelt erschüttert. In Wirklichkeit ist er nur der versierteste Vertreter eines Systems, das die Kunst in einen gewöhnlichen Wirtschaftszweig verwandelt hat. Seine kommerziellen Erfolge bestätigen nur den vollständigen Sieg des Marktes über die Kunst, die Reduzierung jeglicher Schöpfung auf ihren reinen Marktwert.
Die Tragödie besteht darin, dass dieser Triumph des Marketings über die Kunst nicht einmal mehr als problematisch wahrgenommen wird. Im Gegenteil, er wird als “Demokratisierung” gefeiert, als wäre der Kauf einer Kunststoffreproduktion einer Skulptur für wenige Dutzend Euro ein kultureller Fortschritt. Dabei wird vergessen, dass wahre Kunst nie primär dazu diente, “zugänglich” oder “populär” zu sein, sondern uns mit einer einzigartigen Weltanschauung zu konfrontieren und uns aus unseren intellektuellen und ästhetischen Komfortzonen herauszuführen.
Das Orlinski-System stellt somit den logischen Endpunkt einer Gesellschaft dar, die jeglichen wahren künstlerischen Anspruch zugunsten bloßer kommerzieller Unterhaltung aufgegeben hat. Seine Skulpturen sind nur noch raffinierte Dekorationsobjekte, soziale Marker, mit denen ihre Besitzer ihren vermeintlichen “guten Geschmack” und ihre Kaufkraft zur Schau stellen. Die Kunst ist tot, es lebe das Marketing!
In dieser Welt, in der Kunst nur noch ein Teilbereich der Unterhaltung ist, ist Orlinski tatsächlich ein König. Kein Künstlerkönig, sondern ein Königs-Kaufmann, der verstanden hat, dass der Anschein von Kunst rentabler ist als die Kunst selbst. Seine Werke werden nicht in die Kunstgeschichte eingehen, aber sie werden unser Zeitalter perfekt widerspiegeln: jenes, in dem die Kunst endgültig vor den Marktkräften kapituliert hat.
Diese Kapitulation ist umso auffälliger, als sie ohne jeglichen Widerstand, ohne kritisches Hinterfragen geschieht. Orlinskis Tiere mit ihren glatten Oberflächen und grellen Farben sind die perfekten Totems einer Gesellschaft, die jede Tiefe zugunsten permanenter Schau opfert. Sie sagen uns nichts über die Welt, konfrontieren uns mit keiner Andersartigkeit, fordern uns zu keinem Nachdenken auf. Sie sind einfach da, glänzend und hohl, wie die luxuriösen Schaufenster eines Einkaufszentrums.