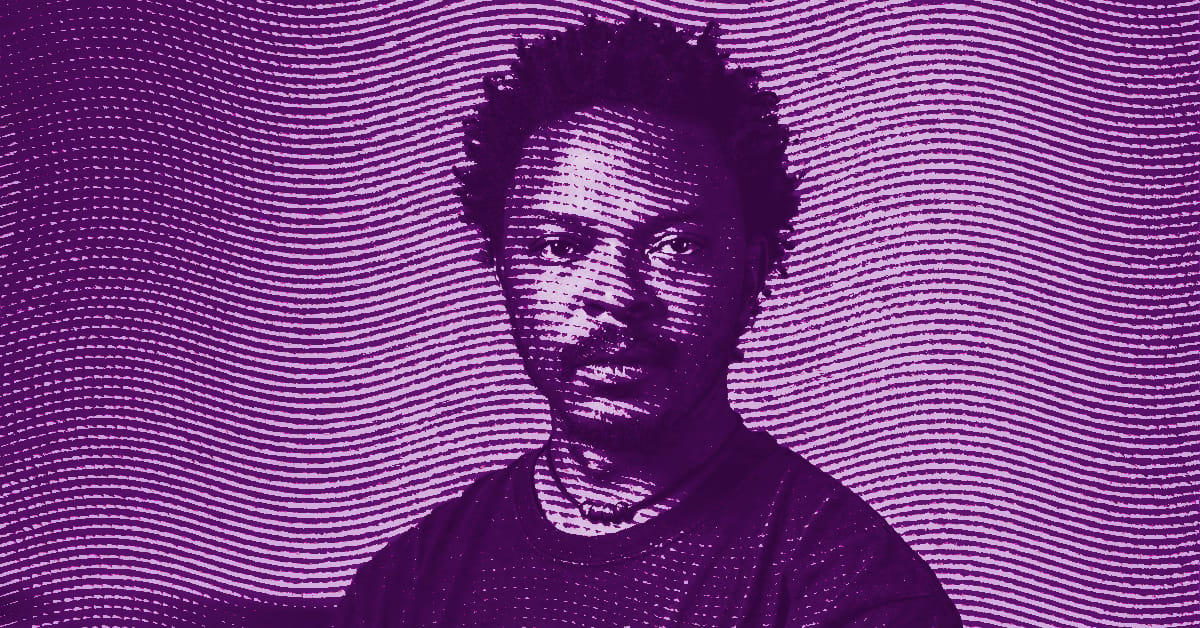Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch vor den neuesten Installationen der zeitgenössischen Kunst begeistert, leistet ein in Lubumbashi geborener Mann seit zwei Jahrzehnten eine Arbeit voller feuriger Intelligenz, die euch sprachlos machen sollte. Sammy Baloji gehört nicht zu den Künstlern, die dem Auge schmeicheln. Er gehört zu denen, die stören, die ausgraben, die zwingen hinzusehen, was man lieber vergessen würde. Fotograf von Beruf, mit einem Abschluss in Literatur und Geisteswissenschaften, bevor er sich an der École Supérieure des Arts Décoratifs in Straßburg auf Video und Fotografie spezialisierte, hat dieser Mann das koloniale Archiv zu seinem Schlachtfeld und die Erinnerung an Katanga zu seiner rettenden Obsession gemacht.
Seine Arbeit begnügt sich nicht damit, den Verfall zu ästhetisieren oder die Verwüstung zu dokumentieren. Er vollzieht eine weitaus gewalttätigere Geste: Er überlagert Zeiten, konfrontiert Bilder, stellt die gegenwärtige kongolesische Situation ihrem kolonialen Erbe gegenüber, als würde man zwei Gegner zwingen, sich ohne Ausweichblick in die Augen zu sehen. Seine Serie Mémoire (2004-2006) läutet diese radikale Methode ein: Fotografien aus kolonialen Archiven spuken in seinen eigenen Aufnahmen der verlassenen Industrieanlagen von Katanga. Das Ergebnis ist eine poetische Brutalität, die sprachlos macht. Aber täuschen wir uns nicht… oder vielmehr ja, täuschen wir uns gemeinsam über die Natur seiner Geste, denn es handelt sich weder um Nostalgie noch um einfache Anprangerung. Es ist eine visuelle Archäologie, die die Schichten der Gewalt freilegt, die sich im Landschaftsbild selbst einschreiben.
Architektur als Instrument der Herrschaft
Beginnen wir mit dem Offensichtlichen, das niemand sehen will: der Architektur. Bei Baloji ist die koloniale Architektur nie nur eine malerische Kulisse oder ein Relikt, das man mit dieser herablassenden Distanz betrachtet, die man exotischen Ruinen angedeihen lässt. Sie ist das vorrangige Herrschaftsinstrument, die Sprache aus Stein und Beton, mit der das belgische Kolonialprojekt geschrieben wurde. Wenn Baloji die verfallenen Gebäude von Yangambi in Aequare. The Future that Never Was (2023) filmt, zeigt er nicht nur bröckelnde Mauern. Er zeigt, wie diese Strukturen weiterhin das Leben der Kongolesen prägen, wie zeitgenössische Arbeiter noch immer die gleichen Räume einnehmen wie ihre Vorgänger zur Kolonialzeit, dieselben Tätigkeiten an denselben Orten verrichten, gefangen in einer räumlichen Geometrie, die von Gewalt geerbt ist.
Die belgische Kolonialplanung im Kongo, insbesondere in Lubumbashi, wo Baloji aufwuchs, folgte einer Logik der räumlichen Apartheid, die von Architekturhistorikern gut dokumentiert wurde [1]. Die Stadt wurde ex nihilo im Jahr 1910 gegründet und nach dem Prinzip der Rassentrennung organisiert, mit ihrem berühmten 500 Meter langen “Sicherheitsgürtel”, der die europäischen Viertel von den afrikanischen Siedlungen trennte. Diese Distanz, angeblich durch gesundheitliche Überlegungen im Zusammenhang mit Malaria gerechtfertigt, zeichnete in Wirklichkeit eine Karte der kolonialen Hierarchie, die im Boden selbst verankert war. Baloji erklärte, er habe seine “Kindheit in einer Stadt verbracht, die vollständig um die industrielle Realität und die Ausbeutung der Bergbaurressourcen organisiert war”. Diese Stadt ist Lubumbashi, früher Élisabethville, die Kupferkathedrale und ein Denkmal des Ruhms der Union Minière du Haut-Katanga.
In Still Kongo I-V (2024) entfaltet Baloji eine Strategie von bemerkenswerter Feinheit. Er rahmt Archivluftaufnahmen, die den kongolesischen Wald in den Jahren 1958-1959 zeigen, in Afzelia-Holzrahmen ein, die mit Mustern verziert sind, die vom belgischen Jugendstil inspiriert sind. Diese scheinbar dekorative Geste birgt eine beträchtliche konzeptuelle Gewalt. Der Jugendstil, der den Ruhm Brüssels begründete, trug ursprünglich den Namen “Style Congo” in Anlehnung an die Materialien und Muster aus dem Kongo, die ihn inspirierten. Hier haben wir also den kompletten Kreislauf der Extraktion: Die Ressourcen verlassen den Kongo, bereichern Europa, erzeugen dort ästhetische Bewegungen, die als Gipfel der westlichen Raffinesse gefeiert werden, bevor sie in Form von Rahmen zurückkehren, die genau die Bilder der Zerstörung einfassen, die sie verursacht haben.
Die kolonialen Gebäude, die Baloji fotografiert und filmt, sind keine passiven Zeugen der Geschichte. Sie sind aktive Agenten der Fortsetzung kolonialer Strukturen. Die neo-romanische Kathedrale von Lubumbashi, gebaut 1921, blockierte absichtlich die Sicht auf den Park und den Wohnsitz des Gouverneurs vom Stadtzentrum aus und markierte physisch die koloniale Macht im urbanen Raum. Die von der Union Minière du Haut-Katanga errichteten Arbeitersiedlungen bildeten autonome Einheiten mit Wohnungen, Schulen und Krankenstationen, totalitäre Mikrokosmen, in denen die Gesellschaft jeden Aspekt des Lebens der Arbeiter kontrollierte. Diese paternalistische Architektur, die sich als wohltätig verstand, war nur eine raffinierte Form der sozialen Kontrolle.
Baloji versteht, dass koloniale Architektur niemals neutral ist. Sie verkörpert eine Philosophie der Herrschaft, die weit über die formale Unabhängigkeit hinaus fortbesteht. Stadtpläne, Straßenführungen, die Anordnung öffentlicher Gebäude, all das strukturiert weiterhin den Alltag der Kongolesen nach Logiken, die aus der Unterdrückung stammen. Wenn er in seinen Installationen kongolesische Pflanzen neben Kupfergeschosshülsen zeigt, die von belgischen Haushalten zu Blumentöpfen umfunktioniert wurden, offenbart er, wie selbst die europäische Häuslichkeit Teil der extraktivistischen Kette ist. Das aus Katanga abgebaute Kupfer, das im Ersten Weltkrieg zu Granaten verarbeitet wurde und dann in belgischen Bürgerhäusern zu dekorativen Gegenständen recycelt wird: das ist der obszöne Lebenszyklus eines Materials, das die Erinnerung an vielfältige Gewalttaten in sich trägt.
Die Philosophie der Erfindung und der Zerstörung
Wenn Architektur bei Baloji die sichtbare Sprache der Herrschaft ist, so muss man sich zur Philosophie wenden, um die epistemologischen Mechanismen zu verstehen, die diese Herrschaft möglich gemacht haben. Der Künstler nennt die Philosophie nicht zufällig in seinen Werken. In Tales of the Copper Cross Garden, Episode I (2017) verwebt er Bilder einer Kupfergießerei mit Auszügen aus den autobiografischen Schriften von Valentin-Yves Mudimbe, einem kongolesischen Philosophen und Dichter, dessen monumentales Werk L’Invention de l’Afrique (1988) die Auffassung von Wissen über Afrika revolutioniert hat [2].
Mudimbe hat gezeigt, dass Afrika, so wie es im westlichen Imaginaire existiert, eine Konstruktion ist, eine Erfindung, die von einem kolonialen Diskursapparat produziert wurde, der Anthropologie, Kartographie, zivilisatorische Mission und Naturwissenschaften einschloss. Was Mudimbe die “koloniale Bibliothek” nennt, dieses Ensemble von Texten, Klassifikationen und Karten, die Afrika von außen definierten, findet sein visuelles Äquivalent in Balojis Arbeit. Die fotografischen Archive, die der Künstler ausgräbt und reaktiviert, sind genau die Instrumente dieser “Erfindung”: Sie dienten dazu, die Kongolesen zu katalogisieren, zu klassifizieren, zu essentialisieren und auf ethnographische Exemplare zu reduzieren.
Der künstlerische Gestus von Baloji ist tief im Geist von Mudimbe verankert in seinem Ansatz. Er sucht nicht, ein “wahres” Afrika einem erfundenen Afrika entgegenzustellen, sondern die Mechanismen dieser Erfindung selbst aufzudecken, zu zeigen, wie die Werkzeuge kolonialen Wissens, Fotografie, geologische Kartographie und Stadtpläne, an der Konstruktion eines Afrikas mitwirkten, das für die Ausbeutung verfügbar ist. Die farbigen geologischen Karten, die er in Extractive Landscapes (2019) zeigt, sind keine bloßen technischen Dokumente. Sie sind Machtinstrumente, die das kongolesische Territorium in Abbaugebiete zerschneiden, es auf seine Minerale reduzieren und jede historische und kulturelle Tiefe auslöschen, um nur den Handelswert des Untergrundes zu behalten.
Mudimbe betonte auch die Rolle der katholischen Kirche im kolonialen Unternehmen. Die Missionare kamen nicht nur, um “Seelen zu retten”; sie beteiligten sich aktiv am Projekt der Umgestaltung afrikanischer Subjektivitäten. Diese Dimension erfasst Baloji mit bemerkenswerter Schärfe. In Tales of the Copper Cross Garden sind die Chorgesänge, die die Bilder der Gießerei begleiten, kein bloßer musikalischer Gegenpunkt. Sie rufen die kleinen kongolesischen Sänger hervor, die Kupferkreuze vor ihrer Brust halten, ein Symbol doppelter Ausbeutung: jene des Metalls und jene der Seele. Wie Baloji es mit schneidender Klarheit formulierte: “Nichts weniger als die Kupferkreuze, die vor dem Herzen der Ministranten gehalten werden, deutet darauf hin, wie die Missionare versucht haben, ihre Seelen zu stehlen, während sie gleichzeitig die lokalen Kupferressourcen zum Vorteil der Europäer ausbeuteten”.
Der kongolesische Philosoph war in einem kolonialen Seminar aufgewachsen, eine Erfahrung, die sein gesamtes Werk nährte. Baloji hingegen wuchs in einer reinen Bergbaustadt auf. Beide verstehen instinktiv, wie der Kolonialismus sich nicht damit begnügte, Ressourcen auszubeuten: Er versuchte, Bewusstseine umzugestalten, neue Denkkategorien aufzuzwingen, lokale Wissenssysteme zu zerstören, um sie durch westliche Taxonomien zu ersetzen. Die Kupferkreuze aus Katanga, die Baloji zeigt, diese Objekte, die zwischen dem 13. und dem 20. Jahrhundert als Währung dienten, zeugen von einem komplexen wirtschaftlichen und symbolischen System, das der Kolonialisierung vorausging. Die Ankunft der Union Minière du Haut-Katanga machte diese Kreuze obsolet, reduzierte sie zu bloßen ethnographischen Kuriositäten.
Diese Zerstörung der lokalen Wertsysteme zugunsten westlicher Marktwirtschaften steht im Mittelpunkt von Balojis Arbeit. Wenn er kostbare Stoffe aus dem Königreich Kongo in seiner Serie Copper Negative of Luxury Cloth Kongo Peoples (2017) zu Bronze- und Kupfer-„Negativen” verarbeitet, vollzieht er eine symbolische Aneignungsgeste. Diese Textilien aus Raphia-Palmenfasern, deren Feinheit mit Samt vergleichbar ist, zirkulierten einst in europäischen Kuriositätenkabinette, bevor sie auf den Status ethnographischer Artefakte reduziert wurden. Baloji gießt sie buchstäblich in kongolesisches Metall um, so als wolle er den Prozess der Entkontextualisierung und Verdinglichung, dem sie unterlagen, umkehren.
Die philosophische Dimension von Balojis Werk liegt auch in seiner Ablehnung jeglicher Nostalgie. Er versucht nicht, eine mythische vorkoloniale Vergangenheit wiederherzustellen, was in die Falle des von Mudimbe kritisierten Essentialismus führen würde. Im Gegenteil, er arbeitet in den Zwischenräumen, in den Grauzonen, in denen Vergangenheit und Gegenwart, Archive und zeitgenössische Schöpfung miteinander verschmelzen. Seine Installation Gnosis (2022), präsentiert im Palazzo Pitti in Florenz, zeigte einen riesigen schwarzen Glasfaserglobus, umgeben von Reproduktionen historischer Karten Afrikas. Der Titel, „Gnosis”, bezieht sich direkt auf den Untertitel von Mudimbes Werk: Gnose, philosophie et ordre de la connaissance. Baloji weiß, dass es nicht darum geht, eine „wahre” Darstellung Afrikas zu erzeugen, die koloniale Falschdarstellungen korrigieren würde. Die Frage ist, wie Wahrheitsregime entstehen, wie Ordnungen des Wissens geschaffen werden, die manche Erkenntnisse legitimieren und andere mundtot machen.
Hin zu einer Ethik der Erinnerung
Was macht Sammy Baloji also im Grunde? Er betreibt das, was man als eine kritische Archäologie der Gegenwart bezeichnen könnte. Jedes seiner Werke ist eine Ausgrabung, die die Schichten von Gewalt, Ausbeutung und Zerstörung freilegt, die das Fundament der kongolesischen Moderne bilden. Aber im Gegensatz zu klassischen Archäologen, die ausgraben, um besser musealisieren zu können, gräbt Baloji aus, um zu reaktivieren, um diese verborgenen Geschichten im Hier und Jetzt lebendig werden zu lassen. Seine Bilder sind keine leblosen Dokumente: Sie sind Apparate, die den Blick erzwingen, die dazu zwingen, die Kontinuität zwischen kolonialer Vergangenheit und zeitgenössischen Formen neokolonialer Ausbeutung anzuerkennen.
Das Kobalt und Lithium, das heute unsere Handys und Elektroautos antreibt, stammen aus denselben Katanga-Minen, die früher Kupfer für die Elektrifizierung Europas und Uran für die Atombomben von Hiroshima und Nagasaki lieferten. Diese obszöne Kontinuität macht Baloji sichtbar in Shinkolobwe’s Abstraction (2022), einer Serie von Siebdrucken, die kongolesische Uranproben und Bilder von Nuklearexplosionen übereinanderlegen. Die Botschaft ist brutal klar: Das Atom, das Hiroshima dem Erdboden gleichmachte, stammte aus Katanga. Die Energie, die die westliche “ökologische Transition” antreibt, beruht auf demselben extraktivistischen Prinzip, das den Kongo über ein Jahrhundert lang zerstörte.
Baloji bietet keinen Trost, keine einfache Lösung. Seine Arbeit ist unangenehm, weil er redemptive Erzählungen ablehnt. Er feiert nicht die afrikanische “Resilienz”, dieses Allerweltskonzept, das die Westler so gerne verwenden, um historische Verantwortung zu vermeiden. Im Gegenteil zeigt er, wie koloniale Strukturen fortbestehen, wie Architektur weiterhin einschränkt und wie extraktive Logiken unter neuen Gewändern erneuert werden. Die Arbeiter in Yangambi besetzen immer noch dieselben Gebäude, erfüllen dieselben botanischen Klassifizierungsaufgaben nach denselben Protokollen wie zur Kolonialzeit. Das sogenannte unabhängige Kongo bleibt in den Netzen einer strukturellen Abhängigkeit gefangen, die ihren Namen nicht mehr nennt.
Dennoch wäre es falsch, Balojis Arbeit als bloße Anklage zu sehen. Was Baloji Werk für Werk aufbaut, ist eine Ethik des Gedenkens, die sowohl das Vergessen als auch die Fossilisierung des Erinnerns ablehnt. Seine Archive dienen nicht dazu, Ressentiments zu nähren oder selbstgefällige Opfermentalität zu bestärken. Sie dienen dazu, die Gegenwart zu erhellen und ein kompromissloses Verständnis der weiterhin wirksamen Mechanismen zu ermöglichen. Wie er selbst betont hat: “Was mich als Künstler interessiert, ist, wie wir einen alternativen Diskurs schaffen, wie wir uns den etablierten Denkweisen der Kolonialzeit entgegenstellen und ihre Grenzen und Schwächen identifizieren.”
Vielleicht ist dies Balojis radikalste Geste: sich nicht damit zufriedenzugeben, koloniale Diskurse anzuprangern, sondern ihre Schwachstellen, ihre brüchigen Stellen und die Zwischenräume zu suchen, durch die andere Erzählungen, andere Wissensordnungen hervorgehen können. Seine Arbeit als Mitbegründer der Biennale in Lubumbashi seit 2008 folgt genau dieser Logik. Es geht nicht nur darum, kongolesische Künstler auszustellen, sondern die intellektuellen und institutionellen Infrastrukturen zu schaffen, die es diesen Künstlern ermöglichen, ihre Werke zu ihren eigenen Bedingungen zu produzieren und zu verbreiten, ohne die Filter und Validierungen des westlichen Kunstmarkts durchlaufen zu müssen.
Die Radikalität von Sammy Baloji liegt in dieser methodischen Geduld, dieser Forscherdisziplin, die einer künstlerischen Vision dient, die niemals Kompromisse bei der Komplexität eingeht. Er vereinfacht nicht, er spektakularisiert nicht, er macht aus der kolonialen Grausamkeit kein ästhetisches Konsumprodukt. Seine Werke verlangen Zeit, Aufmerksamkeit, eine intellektuelle Anstrengung, die viele Zuschauer nicht bringen wollen. Pech für sie. Baloji arbeitet nicht für den Komfort des westlichen Publikums. Er arbeitet daran, ein Gedächtnis zu bergen, einer Geschichte Gestalt zu geben, die unter den Trümmern kolonialer Gebäude begraben bleiben soll. Und in dieser Ausgrabungsarbeit erfüllt er vielleicht eine der notwendigsten Aufgaben der zeitgenössischen Kunst: uns dazu zu zwingen, der Barbarei ins Gesicht zu sehen, die unsere Moderne schuldet und den Preis, den unser Wohlstand weiterhin von anderen fordert.
- Lagae, Johan, “Rewriting Congo’s Colonial Past: History, Memory, and Colonial Built Heritage in Lubumbashi, Democratic Republic of the Congo”, in Repenser les limites : l’architecture à travers l’espace, le temps et les disciplines, Publications de l’Institut national d’histoire de l’art, 2017
- Mudimbe, Valentin-Yves, Die Erfindung Afrikas : Gnosis, Philosophie und Wissensordnung, Présence africaine, 2021 (Originalausgabe in Englisch: Indiana University Press, 1988)