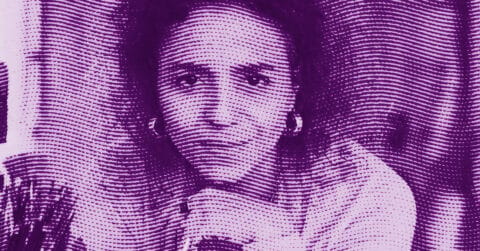Hört mir gut zu, ihr Snobs! Sarah Morris (geb. 1967) ist nicht einfach eine Künstlerin, die hübsche farbige Raster malt, um eure sterilen Wohnzimmer zu dekorieren. Sie ist eine der wenigen, die verstanden hat, dass die geometrische Abstraktion nicht mit Mondrian gestorben ist, sondern uns immer noch von unserer hyperkapitalistischen, überindustrialisierten und paradoxerweise entfremdeten Welt erzählen kann.
Schaut euch ihre monumentalen Gemälde an, diese mathematischen Kompositionen, die wie aus einem Handbuch der nicht-euklidischen Geometrie zu stammen scheinen. Diese Werke sind nicht da, um in euren Design-Innenräumen hübsch auszusehen. Sie spiegeln unerbittlich unsere algorithmische Gesellschaft wider, in der jede Entscheidung von Datenmatrizen diktiert wird. Morris verwendet industrielle Glyzophtalat-Farbe, wie man sie in jedem Baumarkt findet. Eine radikale Wahl, die an Walter Benjamins Denken zur technischen Reproduzierbarkeit von Kunst anknüpft. Sie verwandelt dieses banale Material in glänzende Oberflächen, die wie verzerrte Spiegel unserer urbanen Realität wirken.
Ihre letzten Serien “Sound Graph” und “Spiderweb” sind besonders eindrucksvoll. Diese Gemälde scheinen das Wesen dessen einzufangen, was Gilles Deleuze als “Kontrollgesellschaften” bezeichnete. Die Linien kreuzen sich wie Informationsflüsse und erzeugen Spannungsknoten, die an die neuralgischen Punkte unserer überwachten Metropolen erinnern. Das Raster ist nicht mehr nur ein formal übernommenes Element des Modernismus, es wird zur erschreckenden Metapher unseres von Algorithmen durchdrungenen Lebens.
Aber Morris begnügt sich nicht nur mit dem Malen. Sie filmt auch unsere Städte mit chirurgischer Präzision, die Dziga Vertov als Amateur erscheinen lassen würde. Ihre Filme wie “Rio”, “Peking” oder “Abu Dhabi” sind keine einfachen touristischen Dokumentationen. Sie sind schonungslose Analysen dessen, was Guy Debord “gesellschaftliches Spektakel” nannte. Sie fängt diese Metropolen in ihrer architektonischen Überwältigung, ihrem kapitalistischen Hochmut und ihrem pathologischen Kontrollwunsch ein.
In “Finite and Infinite Games” (2017) treibt sie ihre Reflexion noch weiter, inspiriert von den Theorien von James P. Carse. Sie zeigt uns, wie zeitgenössische Architektur, verkörpert durch die Elbphilharmonie in Hamburg, zum Schauplatz eines Kampfes zwischen zwei Weltanschauungen wird: dem endlichen Spiel (um jeden Preis zu gewinnen) und dem unendlichen Spiel (um weiterzuspielen).
Ihre Arbeit ist eine Ohrfeige für Befürworter einer dekorativen und harmlosen Kunst. Sie nutzt die Codes der geometrischen Abstraktion nicht, um dekorative Werke zu schaffen, sondern um die Machtmechanismen zu sezieren, die unsere Gesellschaften beherrschen. Ihre Gemälde und Filme funktionieren wie Röntgenaufnahmen unserer Zeit, enthüllen die unsichtbaren Strukturen, die uns binden.
Sarah Morris verwandelt kalte Daten, seien es Architekturpläne, Wirtschaftsstatistiken oder Tonaufnahmen, in viszerale ästhetische Erfahrungen. Es gelingt ihr ein seltenes Kunststück: das Unsichtbare sichtbar zu machen, ohne didaktisch zu werden. Ihre Werke konfrontieren uns mit der Realität unserer Stadtmaschinen, jener Megastädte, die uns das Paradies versprechen und uns zugleich in goldene Raster einsperren.
Allen, die denken, zeitgenössische Kunst müsse sich mit Dekorativem begnügen, stellt Morris eine radikal politische Praxis entgegen. Sie greift die formalen Waffen des Modernismus, Raster, reine Farbe, Geometrie, auf und richtet sie gegen das System, das sie von ihrer revolutionären Substanz entleerte. Ihre Gemälde sind visuelle Viren, die sich in die aseptischen Räume des Spätkapitalismus einschleichen, um dessen Widersprüche aufzudecken.
Die Art und Weise, wie sie Malerei und Kino verbindet, ist besonders bedeutsam. Diese beiden scheinbar gegensätzlichen Medien ernähren sich gegenseitig in einer faszinierenden Dialektik. Ihre Filme dokumentieren die brutale Realität unserer Metropolen, während ihre Gemälde deren zugrundeliegende Strukturen abstrahieren. Genau das nannte Fredric Jameson die “kognitive Kartografie” des Spätkapitalismus.
Ihre Installation “Ataraxia” (2019) treibt diese Logik auf die Spitze. Indem sie die Wände eines gesamten Raumes mit geometrischen Mustern bedeckt, schafft sie einen mentalen Raum, der gleichermaßen an Kontrollräume multinationaler Konzerne wie an gepolsterte Zellen von Irrenanstalten erinnert. Die Ataraxie, jener von stoischen Philosophen angestrebte Zustand unerschütterlicher Ruhe, wird hier zum Symptom einer Gesellschaft, die durch ihre eigenen Kontrollmechanismen betäubt ist.
Während die Architektur heutzutage zum bewaffneten Arm des Finanzkapitalismus geworden ist, bei dem Wolkenkratzer weniger Gebäude als dreidimensionale Grafiken der Immobilienspekulation sind, stellt Morris grundlegende Fragen: Wer kontrolliert den Raum? Wie prägt die Geometrie der Macht unser Leben? Ihre Werke sind Sehmaschinen, die es uns ermöglichen, das zu sehen, was wir nicht sehen wollten.
Täuschen Sie sich nicht: Hinter der formalen Eleganz ihrer Kompositionen verbirgt sich eine scharfe Kritik an unserer späten Moderne. Morris ist keine Dekorateurin für multinationale Lobbygruppen, sie ist eine Anatomin des zeitgenössischen Kapitalismus. Sie seziert die Machtstrukturen mit der Präzision eines Chirurgen und der zurückgehaltenen Wut einer Aktivistin.