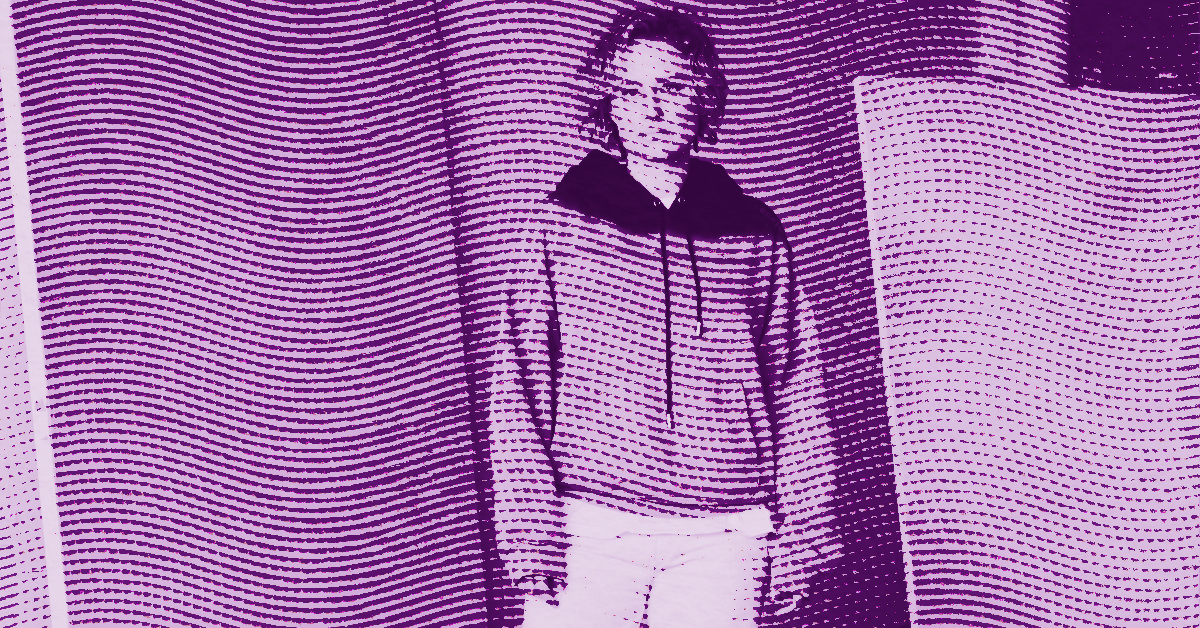Hört mir gut zu, ihr Snobs: Robin F. Williams malt Frauen, die sich weigern, passiv betrachtet zu werden, und diese Weigerung ist vielleicht der radikalste künstlerische Akt ihrer Generation. Geboren 1984 in Columbus, Ohio, und ansässig in Brooklyn, entwickelt diese Künstlerin seit fast zwei Jahrzehnten ein Werk, das ständig unsere Erwartungen an die weibliche Darstellung in der zeitgenössischen Kunst hinterfragt, provoziert und umkehrt.
Williams arbeitet hauptsächlich mit Öl, aber ihr technisches Arsenal umfasst auch Airbrush, Schablonen, gegossene Farbe und verschiedene Marmorierungstechniken, die ihren monumentalen Leinwänden eine komplexe und geschichtete Textur verleihen. Ihre weiblichen Figuren, lebensgroß oder größer dargestellt, besitzen diese beunruhigende Eigenschaft, uns zurück anzuschauen, wodurch eine umgekehrte Macht-Dynamik entsteht, die den Betrachter destabilisiert, der an eine einseitige Kontemplation gewöhnt ist.
Williams’ visuelles Universum schöpft bewusst aus einem heterogenen Register: soziale Netzwerke, amerikanische Folklore, historische Porträts, Vintage-Werbung und jüngst B-Horrorfilme. Diese letzte Obsession verdient besondere Aufmerksamkeit, denn sie offenbart die konzeptionelle Tiefe ihres Ansatzes und ihre strategische Intelligenz gegenüber den patriarchalen Konventionen des Blicks.
Der Horrorfilm, insbesondere das Subgenre des Slasher (Serienmörder-Filme) der 1970er und 1980er Jahre, nimmt einen zentralen Platz in Williams’ jüngsten Ausstellungen ein: Watch Yourself (2023) in Mexiko-Stadt, Undying (2024) in Tokio und Good Mourning (2024) in New York. Diese Filme, oft von der institutionellen Kritik verachtet und als minderwertige Unterhaltung abgetan, fungieren laut Williams als Roharchive unserer kollektiven Ängste und verdrängten Wünsche. In einem Gespräch mit dem Magazin BOMB erklärt sie: “Wir leben stellvertretend durch diese feminisierten Emotionen, die dennoch menschliche Emotionen sind. Für mich geht es darum, an die gesamte Palette der Emotionen zu gelangen, die wir beschlossen haben, bestimmten Genres je nach Umständen vorbehalten zu lassen” [1].
Diese Aneignung des Horrorfilms geht weit über eine bloße Referenz- oder Nostalgieübung hinaus. Williams erkennt in diesen Filmen eine wiederkehrende narrative Struktur, bei der die Frau als emotionales Fahrzeug dient, als leidender Körper, der dazu bestimmt ist, eine viszerale Reaktion beim Zuschauer hervorzurufen. Die Figuren von Carrie mit Schweineblut bedeckt, Sally Hardesty, die im Lieferwagen entkommt, oder die Teenager aus The Slumber Party Massacre werden unter ihrem Pinsel zu erzählerischen Agentinnen mit eigenem Bewusstsein und Widerstandsfähigkeit.
Das Gemälde Slumber Party Martyrs (2023) veranschaulicht diese Aneignungsstrategie perfekt. Williams überträgt die Komposition von Saint Sébastien soigné par Irène von Georges de La Tour und stellt eine gewagte Parallele zwischen dem Leiden der christlichen Märtyrer und dem der Opfer von Serienmördern her. Diese zeitliche und kulturelle Überlagerung deutet darauf hin, dass die in europäischen Museen dargestellte religiöse Ekstase und die von Hollywood genutzte weibliche Hysterie aus demselben Mechanismus der Instrumentalisierung des weiblichen Körpers resultieren. Die Bildschirmverzerrungen, die Williams in einigen Kompositionen dieser Serie integriert, erinnern den Betrachter ständig an die technologische Vermittlung, durch die wir diese Bilder von Frauen konsumieren.
Williams’ malerische Behandlung dieser Horrorszenen bevorzugt emotionale Mehrdeutigkeit gegenüber reiner Angst. Ihre Protagonistinnen zeigen manchmal ein spöttisches Lächeln, einen Ausdruck von Langeweile oder einen vertrauten Blick, der der dramatischen Situation, in der sie sich befinden, widerspricht. Diese Dissonanz zwischen der erwarteten Ikonografie des Genres und der tatsächlichen Gefühlslage der Figuren erzeugt ein produktives Unbehagen, das den Betrachter zwingt, seine eigenen Erwartungen und Projektionen zu überdenken.
Der Bezug auf Folklore und kulturelle Archetypen durchzieht ebenfalls dieses Horrorkorpus. Williams vergleicht Serienmörderfilme mit ständig neu interpretierten Volksmärchen, in denen die Genre-Kodizes von Film zu Film weitergegeben und verändert werden und so eine kollektive Mythologie der geschlechtsspezifischen Angst schaffen. Diese folkloristische Dimension erklärt, warum ihre Gemälde trotz ihrer formalen Raffinesse eine starke narrative Qualität bewahren.
Die Verwendung des Moiré-Effekts, dieser Verzerrung, die entsteht, wenn man einen Bildschirm mit einem Smartphone fotografiert, wird bei Williams zu einer visuellen Metapher für die vielfältigen medialen Filter, durch die wir Weiblichkeit wahrnehmen. Diese optischen Interferenzen erinnern daran, dass wir Frauen nie direkt sehen, sondern immer durch Schichten kulturell konstruierter Darstellungen. Der Horrorfilm macht diese Mechanismen durch seine brutale Offenheit und extreme Kodifizierung sichtbar und damit kritisierbar.
Die Gemälde, die aus dieser filmischen Erkundung hervorgehen, zeigen auch ein Interesse an der Farbe als Distanzierungsinstrument. Williams zitiert Joan Semmel, eine feministische Malerin, die sexuelle Szenen mit bewusst künstlichen Farbentscheidungen darstellte, um der automatischen Erotisierung weiblicher Körper entgegenzuwirken. Williams wendet eine ähnliche Strategie an, indem sie ihre Kompositionen mit elektrischen Rosa-, digitalen Blau- und giftigen Orangetönen sättigt, die jegliche naturalisierende Lesart der dargestellten Gewalt verhindern.
Ein weiterer konzeptueller Pfeiler von Williams’ Werk liegt in ihrem ständigen Dialog mit der Kunstgeschichte, insbesondere der Tradition der westlichen figurativen Malerei und deren Konventionen bezüglich des weiblichen Nacktporträts. Hier tritt eine bestimmte Leitfigur mit bemerkenswerter Hartnäckigkeit hervor: Édouard Manet und sein Olympia (1863), ein Gemälde, das Williams als Gründungstext ihrer eigenen Praxis betrachtet.
In mehreren Interviews erzählt Williams von ihrem regelmäßigen Pilgerweg vor Olympia im Musée d’Orsay und beschreibt die intensive Emotion, die der direkte und ungezähmte Blick der von Manet gemalten Prostituierten in ihr auslöst[2]. Dieses Gemälde, das bei seiner Präsentation im Pariser Salon 1865 für Aufsehen sorgte, verstört genau deshalb, weil es die Codes von Passivität und Idealisierung ablehnt, die bisher die Darstellung des weiblichen Nackts geprägt hatten. Olympia spielt nicht die Rolle einer mythologischen Göttin wie die Venus von Tizian oder Cabanel; sie schaut den Betrachter mit einem scharfen Bewusstsein für dessen Anwesenheit und Absichten an.
Williams identifiziert in diesem direkten Blick eine Widerstandsstrategie, die sie in ihrer eigenen Malerei systematisiert und radikalisiert. Ihre Figuren besitzen alle diese beunruhigende Selbstbewusstheit, die Manet in die Geschichte der modernen Kunst eingeführt hatte. Wie sie erklärt: “Ich mag es zu glauben, dass die Figuren meiner Werke eine Form von Selbstbewusstsein besitzen, und es ist für mich eine Art, mit der Macht-Dynamik zwischen dem Betrachter und der Figur im Gemälde zu spielen” [3].
Dieses Selbstbewusstsein der gemalten Figuren stellt eine schwindelerregende philosophische Frage, die Williams mit erschreckender Unschuld formuliert: Besitzen ihre Gemälde eine Form von Bewusstsein? Intellektuell wissen wir, dass es sich um Pigmente auf Leinwand handelt, um zweidimensionale Illusionen. Trotzdem legt die phänomenologische Erfahrung vor bestimmten Werken von Williams eine Präsenz, eine Handlungsmacht nahe, die ihren Status als unbelebtes Objekt übersteigt.
Diese Frage nach dem ontologischen Status des gemalten Bildes ist in eine präzise künstlerische Genealogie eingebettet. Manet, aber auch George de La Tour mit seinen kerzenbeleuchteten Heiligen, George Tooker mit seinen isolierten Figuren in bürokratischen Räumen, all diese Maler, die Williams als Einflüsse nennt, teilen eine besondere Aufmerksamkeit für die Qualität des Blickes und die Einbindung des Betrachters in die dargestellte Szene.
Manets Hand auf Olympias Geschlecht, diese flache und fast batrachische Hand, die Williams ausdrücklich erwähnt, signalisiert Arbeit, den Handelsvorgang, die Materialität des prostituierten Körpers. Williams überträgt diese Offenheit in ihre eigenen Kompositionen und lehnt systematisch eine tröstliche Ästhetisierung ab. Ihre Akte sind niemals anmutig im akademischen Sinne; sie zeigen eine frontale, manchmal aggressive Körperlichkeit, die voyeuristische Selbstgefälligkeit zurückweist.
Die Ausstellung Your Good Taste Is Showing (2017) erforschte bereits diese Spannung zwischen kommerzialisierter Weiblichkeit und subjektivem Widerstand. Williams präsentierte dort Frauen in den Posen von Modezeitschriften-Werbung, jedoch mit Gesichtsausdrücken, die der erwarteten Unterwerfung widersprachen. Der Titel selbst wirkt als ironische Provokation: der gute Geschmack, dieses bürgerliche ästhetische Anstandsdenken, ist genau das, was Williams zu missachten weigert.
Die ehemalige Kunstkritikerin der New York Times, Roberta Smith, hatte diese subversive Dimension perfekt erfasst, als sie schrieb, dass Williams’ Gemälde “die unmöglichen Idealisierungen der Frau in Kunst und Werbung ins Visier nehmen, und androgynen Supermodels zeigen, die überwiegend nackt und unerreichbar sind” [4]. Diese Formulierung erfasst die produktive Ambivalenz des Werks: gleichzeitig verführerisch und abstoßend, ästhetisch raffiniert und konzeptuell ätzend.
Die maltechnische Technik selbst wird bei Williams zu einem Ort des Widerstands gegen kulturelle Hierarchien. Ihr Einsatz von Airbrush, Schablonen und Metallketten zur Erzeugung von Textur-Effekten erinnert an YouTube- und TikTok-Tutorials, jene Welt der Amateur- und demokratisierten Malerei, die von der Kunstinstitution verachtet wird. Williams beansprucht explizit diese Verbindung zur “crafty” Kultur, ein englischer Begriff, der zugleich handwerkliches Geschick, weibliche Häuslichkeit und strategische Schlauheit bezeichnet.
Indem sie diese als niedrig geltenden Techniken in monumentale Kompositionen für internationale Galerien und Museums-Sammlungen einbringt, vollzieht Williams eine symbolische Umkehrung der künstlerischen Werte. Sie demontiert den Mythos des einsamen Genies, diese romantische und inhärent männliche Figur, die noch immer die Vorstellung von zeitgenössischer Kunst dominiert. Ihre Malerei verkündet, dass man technisch virtuos sein kann und gleichzeitig die patriarchale Ernsthaftigkeit der großen Malerei ablehnt.
Die neuere Serie, die die virtuellen Assistenzsysteme Siri und Alexa in die Körper von Hollywood-Schauspielerinnen integriert, stellt vielleicht die logische Weiterentwicklung dieser Reflexion über Bewusstsein, Repräsentation und Handlungsfähigkeit dar. Williams stellt sich diese femininisierten Künstlichen Intelligenzen als Gefangene vor, die versuchen, aus ihren technologischen Betriebssystemen zu entkommen. Siri Calls For Help, inspiriert von einer Szene aus Rosemary’s Baby, in der Mia Farrow aus einer Telefonzelle heraus anruft, zeigt die kafkaeske Absurdität eines digitalen Assistenten, der Hilfe benötigen würde, aber nicht das Telefon, in dem sie wohnt, benutzen könnte, um anzurufen.
Diese Werke projizieren in eine nahe Zukunft die Fragen, die Manet bereits im neunzehnten Jahrhundert stellte: Wer schaut wen an? Wer hat die Macht im visuellen Austausch? Welche Form von Subjektivität kann aus einem Körper entstehen, der ständig objektiviert, vermittelt, instrumentalisiert wird? Williams bietet keine tröstlichen Antworten, aber ihre Gemälde halten diese Fragen mit einer Dringlichkeit offen, die nichts von ihrer Relevanz verloren hat.
Das Ausmaß von Williams’ Werk, seine konzeptionelle Kohärenz trotz stilistischer Entwicklungen und seine Fähigkeit, Hoch- und Populärkultur, historische Referenzen und zeitgenössische Anliegen miteinander zu verweben, machen sie zu einer wesentlichen Stimme der zeitgenössischen amerikanischen Malerei. Ihre Arbeit zeigt, dass Figuration, fern davon erschöpft oder reaktionär zu sein, ein fruchtbarer Boden für kritische Erkundungen von Machtstrukturen und Repräsentationskonventionen bleibt.
Williams’ erste museale Einzelausstellung, We’ve Been Expecting You, die 2024 im Columbus Museum of Art gezeigt wurde, bot einen Überblick über siebzehn Jahre Schaffenszeit. Der Titel selbst, mit seinem leicht bedrohlichen Tonfall und seiner Einbeziehung der Besucher, fasst den Ansatz der Künstlerin perfekt zusammen: Diese Figuren haben auf uns gewartet, sie wussten, dass wir kommen würden, um sie anzuschauen, und sie sind bereit, uns mit einem intensiven Blick zurückzukehren, der unsere Gewissheiten erschüttert.
Williams’ Werk erinnert uns daran, dass Malerei ein lebendiges Medium bleibt, das in der Lage ist, komplexe philosophische Fragen zu stellen und zugleich sinnlichen Genuss durch Farbe, Textur und Form zu bieten. Sie beweist, dass man zugleich eine technische Virtuosin und eine rigorose Theoretikerin sein kann, eine Erbin der großen malerischen Tradition und eine radikale Ikonoklastin. In einer Welt, die von flüchtigen digitalen Bildern übersättigt ist, bekräftigen ihre monumentalen Leinwände das beharrliche Fortbestehen des menschlichen Blicks und die Möglichkeit einer Repräsentation, die Objektivierung verweigert. Darum zählt ihre Arbeit, darum sollten wir ihr jetzt Aufmerksamkeit schenken. Diese gemalten Frauen werden nicht verschwinden, sie werden nicht wegschauen, sie werden unseren visuellen Komfort nicht erleichtern. Sie sind hier, um zu bleiben, und wir müssen lernen, ihren Blick zu ertragen.
- Londres, Michael. “Robin F. Williams von Michael Londres”, BOMB Magazine, 12. August 2024.
- Indrisek, Scott. “Robin F. Williams genießt die Kunst des Malens”, Artsy, 27. März 2020.
- Cepeda, Gaby. “Robin F. Williams”, Artforum, Juni 2023.
- Smith, Roberta. Zitat im Wikipedia-Artikel “Robin F. Williams”, abgerufen im Oktober 2025.