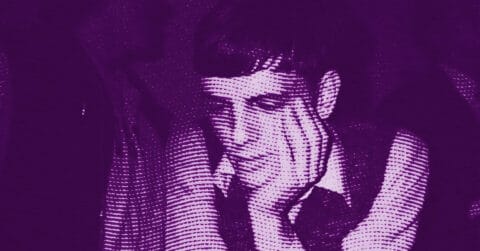Hört mir gut zu, ihr Snobs, es ist Zeit, über eine Künstlerin zu sprechen, die mit der Subtilität eines Faustschlags in einem Monet-Gemälde unsere Gewissheiten erschüttert. Xenia Hausner, geboren 1951 in Wien, ist weit mehr als nur eine einfache österreichische Malerin, sie ist eine Naturgewalt, die die Leinwand zum Theater der menschlichen Seele macht.
In ihrem malerischen Universum verweben sich zwei Hauptthemen wie die Fäden eines komplexen Wandteppichs: zunächst die theatralische Inszenierung der weiblichen Lage und dann die Erforschung der Ambiguität zwischen Realität und Fiktion. Diese beiden Achsen versetzen uns in einen faszinierenden Dialog mit der existenzialistischen Philosophie von Simone de Beauvoir und dem Konzept der “subjektiven Wahrheit” von Søren Kierkegaard.
Beginnen wir mit ihrer Darstellung der Frauen. Hausner malt nicht einfach nur Porträts, sie inszeniert lebendige Bilder, in denen die Frauen den Raum mit einer Präsenz füllen, die Sarah Bernhardt erblassen ließe. Diese Frauen sind keine bloßen Modelle, sie sind Schauspielerinnen im großen Theater des Lebens. Mit Farben, die einen Pfau in voller Balz vor Eifersucht kreischen lassen würden, denken Sie an das elektrische Cyan, das sich im “Kopfschuss” (2000) mit Karmesinrot verbindet, erschafft Hausner weibliche Charaktere, die Authentizität ausstrahlen und zugleich offensichtlich inszeniert sind.
Diese Dualität führt uns direkt zu Simone de Beauvoir und ihrem grundlegenden Konzept: “Man wird nicht als Frau geboren, man wird dazu gemacht”. Die Protagonistinnen von Hausner scheinen diese Idee perfekt zu illustrieren. In ihren monumentalen Gemälden, die oft über zwei Meter hinausreichen, werden Frauen nicht als passive Objekte der Betrachtung dargestellt, sondern als aktive Subjekte, die ihre eigene Geschichte gestalten. Nehmen Sie “Exiles” (2017), wo die weiblichen Figuren, eingeschlossen in einem im Atelier rekonstruierten Zugabteil, nicht einfach Flüchtlinge sind: Sie sind die Architektinnen ihrer eigenen Geschichte, selbst im Zwang des Exils.
Die Art und Weise, wie Hausner die fotografische Inszenierung vor ihren Gemälden behandelt, erinnert an das Konzept der “subjektiven Wahrheit” von Kierkegaard. Der dänische Philosoph vertrat die Auffassung, dass die tiefste Wahrheit diejenige ist, die subjektiv erlebt wird, und nicht diejenige, die objektiv bewiesen werden kann. Hausner treibt dieses Konzept bis zu seinen äußersten Grenzen. Sie baut buchstäblich Kulissen aus Pappe in ihrem Atelier, fotografiert ihre Modelle und verwandelt diese fotografischen “objektiven Wahrheiten” in subjektive Explosionen von Farbe und Emotion auf der Leinwand.
Genau hier liegt das Genie von Hausner: in ihrer Fähigkeit, das zu schaffen, was ich eine “erweiterte Wahrheit” nenne. Sie gibt sich nicht damit zufrieden, die Realität zu reproduzieren, sie dekonstruiert sie und baut sie anschließend mit einer Farbpalette wieder auf, die einen Regenbogen als eine Studie in Schwarzweiß erscheinen lässt. Die Gesichter, die sie malt, sind wie topografische Karten der menschlichen Seele, jeder Pinselstrich offenbart eine neue emotionale Schicht.
In “Night of the Scorpions” (1994), einem ihrer frühen Werke mit komplexen Arrangements, platziert sich Hausner selbst unter drei Astrologinnen, alle geboren im Sternzeichen Skorpion. Diese Selbstaufnahme ist kein bloßes Eitelkeitsspiel, sondern eine kraftvolle philosophische Aussage über die Natur der Realität und der Darstellung. Sie zwingt uns zur Frage: Wo endet die Inszenierung und wo beginnt die Authentizität? Die Antwort lautet natürlich, dass es keine klare Grenze gibt, genau wie Kierkegaard es in seiner Kritik an reiner Objektivität darlegte.
Hausners Technik ist so brutal ehrlich wie ein fünfjähriges Kind, das Ihnen sagt, dass Ihr neuer Haarschnitt Sie älter aussehen lässt. Ihre Pinselstriche sind mutig, stellenweise fast gewalttätig, und schaffen Oberflächen, die vor aufgestauter Energie zu vibrieren scheinen. Sie trägt die Farbe in dicken Schichten auf und schafft so eine Textur, die ihren Werken eine physische Präsenz verleiht, der man nicht entkommen kann. Es ist, als würde sie mit Farbe modellieren und ihren Figuren eine Dimensionalität verleihen, die die Grenzen der flachen Leinwand überschreitet.
Ihr Werdegang ist ebenso interessant wie ihre Kunst. Bevor sie 1992 Vollzeitmalerin wurde, war sie Szenografin und entwarf Bühnenbilder für Theater und Opern in ganz Europa. Diese theatralische Ausbildung spiegelt sich in jedem ihrer Gemälde wider. Ihre Kompositionen sind keine einfachen statischen Arrangements; es sind sorgfältig choreografierte Szenen, in denen jedes Element eine wichtige Rolle in der visuellen Erzählung spielt.
Nehmen wir “Hotel Shanghai” (2010), wo die zwischen zwei Fenstern aufgehängten Stoffe und Teppiche eine komplexe Szenerie schaffen, die uns daran erinnert, dass wir gleichzeitig Zuschauer und Teilnehmer in diesem bildlichen Theater sind. Der Titel bezieht sich auf den Roman von Vicki Baum und fügt einem Werk, das bereits reich an visuellen Assoziationen ist, eine weitere literarische Bedeutungsebene hinzu.
Was an Hausners Herangehensweise besonders bemerkenswert ist, ist, dass sie eine ständige Spannung zwischen Künstlichkeit und Authentizität aufrechterhält. Ihre Gemälde sind offensichtlich inszeniert, sie bemüht sich keineswegs, dies zu verbergen, und dennoch vermitteln sie eine emotionale Wahrheit, die wie ein Schlag ins Solarplexus trifft. Genau das meinte Kierkegaard, als er von subjektiver Wahrheit sprach: Es geht nicht um faktische Genauigkeit, sondern um die emotionale und persönliche Resonanz der Erfahrung.
Die Serie “Exiles”, die als Reaktion auf die Flüchtlingskrise entstand, veranschaulicht diesen Ansatz perfekt. Anstatt die Situation der Flüchtlinge direkt zu dokumentieren, schafft Hausner eine Fiktion, die uns paradoxerweise der emotionalen Wahrheit der Erfahrung näherbringt. Die Personen im Zug ähneln nicht den Flüchtlingen, die wir in Nachrichtenberichten sehen, sie sehen aus wie du und ich. Genau das macht das Werk so kraftvoll: Es zwingt uns, unsere eigene Verletzlichkeit, unser eigenes Exilpotenzial zu sehen.
Dieser Ansatz spiegelt die Gedanken von Simone de Beauvoir über die Bedeutung der gelebten Erfahrung bei der Identitätsbildung wider. Die Frauen in Hausners Gemälden sind nicht durch ihr Aussehen oder ihre gesellschaftliche Erwartungskonformität definiert, sondern durch ihre intensive Präsenz und ihr aktives Engagement mit ihrer Umgebung. Sie verkörpern das, was Beauvoir „Transzendenz” nannte, die Fähigkeit, die von der Gesellschaft auferlegten Beschränkungen zu überwinden.
In ihren jüngeren Werken, wie denen in der Ausstellung “Unintended Beauty” (2022) gezeigt, erforscht Hausner weiterhin die Grenzen zwischen Schönheit und Schrecken. Sie übernimmt das berühmte Zitat von Rilke, “Denn das Schöne ist nur der Anfang des Schrecklichen”, und dreht es um: In der Kunst, so schlägt sie vor, ist der Schrecken der Anfang der Schönheit. Diese kühne Umkehrung erinnert uns daran, dass die kraftvollste Kunst oft aus der Auseinandersetzung mit dem entsteht, was uns beunruhigt oder ängstigt.
Hausners Farbpalette verdient eine besondere Erwähnung. Ihre Farben sind nicht einfach leuchtend, sie sind geradezu halluzinogen. Ein Rosa, das Matisse erröten lassen würde, trifft auf ein elektrisches Blau, das Klein als Minimalisten erscheinen lassen würde. Diese Farbwahl ist nicht willkürlich; sie dient dazu, das zu schaffen, was ich eine “emotionale Hyperrealität” nenne, in der Gefühle bis zur fast greifbaren Verstärkung amplifiziert werden.
Ihre Verwendung der Fotografie als vorbereitender Schritt zum Malen ist besonders interessant. Im Gegensatz zu vielen Künstlern, die Fotografie als Krücke benutzen, nutzt Hausner sie als Sprungbrett zu etwas Größerem. Sie beginnt mit einer fotografisch dokumentierten Realität und verwandelt sie dann in etwas, das ihre Quelle vollständig übersteigt. Es ist, als würde sie die objektive “Wahrheit” der Fotografie durch das Prisma ihrer künstlerischen Subjektivität führen, um etwas Neues und wahrhaftigeres als die Wirklichkeit selbst zu schaffen.
Was an Hausners Arbeit faszinierend ist, ist, dass sie nicht versucht, die inhärenten Widersprüche ihres Ansatzes aufzulösen, sondern sie feiert. Ihre Gemälde sind gleichzeitig theatralisch und authentisch, konstruiert und spontan, persönlich und universell. Diese Fähigkeit, Gegensätze in produktiver Spannung zu halten, verleiht ihrer Arbeit ihre anhaltende Kraft.
Das Werk von Xenia Hausner erinnert uns daran, dass die stärkste Kunst nicht einfach die Realität widerspiegelt, sondern ihre eigene Realität schafft, eine Realität, die uns paradoxerweise ermöglicht, unsere eigene Welt besser zu verstehen. Durch ihre ausgefeilten Inszenierungen und Farbexplosionen bietet sie uns nicht einen Spiegel, sondern ein Fenster zu tieferen Wahrheiten, als wir sie in einer einfachen, realitätsgetreuen Darstellung finden könnten.
In einer Welt, in der wir mit Bildern bombardiert werden, die die “Wahrheit” zu zeigen vorgeben, erinnert uns Hausners Arbeit daran, dass die tiefste Wahrheit oft in dem liegt, was offen künstlich ist. Ihre Gemälde beanspruchen nicht, durchsichtige Fenster zur Realität zu sein, sie sind offenkundig Konstruktionen, sorgfältig ausgearbeitete Fiktionen. Und genau aus diesem Grund gelingt es ihnen, Wahrheiten zu vermitteln, die realistischere Ansätze niemals erreichen könnten.