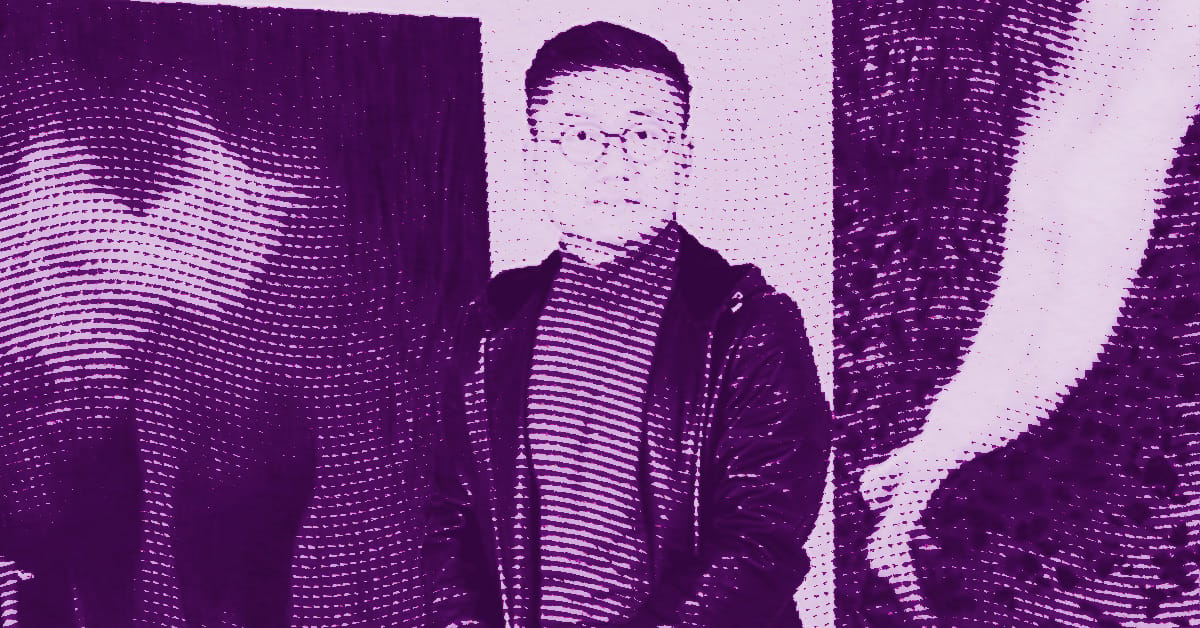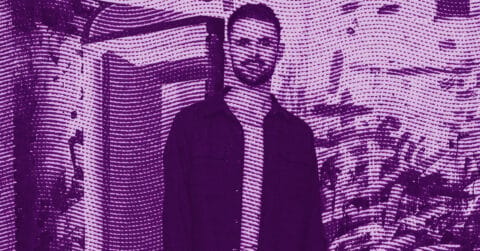Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch vor den neuesten konzeptuellen Installationen begeistert, die Galerien in Flughafenterminals verwandeln, webt ein chinesischer Maler, der seit zwanzig Jahren in Paris lebt, geduldig ein Werk, das die Existenz mit einer Schärfe hinterfragt, die euch für eure Gewissheiten erröten lassen sollte. Xie Lei hat soeben den Prix Marcel Duchamp 2025 gewonnen, und diese Krönung ist kein Zufall: Sie würdigt eine malerische Praxis, die die Abgründe der menschlichen Ambiguität mit einer intellektuellen Strenge erforscht, die nur wenige in der zeitgenössischen Kunstlandschaft noch zu beanspruchen wagen.
Geboren 1983 in Huainan, ausgebildet an den Kunsthochschulen von Peking und dann Paris, wo er die erste Promotion in plastischer Praxis der Pariser Institution abschloss, gehört Xie Lei zu jener Künstlergeneration, die nie auf das malerische Medium verzichtet hat, trotz der Verlockungen der Konzeptkunst. Seine Promotion trug den Titel “Entre chien et loup : Poétique de l’étrange pour un peintre d’aujourd’hui”, eine Formel, die sein künstlerisches Projekt bewundernswert zusammenfasst. Denn gerade in dieser unsicheren Stunde, diesem Moment, in dem der Tag in die Nacht übergeht, ohne dass man genau weiß, wo die Grenze liegt, steckt die ganze Kraft seiner Arbeit.
Für den Prix Marcel Duchamp 2025 präsentierte Xie Lei sieben monumentale Leinwände in phosphoreszierendem Grün, auf denen gespenstische Körper zu schweben scheinen in einer kosmischen Fruchtwassermasse. Freier Fall oder Aufstieg? Der Maler weigert sich, darüber zu entscheiden, und bevorzugt es, seine Figuren in diesem Zustand metaphysischer Schwerelosigkeit zu belassen, der sein Werk kennzeichnet. Die bewusst unscharfen und ohne erkennbare Züge gestalteten Silhouetten strahlen ein fast übernatürliches Licht aus inmitten einer pflanzlichen Kulisse, die sowohl an Tiefen des Meeres als auch an nächtliche Wälder erinnert. Diese Unbestimmtheit ist keine formale Trägheit, sondern ein ästhetisches Konzept: Indem er Identität, Geschlecht oder sogar die vollständige Menschlichkeit seiner Figuren nicht festlegt, öffnet Xie Lei einen universellen Projektionsraum.
Die französische Literatur hat seine Vorstellungskraft entscheidend genährt. Zu seinen wichtigsten Referenzen gehört Albert Camus, dessen erster unvollendeter Roman “La Mort heureuse” (1971) [1] den Titel einer jüngsten Einzelausstellung bei Semiose im Jahr 2025 gab. Dieses camussche Oxymoron (wie kann man zugleich tot und glücklich sein?) hallt tief in Xie Leis malerischer Herangehensweise wider. In diesem zwischen 1936 und 1938 verfassten, aber von Camus selbst aufgegebenen Roman sucht die Figur Patrice Mersault verzweifelt das Glück, notfalls durch einen Mord, um sich das Geld zu verschaffen, das ihm ein erfülltes Leben ermöglicht. Diese existentielle Suche endet in einer ruhigen Akzeptanz des Todes, in einer Verschmelzung mit der mediterranen Natur, die die Themen von “L’Étranger” vorwegnimmt.
Xie Lei macht sich diese Spannung zwischen Leben und Tod zu eigen, diesen schwebenden Moment, in dem Mersault, krank und klar, sein Schicksal mit einer Form tragischer Euphorie akzeptiert. Seine Gemälde pflegen genau diese Zone der Unentschiedenheit: Sind die Körper, die er darstellt, Sterbende oder Wesen in mystischer Schwebe? Sind sie dabei, in den Abgrund zu stürzen, oder in eine spirituelle Dimension wiedergeboren zu werden? Diese strukturelle Mehrdeutigkeit liegt in der Tradition der Philosophie des Absurden, die Camus entwickelt hat, in der der Mensch seinen eigenen Sinn angesichts einer Welt ohne intrinsische Bedeutung schaffen muss. Die Figuren von Xie Lei scheinen genau diesen Moment zu verkörpern, in dem das menschliche Bewusstsein dem Sinnlosigkeit der Existenz begegnet, ohne dabei in nihilistische Verzweiflung zu versinken.
Das Oxymoron „glücklicher Tod” findet sein malerisches Pendant in den chromatischen Entscheidungen des Malers. Diese aquatischen Grüntöne, diese tiefen Blautöne, diese gelb-orangenen Schattierungen, die seine Figuren umgeben, entsprechen keinem natürlichen Teint. Xie Lei komponiert seine Farbpaletten, ohne Schwarz oder Weiß zu verwenden, und legt etwa zehn Schichten Blau- und Grüntöne übereinander, um diesen unwirklichen, fast psychedelischen Farbton zu erzielen. Das Ergebnis erzeugt einen Effekt geisterhafter Präsenz: Die Körper wirken zugleich schmerzlich körperlich und völlig ätherisch, als ob sich die Materie im Licht auflösen würde. Diese chromatische Dualität materialisiert Camus’ Intuition, wonach das intensivste Glück genau in dem Moment entstehen kann, in dem man die Endlichkeit der Existenz akzeptiert.
Wenn Xie Lei seine Gemälde mit nur einem Wort betitelt, „Embrace”, „Breath”, „Possession” oder „Rescue”, verfährt er wie Camus bei der Benennung seines Romans: durch maximale Kondensation des Sinns, die alle Interpretationen offenlässt. Ein Kuss kann eine liebevolle Umarmung oder ein vampirisches Erwürgen sein. Ein Atemzug kann das Fortbestehen des Lebens oder den letzten entweichenden Hauch bedeuten. Diese lexikalische Ökonomie zwingt den Betrachter, seine eigene Projektion auf das Werk zu konfrontieren und anzuerkennen, dass der Sinn nie gegeben, sondern immer vom Seher konstruiert wird. In „La Mort heureuse” erreicht Mersault das Glück nicht durch Antworten, sondern durch das Akzeptieren der Widersprüche, die der menschlichen Existenz innewohnen. Die Gemälde von Xie Lei bieten eine ähnliche Erfahrung: Sie lösen nichts, sondern bieten einen Raum der Kontemplation, in dem Paradoxien koexistieren können.
Der Künstler sagte in einem Interview: “Meine Motive sind Chimären, Kombinationen von Elementen aus meiner Erinnerung. Banale Szenen, in denen immer etwas Außergewöhnliches passiert” [2]. Diese Aussage offenbart eine Nähe zur Welt von Camus, in der der Alltag plötzlich ins Absurde umschlägt, in der ein Büroangestellter unter der blendenden algerischen Sonne zum Mörder werden kann. Die „Chimären” von Xie Lei sind jene Momente, in denen die Realität Risse bekommt und eine andere Dimension der Existenz sichtbar wird, weder ganz lebendig noch ganz tot, weder ganz präsent noch ganz abwesend. In diesem Dazwischen liegt der „glückliche Tod”: kein endgültiger Zustand, sondern ein Übergang, eine Übergangszone, in der Gegensätze sich berühren.
Die Beziehung, die Xie Lei zur Psychoanalyse pflegt, und besonders zu den Arbeiten von Julia Kristeva, beleuchtet eine weitere wesentliche Dimension seines Werks. Zu den ausdrücklich zitierten theoretischen Referenzen zählt diese französische Schriftstellerin bulgarischer Herkunft, deren Forschungen zur Abjektion, Fremdheit und den Grenzzuständen der Identität in seiner Malerei eindrucksvolle Widerhall finden. Kristeva entwickelte in “Étrangers à nous-mêmes” (1988) [3] eine tiefgreifende Reflexion über die Figur des Fremden, nicht als den anderen, den man ablehnt, sondern als den Teil in uns, den wir verdrängen. Sie schreibt, dass “der Fremde in uns wohnt: er ist die verborgene Seite unserer Identität, der Raum, der unser Zuhause zerstört”. Diese Idee, dass die radikalste Andersartigkeit in uns selbst liegt, durchzieht kraftvoll Xie Leis Arbeit.
Seine gesichtslosen Figuren, ohne erkennbares Geschlecht, ohne klare ethnische Zugehörigkeit, verkörpern genau diese konstitutive Fremdheit jeder Identität. Indem er seinen Figuren keine Züge verleiht, die sie einer sozialen, rassischen oder sexuellen Kategorie zuordnen würden, erhält Xie Lei sie in einem Zustand der “identitären Fluchtigkeit”. Diese schwebenden Körper mit verschwommenen Konturen scheinen sich ständig zu verwandeln, als ob Identität nie fest, sondern immer im Werden sei. Kristeva betonte, dass das Erkennen des Fremden in sich selbst ermöglicht, ihn beim anderen nicht zu hassen. Xie Leis Gemälde funktionieren nach demselben Prinzip: Indem sie Wesen darstellen, die jeder stabilen Kategorisierung entgehen, konfrontieren sie uns mit unserer eigenen grundlegenden Unbestimmtheit.
Der Begriff der Abjektion bei Kristeva findet ebenfalls Widerhall in Xie Leis Werk, insbesondere in seiner Behandlung der Auflösung von Körpern. Abjektion bezeichnet laut Kristeva in “Pouvoirs de l’horreur” (1980) [4] das, was die Identität, das System, die Ordnung stört, was Grenzen, Plätze, Regeln nicht respektiert. Die von Xie Lei gemalten Figuren sind in diesem Sinne geradezu abjektiv: Sie stören die Grenzen zwischen Lebendig und Tot, zwischen Materiellem und Immateriellem, zwischen Ich und Anderem. Ihr Fleisch scheint sich in der malerischen Umgebung aufzulösen, ihre Konturen verschmelzen mit den sie umgebenden Licht-Halos und erzeugen eine absichtliche Verwirrung zwischen Subjekt und Hintergrund. Diese ontologische Instabilität erzeugt beim Betrachter ein fruchtbares Unbehagen, da er seinen Blick auf sich ständig entziehende Formen nicht fixieren kann.
Der malerische Prozess von Xie Lei, mehrere Schichten von Ölfarbe, gefolgt von Abschabungen mit Pinsel, Papier oder sogar mit der Hand, trägt zu dieser Ästhetik der Auflösung bei. Man erahnt manchmal seine Fingerabdrücke in der malerischen Substanz, Spuren einer physischen Präsenz, die selbst im Begriff scheint zu verschwinden. Diese Technik schafft Oberflächen von großer taktiler Komplexität, auf denen das Licht eher aus dem Inneren der Leinwand zu kommen scheint, als sich auf ihrer Oberfläche zu spiegeln. Die Körper werden zu autonomen, phosphoreszierenden Lichtquellen, als seien sie von einer Vitalenergie erfüllt, die fortbesteht, selbst wenn ihre Form zerfällt. Vielleicht findet hier Kristevas Denken über Melancholie Resonanz zu der Arbeit des Malers.
In “Soleil noir : Dépression et mélancolie” (1987) erforscht Kristeva die psychischen Zustände, in denen das Subjekt den Verlust erlebt, der durch Sprache nicht symbolisiert werden kann. Die Melancholie ist durch eine Unfähigkeit zur Trauer gekennzeichnet, durch eine paradoxe Bindung an das verlorene Objekt, das zu einem untrennbaren Teil des Ichs wird. Die gespenstischen Gestalten von Xie Lei könnten als malerische Verkörperungen dieses melancholischen Zustands verstanden werden: weder ganz präsent noch ganz abwesend, spuken sie im Bildraum wie Wiedergänger, die es nicht schaffen, die Welt der Lebenden zu verlassen. Ihr gespenstisches Leuchten ruft dieses Fortbestehen des Vergangenen hervor, diese beharrliche Präsenz der Abwesenheit, die die melancholische Erfahrung definiert. Das aquatische Grün, das seine jüngsten Serien dominiert, könnte übrigens als flüssige Metapher für diesen psychischen Zustand ohne klare Konturen gelesen werden, in dem sich das Subjekt in einem tödlichen Tagtraum verliert.
Kristeva hat auch eine Reflexion über die mütterliche Dimension des Psychischen entwickelt, über diese grundlegende Verbindung zur Mutter, die jeder Identitätsbildung vorausgeht. Die grünen und aquatischen Räume, die Xie Lei malt, mit ihren umhüllenden und immersiven Qualitäten, erinnern unweigerlich an die Fruchtwassermenge, jene ursprüngliche Umgebung, in der der Fötus noch keinen Unterschied zwischen sich und der Außenwelt machte. Die sich im freien Fall befindlichen oder schwebenden Körper, die seine Bilder bevölkern, scheinen in diesen pränatalen Verschmelzzustand zurückzukehren und versuchen, eine verlorene Vollständigkeit wiederzufinden. Diese Rückkehr zur ursprünglichen Undifferenziertheit wäre dann ein verzweifelter Versuch, dem Leiden der Individualisierung zu entkommen, den unvermeidlichen Verletzungen, die die Trennung von der Mutter verursacht.
Xie Leis Praxis ernährt sich ausdrücklich von seinen nächtlichen Träumen, was der Maler in Interviews mehrfach bekräftigt hat. Für sein Projekt des Marcel-Duchamp-Preises ging er von einem wiederkehrenden Traum aus: dem Fliegen, das in einen Albtraum des Fallens umschlägt. Kristeva, ausgebildet in der freudianischen und lakanischen Psychoanalyse, maß der Arbeit mit Träumen in der künstlerischen Produktion große Bedeutung bei. Der Traum ermöglicht den Zugang zu psychischen Bereichen, die dem Tagesbewusstsein unzugänglich sind, und die Formgebung von Ängsten und Wünschen, die sich anders nicht ausdrücken können. Xie Leis Gemälde funktionieren wie visuelle Träume: Sie folgen einer Traumlogik, in der die Gesetze der Physik und Identität aufgehoben sind, in der Körper schwerelos schweben können, in der Farben nicht mehr der Realität entsprechen müssen. Diese traumhafte Dimension erklärt teilweise die hypnotische Wirkung seiner Bilder: Sie versetzen uns in einen Zwischenzustand, zwischen Wachsein und Schlaf, vergleichbar mit dem, den Xie Lei selbst für seine Schaffung zu erreichen sucht.
Der Künstler hat seine Arbeitsmethode in zwei Phasen beschrieben: zuerst mental und konzeptionell, dann körperlich und gestisch. Diese Dualität erinnert an Kristevas Unterscheidung zwischen Symbolischem und Semiotischem, zwischen der Ordnung der strukturierten Sprache und der der sie überströmenden körperlichen Triebe. Wenn die erste Phase dem Symbolischen entspricht, der Auswahl eines Bildes, der Suche nach seinen vielfältigen Bedeutungen, der Untersuchung seiner kulturellen Resonanzen, gehört die zweite zum Semiotischen: Der Künstler lässt Zufall, “glückliche Zufälle” und eine gestische Spontaneität zu, die sich der rationalen Kontrolle entzieht. Diese Dialektik zwischen Beherrschung und Loslassen erzeugt Werke, in denen Intellekt und Körper ständig miteinander in Dialog stehen, in denen philosophisches Denken sich in der malerischen Materie verkörpert, ohne sich je zu einer bloßen Illustration von Ideen zu reduzieren.
Die Frage, die Xie Lei in seiner Praxis aufwirft, könnte so formuliert werden: Wie stellt man Ambiguität in der Malerei dar? Wie gibt man dem, was per Definition jede Fixierung, jede stabile Bestimmung verweigert, eine sichtbare Form? Kristeva hatte eine “revoltierende” Dimension in der wahren Kunst erkannt, das heißt ihre Fähigkeit, etablierte Ordnungen infrage zu stellen, beruhigende Klassifikationen zu stören, die unter der scheinbaren Einfachheit verborgene Komplexität zu offenbaren. Die Gemälde von Xie Lei sind genau in diesem Sinn revoltierend: Sie widerstehen jeder eindeutigen Lesart, frustrieren das zusehende Verlangen nach einer transparenten Bedeutung, erzwingen die verwirrende Erfahrung einer Schönheit, die sich nicht besitzen lässt. Sie zwingen uns, zu akzeptieren, dass es unüberwindbare Zonen der Unbestimmtheit gibt, dass nicht alle Paradoxien gelöst werden können, dass manche Fragen offen bleiben müssen.
Diese Akzeptanz von Ambiguität ist kein einfacher Relativismus, sondern eine ethische und ästhetische Forderung. In einer zeitgenössischen Welt, die von Klarheit, Effizienz und Unmittelbarkeit besessen ist, wo jedes Phänomen innerhalb von wenigen Sekunden in den sozialen Netzwerken erklärt werden muss, verteidigt Xie Lei eine bewusst angenommene Komplexität. Seine Leinwände verlangen Zeit, Geduld, eine geworden seltene kontemplative Bereitschaft. Sie offenbaren sich nicht beim ersten Blick, sondern entfalten langsam ihre Bedeutungsschichten. Diese Langsamkeit ist an sich ein politisches Zeichen: Gegen die allgemeine Beschleunigung unserer Existenz, gegen die Tyrannei des unendlichen “Scrollens” setzt der Maler ein meditatives Tempo durch, das es dem Betrachter erlaubt, sich wieder mit seiner eigenen Innerlichkeit zu verbinden.
Der Direktor des Musée d’Art Moderne de Paris, Fabrice Hergott, lobte in Xie Leis Werk “einen besonders gelungenen Ausdruck dessen, was der Beginn des 21. Jahrhunderts ist”, wo “das Fehlen von Orientierungspunkten und die Benommenheit zu den am häufigsten empfundenen Empfindungen geworden sind”. Diese soziologische Lesart darf uns nicht vergessen lassen, dass die Stärke dieser Gemälde gerade in ihrer Weigerung liegt, zeitgenössische Anekdotik zu bieten. Xie Lei malt unsere Zeit nicht, wie ein Journalist sie beschreiben würde, er erfasst die tiefe affektive Struktur, diese existenzielle Angst, die über die besonderen historischen Umstände hinausgeht. Seine gespenstischen Figuren sprechen ebenso von unserer Gegenwart wie von der menschlichen Existenz allgemein, von dieser metaphysischen Einsamkeit, der sich jede Generation auf ihre Weise stellen muss.
Hier haben wir also einen Maler, der weder auf die Figuration noch auf den philosophischen Anspruch der Kunst verzichtet, der die Einfachheiten des ersten Grades ebenso ablehnt wie jene der totalen Abstraktion, der geduldig ein anspruchsvolles Werk in einem Kontext aufbaut, der wenig förderlich für Anspruch ist. Seine Auszeichnung mit dem Prix Marcel Duchamp darf nicht nur als eine bloße institutionelle Anerkennung verstanden werden, sondern als das Symptom eines kollektiven Bedarfs: jenes, angesichts der Gemälde von Xie Lei eine Tiefe der Fragestellung wiederzufinden, die der Markt für zeitgenössische Kunst zu oft zugunsten von Spektakel und Skandal verdrängt hat. Diese Körper, die zwischen Fall und Flug, zwischen Präsenz und Abwesenheit, zwischen Leben und Tod schweben, erinnern uns daran, dass Kunst, die diesen Namen verdient, nichts löst, sondern unsere Fragen vertieft, uns nicht tröstet, sondern uns angesichts des Rätsels unserer eigenen Existenz klarer macht. In einer Welt, die von sofortigen Bildern und vorgefertigten Emotionen übersättigt ist, bietet uns Xie Lei etwas, das kostbar geworden ist: die notwendige Stille, um das ängstliche Flüstern unserer eigenen Abgründe zu hören. Vielleicht ist es das schließlich, was man ein glückliches Sterben nennen könnte: zu akzeptieren, dem ins Gesicht zu sehen, was uns Angst macht, und in dieser Konfrontation nicht Schrecken, sondern eine seltsame Form von Gelassenheit zu entdecken. Der Maler verspricht uns kein Glück, aber er zeigt uns, wie wir unsere Widersprüche poetisch bewohnen, wie wir unsere Schwindelgefühle in malerische Materie verwandeln, wie wir aus unserer konstitutiven Unsicherheit keine Schwäche, sondern die Quelle einer verstörenden und notwendigen Schönheit machen.
- Albert Camus, “La Mort heureuse”, Gallimard, Sammlung Cahiers Albert Camus, 1971
- Zitat von Xie Lei, veröffentlicht im Katalog der Ausstellung des Prix Marcel Duchamp 2025, Musée d’Art Moderne de Paris
- Julia Kristeva, “Fremde für uns selbst”, Fayard, 1988
- Julia Kristeva, “Mächte des Schreckens: Essay über das Abscheuliche”, Éditions du Seuil, 1980