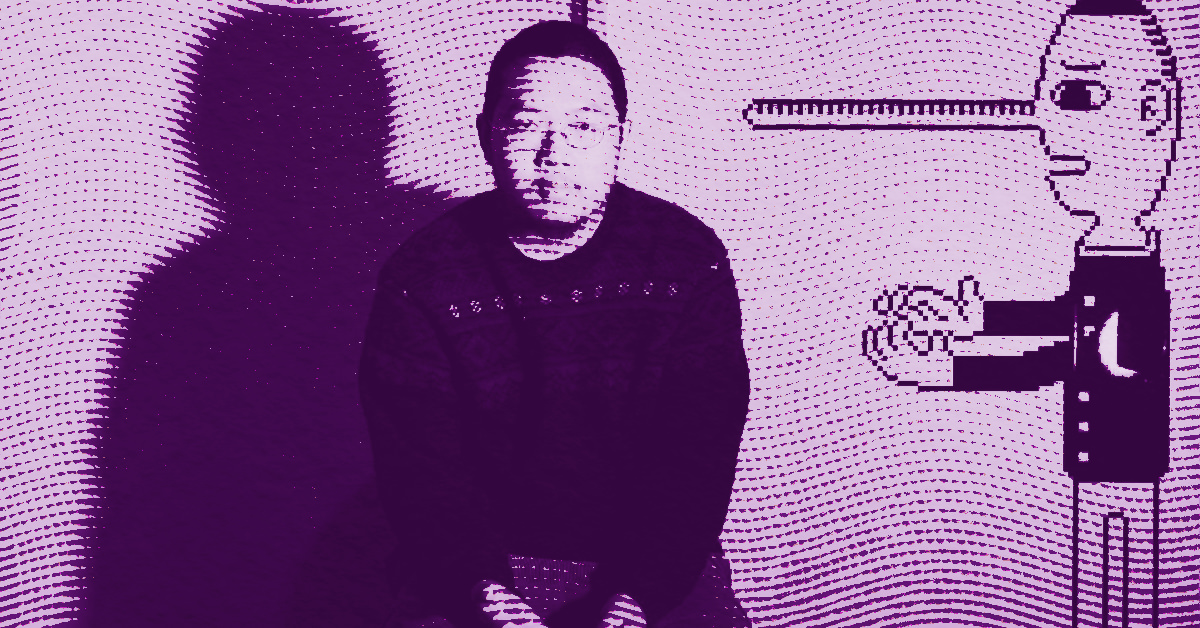Hört mir gut zu, ihr Snobs: Während ihr euch vor den ewigen Wiederholungen des westlichen zeitgenössischen Kunstmarkts begeistert, zeichnet ein Mann rauchende Schornsteine auf die Industrie-Ruinen Chinas. Yan Cong, geboren 1983 in der Provinz Hubei unter dem Namen Peng Han, wählte als Künstlernamen das chinesische Wort für “Schornstein”, eine Wahl, die für das Verständnis seines Werks alles andere als zufällig ist. Dieser Schornstein, den er ständig anspricht, der schwarzen Rauch auf die verfallenen Stadtrandlandschaften des Reichs der Mitte spuckt, wird unter seinem Pinsel zum Symbol einer rauen Schönheit und einer Ästhetik des Verfalls.
Absolvent der Central Academy of Fine Arts in Peking, wo er traditionelle chinesische Malerei studierte, verließ Yan Cong schnell ausgetretene Pfade, um sich dem Comic zuzuwenden, einem Medium, das China noch immer als Kinderliteratur betrachtet. Doch hier liegt die Meisterleistung: Dieser Mann macht keine Comics. Er schafft grafische Erzählungen, die ebenso von Acrylmalerei wie von Collage, ebenso von Art Brut wie vom deutschen Expressionismus beeinflusst sind und sich beharrlich weigern, sich etablierten Kategorien zu unterwerfen. Vertreten von der Star Gallery in Peking und der Leo Gallery in Hongkong, bewegt er sich zwischen Galerien zeitgenössischer Kunst und Underground-Publikationen, zwischen Museumsausstellungen und unter der Hand verkauften kopierten Fanzines.
Was im Universum von Yan Cong sofort auffällt, ist diese unerwartete Verbindung zum deutschen Expressionismus, ein Erbe, das er selbst beansprucht, indem er den entscheidenden Einfluss von Anke Feuchtenberger auf seine Arbeit nennt. Die deutsche Künstlerin, 1963 in Ost-Berlin geboren, entwickelte seit den 1990er Jahren eine Ästhetik, die sich aus den Traditionen des Holzschnitts und dem deutschen expressionistischen Film speist. Seit 1997 Professorin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften Hamburg, hat Feuchtenberger das Potenzial des Comics als Kunstform durch ihr Engagement mit verschiedenen Quellen und neuen Techniken der grafischen Erzählung neu definiert [1]. Yan Cong gesteht: “Wahrscheinlich zeichne ich Leute mit Tierköpfen unter dem Einfluss von Anke Feuchtenbergers Arbeiten. Tatsächlich hatte ich nie wirklich Tiere gezeichnet, bevor ich ihre Arbeiten gesehen habe… Sie hat wirklich einen enormen Einfluss auf mich gehabt!” [2].
Diese Verbindung zwischen einem zeitgenössischen chinesischen Künstler und der deutschen Avantgarde ist nicht nur eine Frage stilistischer Einflüsse. Sie offenbart eine tiefe Verwandtschaft in der Herangehensweise an das Medium und im Willen, etablierte Konventionen zu unterwandern. So wie Feuchtenberger und das Kollektiv PGH Glühende Zukunft die Ästhetik des expressionistischen Holzschnitts nutzten, um sich sowohl vom ostdeutschen Neo-Expressionismus als auch vom staatlich verordneten sozialistischen Realismus abzuheben, verwendet Yan Cong Figuren mit Tierköpfen und verlassene industrielle Kulissen, um eine visuelle Sprache zu schaffen, die den traditionellen Kategorien des chinesischen Comics entkommt. Seine hybriden Kreaturen, halb Mensch, halb Tier, wandern durch zerfallene urbane Landschaften, in denen verlassene Fabriken und verrostete Metallstrukturen eine Atmosphäre schaffen, die weder ganz realistisch noch eindeutig fantastisch ist.
Der deutsche Expressionismus, mit seinen deformierten Körpern und klaustrophobischen Räumen, war stets eine Kunst der Sozialkritik und existenziellen Verstörung. Künstler wie George Grosz und Otto Dix, deren Ästhetik sich in Feuchtenbergers Werk widerspiegelt, nutzten formale Verzerrungen, um die zugrunde liegenden Spannungen der deutschen Gesellschaft in der Zwischenkriegszeit zu enthüllen. Yan Cong jedoch, ohne in eine servile Nachahmung zu verfallen, macht sich diese Tradition zunutze, um seine eigene Realität zu dokumentieren: die einer sich schnell wandelnden China, in der die stadtnahen Gebiete zu No-Man’s-Lands zwischen Moderne und Tradition, zwischen Entwicklung und Verfall werden. Seine Szenerien, oft im Internet gefunden statt direkt fotografiert, erhalten durch diesen Prozess der digitalen Vermittlung eine besondere Qualität des Fremden. Er erklärt: “Ich mag diese verfallenen stadtnahen Kulissen. Sie geben mir ein Gefühl von seltsamer Frische… Wenn ich diese Landschaften betrachte, hoffe ich immer, dass dort etwas geschehen wird” [2].
Dieses Warten auf das Etwas, das in diesen trostlosen Räumen geschehen könnte, bildet vielleicht das Kernstück von Yan Congs künstlerischem Ansatz. Seine Erzählungen sind alles andere als konventionelle lineare Narrative; sie funktionieren als poetische Erkundungen von Raum und Zeit. Seine Comics, in China veröffentlicht, aber auch in Europa bei Verlagen wie Canicola in Italien und Atrabile in der Schweiz, entziehen sich einer einfachen Kategorisierung. Sind sie autobiografisch? Fiktional? Die Grenze bleibt bewusst unscharf, da sich der Künstler selbst in Erzählungen inszeniert, die gelebte Erfahrungen mit imaginären Fantasien vermischen.
Yan Congs Verhältnis zur Narration offenbart ein besonderes Verständnis von Comic als Kunstform. Im Gegensatz zur dominierenden japanischen Manga-Tradition auf dem chinesischen Markt oder den amerikanischen Superhelden, die das westliche Mediumprägen, bevorzugt seine Arbeit einen nahen Zugang zur grafischen Poesie. Seine Seiten zielen nicht darauf ab, eine Geschichte im traditionellen Sinne zu erzählen, sondern vielmehr eine Atmosphäre zu schaffen, emotionale Verbindungen zwischen den Bildern anzudeuten. Dieser Ansatz spiegelt wider, was er über die Arbeit des Zeichners sagt: “Ein wichtiger Teil der Arbeit des Zeichners ist es, das Publikum durch das Werk zu führen.” In seinem im Shanghai MoCA Pavilion ausgestellten Werk mit dem Titel “What to Do When You’re Feeling Dispirited” versammelt er Arbeiten, die während melancholischer Phasen entstanden sind, und verwandelt depressive Stimmung in künstlerisches Material.
Diese unkonventionelle narrative Dimension zeigt sich auch in seiner vielseitigen Praxis, die sich nicht auf ein einziges Medium beschränkt. Yan Cong arbeitet zwar mit Comics, aber auch mit Acrylmalerei, Collage und Nähen. 2014, beeinflusst vom japanischen Künstler Shinro Ohtake, begann er eine Serie von Collagen ohne vorheriges Design, indem er einfach gefundene Materialien sammelte und zusammensetzte. Diese Collagepraxis, die etwa 120 Werke in zwei Monaten hervorbrachte, zeugt von seiner ständigen Suche nach neuen Methoden, um kreativer Trägheit zu entkommen. Wie er erklärt: “Ich suche immer nach Möglichkeiten, ein Gefühl des Kontrollverlusts zu erkunden und zu genießen; ich versuche, die Trägheit zu vermeiden, die mich dazu bringen würde, alte Dinge zu produzieren.”
Die Stellung von Yan Cong zum Kunstmarkt offenbart auch die besonderen Spannungen, die die zeitgenössische chinesische Kunstszene durchziehen. Als Mitglied des Kollektivs Special Comix, einer Anthologie alternativer Comics, die zwischen 1.000 und 2.000 Exemplare gedruckt wurde, bewegt er sich in einem Umfeld, in dem die staatliche Zensur allgegenwärtig bleibt. 2014 organisierte er die Anthologie “Naked Body”, als direkte Antwort auf das Verbot von Nacktheit in gedruckten Publikationen in China: ein offener Aufruf für fünfseitige Comics, in denen alle Hauptfiguren nackt sein mussten. Diese kulturelle Widerstandsgeste, sowohl subversiv als auch spielerisch, verdeutlicht, wie unabhängige chinesische Künstler zwischen politischen Zwängen und kreativer Ausdrucksfreiheit navigieren.
Yan Cong verkörpert diese Generation chinesischer Künstler, die die Dichotomie zwischen zeitgenössischer Kunst und Popkultur ablehnen. Seine Originalwerke werden in Kunstgalerien verkauft, doch seine Comics zirkulieren auch online, in Piratenpublikationen und in kopierten Fanzines. Er arbeitet mit kommerziellen Galerien zusammen und bewahrt dabei seine redaktionelle Unabhängigkeit, indem er nach seinem Austritt aus dem Redaktionsteam von Special Comix sogar seine eigene Publikation “Narrative Addiction” gründete. Diese prekäre, aber fruchtbare Zwischenposition erlaubt es ihm, die Grenzen zwischen den Medien und Vertriebswegen zu hinterfragen.
In einem Interview erklärte Yan Cong, er wolle “die Beziehung zwischen Comic und zeitgenössischer Kunst stärken” und hoffe, “das Verständnis des Publikums für Comics durch die Kombination von Comic und Staffeleimalerei zu untergraben”. Er fügte hinzu: “Ich möchte nur, dass sie wissen, dass Comics in der Gemeinschaft der zeitgenössischen Kunst nicht fehlen können, weil ich immer noch denke, dass Comics Teil der zeitgenössischen Kunst sind, auch wenn sich die Sehgewohnheiten aller nicht geändert haben” [3].
Das Projekt lautet also: die Kunstinstitutionen dazu zu zwingen, Comics als legitime Form des zeitgenössischen Ausdrucks anzuerkennen, nicht durch das Aufgeben der Besonderheiten des Mediums, sondern im Gegenteil durch ihre Bestätigung. Die hybriden Figuren von Yan Cong, seine trostlosen Industrie-Landschaften und seine nicht-linearen Erzählungen sind keine Kompromisse zwischen Comic und zeitgenössischer Kunst, sondern Werke, die gleichzeitig vollständig in beiden Bereichen existieren. Diese doppelte Zugehörigkeit schwächt seine Arbeit keineswegs, sondern bildet ihre Hauptstärke.
Yan Cong erinnert uns daran, dass die Hierarchien zwischen künstlerischen Medien nach wie vor willkürliche soziale Konstruktionen sind, die mehr über unsere kulturellen Vorurteile aussagen als über den inneren Wert der Werke. Seine rauchenden Schornsteine, seine Tiere mit menschlichen Gesichtern und seine verlassenen Fabriken schlagen eine Poetik des Verfalls und der Transformation vor, die weit über die chinesischen Grenzen hinaus Resonanz findet. In einer Welt, in der sich die zeitgenössische Kunst oft in der Wiederholung ihrer eigenen Codes erschöpft und Comics Schwierigkeiten haben, das kulturelle Ghetto zu verlassen, das sie einschließt, eröffnet die Arbeit von Yan Cong neue Perspektiven. Es geht nicht darum, naiv eine angebliche Verschmelzung der Genres zu feiern, sondern anzuerkennen, dass es Künstler gibt, die gleichzeitig in mehreren Registern arbeiten können, ohne sich den dominierenden Logiken irgendeines anzupassen.
Die Lektion ist einfach, aber heilsam: Kunst definiert sich weder durch ihr Medium noch durch ihre Vertriebswege, sondern durch die Fähigkeit des Künstlers, Formen zu schaffen, die uns zwingen, unsere Kategorien neu zu überdenken. Yan Cong zeichnet von seinem Atelier in Peking aus weiter seine rauchenden Schornsteine über den Trümmern unserer ästhetischen Gewissheiten. Und während Sie sich noch fragen, ob es sich um Comics oder zeitgenössische Kunst handelt, ist er schon weitergezogen.
- Elizabeth Nijdam, „’Zeichnen bedeutet für mich Kommunikation’: Anke Feuchtenberger und deutsche Art Comics nach 1989″, Dissertation, University of Michigan, 2017.
- Interview mit Yan Cong von Voitachewski, 2012.
- Sixi Museum, „Yan Cong – Übersicht”, Künstlerinformation, abgerufen im Oktober 2025.