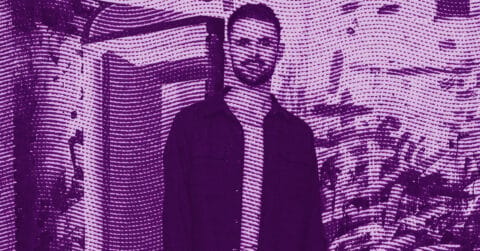Hört mir gut zu, ihr Snobs: In Zhang Nans Atelier geschieht etwas Authentisches, das unsere Aufmerksamkeit mit der kritischen Strenge verdient, die Künstlern gebührt, die der einfachen Lösung widerstehen. Diese junge chinesische Malerin, Absolventin der ENSAD Nancy im Juni 2025 und diese Woche auf der Luxembourg Art Week 2025 dank des Institut Français du Luxembourg und der Association Victor Hugo zu entdecken, bietet mit ihrer Serie Brothers eine malerische Meditation über Gewalt und Absurdität, die weit über eine simple akademische Übung hinausgeht.
Wenn Zhang Nan sagt, sie habe Am Wasserufer erneut gelesen, bevor sie diese Serie entwarf, meint sie keine oberflächliche Inspiration, sondern eine echte Auseinandersetzung mit einem der Gründungswerke der chinesischen Imagination. Dieser klassische vierzehnte Jahrhundert Roman, attribuiert Shi Nai’an, erzählt die Abenteuer von hundertacht Räubern, die sich um einen Sumpf versammeln, um ein korruptes Reich herauszufordern [1]. Doch Zhang Nan sucht nicht, die Erzählung zu illustrieren. Sie extrahiert das, was sie selbst als “eine gewisse Intensität, rohe Gewalt, oft unbewusst” bezeichnet, und lehnt bewusst historische Marker ab, um etwas Wesentlicheres zu erreichen. Diese ästhetische Entscheidung ist nicht zufällig: Sie platziert ihre Arbeit in einer Genealogie, die den Ausdruck der menschlichen Existenz über dokumentarische Rekonstruktion stellt.
Was an ihrer Serie Brothers sofort beeindruckt, ist das Können der Künstlerin, ein fragiles Gleichgewicht zwischen Narration und Abstraktion zu halten. Die großformatigen Ölgemälde (160 x 120 Zentimeter) rufen Mord- und Grausamkeitsszenen aus dem klassischen Roman hervor, doch Zhang Nan verweigert systematisch das Spektakuläre. “Ich habe bewusst blutige Bilder vermieden, beispielsweise durch Farbänderung des Blutes”, erläutert sie. Diese Strategie der chromatischen Umdeutung ist keine fehlplatzierte Zurückhaltung, sondern eine kategorische Ablehnung der Selbstzufriedenheit im Angesicht des Grauens. Die Künstlerin möchte nicht, dass der Betrachter „durch einen direkten visuellen Schock abgelenkt wird”, denn was sie interessiert, ist nicht die Gewalt an sich, sondern das, was sie über die menschliche Absurdität offenbart.
Genau hier wird ihre Verwandtschaft zu Max Beckmann besonders bedeutsam. Der deutsche Künstler, der in Amsterdam und später in den USA im Exil lebte, widmete die letzten Jahre seines Lebens der Schaffung monumentaler Triptychen, die persönliche Allegorie mit Kommentaren zur menschlichen Existenz in einem von Kriegen zerrissenen Jahrhundert verbindet. Werke wie Abreise (1933-1935), Die Schauspieler (1941-1942) oder Der Karneval (1942-1943) zeugen von einer Obsession für das Darstellen einer Menschheit, die in klaustrophobische Räume gedrängt ist, in denen Gewalt mit einer Form tragischer Würde koexistiert [2]. Beckmann schrieb 1918: “Ich versuche, das schreckliche, pulsierende Ungeheuer der Lebenskraft einzufangen und es einzuschränken, zu unterwerfen und mit kristallklaren Linien und rasiermesserscharfen Ebenen zu erwürgen” [3]. Diese Spannung zwischen dem Einfangen der Lebensenergie und ihrer rigorosen Formvergabe resoniert tief mit Zhang Nans Projekt.
Aber Achtung: Es handelt sich nicht um eine einfache Nachahmung. Während Beckmann seine Kompositionen in Triptychen entfaltete und mit den formalen und symbolischen Echos zwischen den seitlichen Tafeln und der mittleren Tafel spielte, wählte Zhang Nan bewusst die Fragmentierung der Erzählung in eigenständige Leinwände, die jede feste Ordnung ablehnen. “Diese Serie hat keine feste Reihenfolge”, betont sie, “die Nummern in den Titeln entsprechen nur der Reihenfolge der Entstehung.” Diese Entscheidung, die narrative Hierarchie abzulehnen, versetzt die Betrachter in eine unangenehme Position: Angesichts dieser Gewaltszenen ohne spezifischen Kontext, ohne erkennbare historische Bezugspunkte, sind wir gezwungen, die Bedeutung jenseits der chronologischen Abfolge der Ereignisse zu suchen.
Die von Zhang Nan gemalten Figuren sind Körper in der Krise, deformierte Anatomien, die die Spuren einer rigorosen akademischen Ausbildung tragen, sie absolvierte ihre Grundausbildung an der Kunstakademie von Xi’an, und die einem radikalen Dekonstruktionsprozess unterzogen wurden. “Es ist mir sogar passiert, ans Aufgeben des Kunststudiums zu denken”, gesteht sie. Diese Zeit des Zweifelns führte zu einem fruchtbaren Bruch: Anstatt die reale Anatomie zu reproduzieren, rekonstruiert Zhang Nan “eine andere Form von Struktur durch die Malerei, eine Struktur, die nicht auf dem äußeren Erscheinungsbild basiert, sondern auf dem Inneren.” Die von ihr gemalten Körper sind daher keine Fehler oder Annäherungen, sondern bewusste Konstruktionen, die das Sichtbarmachen dessen zum Ziel haben, was üblicherweise verborgen bleibt.
Der Verweis auf Francis Bacon, den sie selbst in ihrer Künstlererklärung erwähnt, ist kein Zufall. Wie der irische Maler versucht Zhang Nan, “eine neue Form von Realität in einer Zeit zu erfassen, die von der Dominanz des fotografischen Bildes geprägt ist.” Aber auch hier ist Vorsicht bei zu schnellen Gleichsetzungen geboten. Während Bacon sich für Verformung als Mittel zur Wahrheitsenthüllung des Fleisches interessierte, verwendet Zhang Nan die Verformung als Werkzeug zur Entpersonalisierung. Indem sie “bewusst bestimmte Merkmale wie Alter, Herkunft oder manchmal sogar das Geschlecht ausradiert”, schafft sie Figuren, die eine Form von Universalität anstreben. Paradoxerweise macht sie diese dadurch, dass sie ihnen ihre individuellen Attribute entzieht, fähig, “mit einer Vielfalt von Blicken und persönlichen Geschichten in Resonanz zu treten.”
Dieses Streben nach Universalität könnte naiv oder anmaßend erscheinen, wäre da nicht ein scharfes Bewusstsein für ihre eigenen Grenzen und Widersprüche. Zhang Nan beansprucht nicht, eine endgültige Formel gefunden zu haben; sie erkundet, tastet sich voran und entwickelt ihre visuelle Sprache im Verlauf der Leinwände. Die Serie Brothers bleibt übrigens unvollendet, in ständiger Expansion, was für eine frisch graduierte Künstlerin bemerkenswerte künstlerische Reife zeigt. Sie versteht, dass manche Fragen nicht gelöst, sondern nur immer präziser formuliert werden können.
Die Entscheidung, sich nach ihrem Studium an der ENSAD Nancy in Berlin niederzulassen, verdient ebenfalls Beachtung. Diese Stadt mit ihrer bewegten Geschichte und ihrer heutigen Rolle als europäischer künstlerischer Knotenpunkt bietet einen besonders fruchtbaren Kontext für eine Künstlerin, die sich mit Erinnerung, Gewalt und Identität auseinandersetzt. Dieser geographische Entschluss ist weit mehr als eine praktische Entscheidung; er fügt sich in eine stringente Logik ein: Zhang Nan positioniert sich bewusst in einem kulturellen Raum, der Experimentierfreude und kritischen Dialog schätzt. “Ich fühle mich dem europäischen Kunstkontext näher”, erklärt sie, “reicher, vielfältiger und günstiger für Experimentieren und Dialog.”
In der Arbeit von Zhang Nan steckt etwas zutiefst Ehrliches. Sie behauptet nicht, die Spannungen, die sie erforscht, zu lösen; sie legt sie mit einer Offenheit offen, die manchmal verstörend sein kann. Ihre Gemälde sind nicht bequem. Sie bieten keine leichte Katharsis oder eine zufriedenstellende narrative Auflösung. Sie konfrontieren uns mit einer Sicht auf die Menschheit, in der Loyalität und Brüderlichkeit, jene an der Oberfläche von Au bord de l’eau gefeierten Werte, mit einer ursprünglichen Gewalt und einem angeborenen Absurden koexistieren. Genau diese Ambivalenz macht die Stärke ihrer Arbeit aus.
Man könnte Zhang Nan vorwerfen, ihre Themen etwas schwerfällig zu behandeln, eine Neigung zur Überbetonung, die manchmal die Komposition erschwert. Einige Gemälde der Serie Brothers scheinen zwischen dem Wunsch nach formaler Klarheit und der Versuchung des expressionistischen Pathos zu schwanken. Aber diese Ungleichgewichte sind Teil des Prozesses. Diese Künstlerin ist noch nicht am Ende ihres Weges; sie baut etwas auf, Bild für Bild, Fehler für Fehler, und genau das macht ihre Arbeit spannend zu verfolgen.
Was Zhang Nan im zeitgenössischen Kunstgeschehen einzigartig macht, ist ihre Fähigkeit, mehrere Erbschaften zu artikulieren, ohne sie zu hierarchisieren oder künstlich gegeneinander auszuspielen. Sie schöpft ebenso natürlich aus der klassischen chinesischen Literatur wie sie sich auf den deutschen Expressionismus bezieht, und diese doppelte Zugehörigkeit wird niemals als Widerspruch empfunden. Im Gegenteil, genau in diesem Dazwischen, in dieser produktiven Reibungszone zwischen den Traditionen, findet ihre Arbeit die authentischste Stimme.
Wenn man die Hängung betrachtet, die sie bei ihrem Diplom vorgeschlagen hat, drei Gemälde der Serie Brothers nebeneinander angeordnet, versteht man sofort ihr Gespür für den Ausstellungsraum. Die Bilder kommunizieren, ohne sich gegenseitig zu erklären, und schaffen eine formale und chromatische Spannung, die die Wirkung jedes einzelnen Werks verstärkt. Diese Intelligenz bei der Raumnutzung, dieses intuitive Verständnis dafür, wie die Bilder miteinander interagieren, ist ein Zeichen für eine Künstlerin, die ihre Arbeit über die reine malerische Geste hinaus denkt.
Zhang Nan gehört zu jener Künstlergeneration, die den einfachen Weg expliziter sozialer Kommentare ablehnt, ohne sich jedoch der reinen Abstraktion zu entziehen. Sie hält eine Verbindung zur Figuration aufrecht, aber eine Figur, die ständig infrage gestellt, hinterfragt, destabilisiert wird. Ihre Figuren sind weder Helden noch Opfer; sie sind ambivalente Präsenz, die die ganze Komplexität und Absurdität der menschlichen Existenz in sich tragen.
Es wäre verfrüht vorherzusagen, wohin sie diese Recherche führen wird. Aber eines ist sicher: Mit der Serie Brothers hat Zhang Nan die Grundlagen einer bildnerischen Sprache gelegt, der Aufmerksamkeit gebührt. Ihre Arbeit revolutioniert die gegenständliche Malerei nicht, und das ist nicht ihre Absicht, aber sie bringt eine eigenständige Stimme ein, eine Perspektive, die unser Verständnis dessen bereichert, was Malerei heute sein kann. In einer von Bildern übersättigten Welt erinnert uns Zhang Nan daran, dass die Ölmalerei, diese uralte Technik, noch unerschlossene Ressourcen besitzt, um uns mit dem, was uns ausmacht und stört, zu konfrontieren.
Im Angesicht ihrer Bilder geht man nicht unversehrt hervor. Man geht nicht getröstet davon. Aber man geht mit Fragen hinaus, und genau das darf man von einer Kunst erwarten, die keine Kompromisse eingeht. Zhang Nan bietet uns keine Antworten. Sie hält uns einen verzerrten Spiegel vor, in dem wir, wenn wir bereit sind, wirklich hinzuschauen, etwas von unserer eigenen Gewalt, unserem eigenen Absurden, unserer eigenen Menschlichkeit erkennen können. Das ist schon viel. Vielleicht sogar das Wesentliche.
- Shi Nai’an, Am Wasserufer, Übersetzung Jacques Dars, Gallimard, Sammlung La Pléiade, 1978
- Stephan Lackner, Max Beckmann 1884-1950 Die Neun Triptychen, Safari-Verlag, Berlin, 1965
- Max Beckmann, “Ein Geständnis”, 1918, zitiert in Carla Hoffmann-Schulz und Judith C. Weitz, Max Beckmann: Retrospektive, St. Louis Art Museum und Prestel-Verlag, 1984