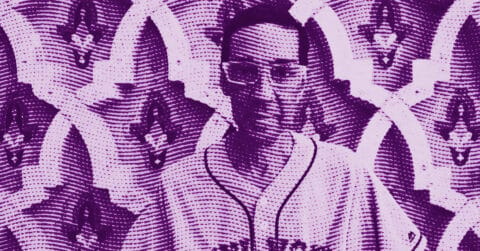Hört mir gut zu, ihr Snobs, ihr, die ihr in den Galerien wie verstopfte Pfauen prahlt und vorgibt, in jedem zufälligen Farbfleck auf der Leinwand Genie zu sehen. Claire Tabouret ist nicht nur ein Name, den ihr strategisch in eure Gespräche einbaut, um eure Schwiegermutter oder euren Bankier zu beeindrucken. Nein, während eure Lieblingskünstler Installationen aus im Müllcontainer gefundenem Abfall schaffen, die sie wagen, “sozio-politischen Kommentar zur Konsumgesellschaft” zu nennen, malt Tabouret, als hinge ihr Leben davon ab, mit einer Intensität, die euch zittern lassen würde, wenn ihr euch wirklich die Zeit nehmen würdet, hinzuschauen.
Diese in Los Angeles lebende Französin besitzt die seltene Gabe, das Wesen eines Menschen einzufangen, das Vergängliche zu fixieren und gleichzeitig die stetige Bewegung auszudrücken, die uns alle durchdringt. Ihre Gemälde sind von einer geisterhaften Präsenz beseelt, einer spektralen Aura, die einen beim ersten Blick in den Bann zieht. Ein wenig so, wie Proust in die verworrenen Pfade des unwillkürlichen Gedächtnisses eintaucht, erforscht Tabouret die Tiefen der Identität, ohne jemals in die Leichtigkeit des dekorativen Erinnerns zu verfallen.
Ob in ihren Porträts von Kindern mit aufgerissenen Augen oder in ihren vielfachen Selbstporträts, die sich wie Spiegelbilder in einem zerbrochenen Spiegel zu verdoppeln scheinen, praktiziert Claire Tabouret eine Archäologie des menschlichen Gesichts mit chirurgischer Präzision. Sie seziert die Schichten von Emotionen, die uns ausmachen, als suche sie nach der Lösung der unmöglichen Gleichung unseres Daseins. Hier drängt sich mir die erste Referenz auf: der Sartresche Existentialismus.
Erinnert euch an diese ikonische Formel von Jean-Paul Sartre in L’Existentialisme est un humanisme: “L’existence précède l’essence” [1]. Dieses grundlegende Prinzip findet einen eindrucksvollen Widerhall in Tabourets Werk. Ihre Figuren werden nicht durch eine vorgegebene Natur definiert, sondern scheinen sich beständig vor unseren Augen zu formen. Nehmen Sie ihre Serie der “Débutantes” (2015), diese jungen Frauen in Ballkleidern mit bläulichen Tönen, die uns mit einer Mischung aus Angst und Entschlossenheit ansehen. Diese Figuren verkörpern perfekt die sartresche Vorstellung, dass der Mensch “zuerst nichts ist” und sich durch seine Taten und Entscheidungen definieren muss.
Die Gesichter, die Tabouret malt, scheinen zwischen zwei Zuständen zu schweben, zwischen zwei Entscheidungszuständen, zwischen Präsenz und Abwesenheit. In “Self-portrait double” (2020) stellt sich die Künstlerin mit zwei dicht nebeneinanderliegenden Gesichtern dar, als wolle sie diese Angst vor der Wahl greifbar machen, diese erdrückende Verantwortung, die das Herz der existentialistischen Philosophie bildet. “Der Mensch ist zur Freiheit verurteilt”, schrieb Sartre [2], und diese schwindelerregende Freiheit spiegelt sich in den vieldeutigen Ausdrücken der Tabouret’schen Sujets wider.
Diese beunruhigende Fremdheit, die von ihren Bildern ausgeht, erinnert an das, was Sartre die “Nausea” nennt, dieses brutale Bewusstsein für die Absurdität des Daseins. Die Figuren von Claire Tabouret scheinen alle diese fundamentale Erfahrung gemacht zu haben, jenen Moment, in dem der Schleier der Illusionen zerreißt, um die nackte Wahrheit unserer Existenz zu enthüllen.
Aber es wäre ein Fehler, das Werk von Claire Tabouret auf eine bloße Illustration philosophischer Prinzipien zu reduzieren. Denn ihre Malerei ist vor allem ein sinnliches Erlebnis von seltener Intensität. Ihre Farben, diese fluoreszierenden Unterschichten, die unter dunkleren Tönen durchscheinen, erzeugen einen nahezu hypnotischen Tiefeneffekt. Man könnte meinen, ihre Motive werden von innen heraus von einem spektralen Licht beleuchtet, als wären sie bereits halb in einer anderen Welt.
Hier kommt meine zweite Referenz ins Spiel: der deutsche expressionistische Film. Die Filme von F.W. Murnau oder Fritz Lang besitzen die gleiche Fähigkeit, Welten zu erschaffen, in denen das Licht selbst zu einer eigenständigen Figur wird, die Gesichter formt und quälende Seelen offenbart.
In “Nosferatu” (1922), Murnaus Meisterwerk, treten Licht und Schatten in einem makabren Ballett gegeneinander an, das über das bloße Erzählen hinausgeht [3]. Ähnlich erzählen die Porträts von Claire Tabouret nicht nur eine Geschichte, sondern tauchen uns in ein visuelles Erlebnis ein, bei dem das Spiel von Licht und Schatten verborgene Wahrheiten enthüllt.
Betrachten Sie aufmerksam “Les Insoumis” (2013), diese Komposition, in der verkleidete Kinder uns mit einer beunruhigenden Intensität anstarren. Ist das nicht die gleiche dramatische Verwendung von Chiaroscuro wie in den expressionistischen Filmen? Diese Art, Gesichter aus der Dunkelheit hervorzubringen, wie in der ikonischen Szene von “M – Eine Stadt sucht einen Mörder” (1931), in der das Gesicht von Peter Lorre plötzlich in der Dunkelheit erscheint [4].
Der deutsche Expressionismus, der aus den Wirren der Nachkriegszeit entstand, suchte danach, die Ängste einer traumatisierten Gesellschaft durch eine Ästhetik der Verzerrung und Übertreibung auszudrücken. Verzerrte Kulissen, ungewöhnliche Kamerawinkel und starke Kontraste dienten dazu, ein tiefes existenzielles Unbehagen visuell darzustellen. Ist das nicht genau das, was Claire Tabouret tut, wenn sie ihre Figuren leicht verzerrt, bestimmte Züge betont und Farbschichten aufträgt, die durch die Haut ihrer Motive zu sickern scheinen?
In “Das Cabinet des Dr. Caligari” (1920) verwendete Robert Wiene Kulissen mit unmöglichen Perspektiven, um ein Gefühl der Entfremdung zu erzeugen [5]. Claire Tabouret hingegen nutzt monochrome Hintergründe oder flüchtige Landschaften, die ihre Figuren zu verschlingen scheinen und dieselbe Empfindung der Loslösung von der Realität schaffen. Ihre Serien von ringenden Kämpferinnen erinnern unweigerlich an die verdrehten Körper des expressionistischen Films, jene Figuren, die wie Gefangene einer albtraumhaften Choreografie wirken.
Was mir an Tabourets Werk am meisten gefällt, ist ihre Fähigkeit, eine permanente Spannung zwischen Individuum und Gruppe zu erzeugen. Ihre kollektiven Porträts sind bevölkert von Gestalten, die, obwohl sie zusammengefügt sind, zutiefst allein wirken. Jedes Gesicht ist eine verschlossene, undurchdringliche Welt, und doch sind alle durch eine Art stiller Gemeinschaft verbunden. Das ist es, was Sartre den “Blick des Anderen” nannte, diese fundamentale Erfahrung, bei der der andere mich mir selbst offenbart und mich zugleich zum bloßen Objekt reduziert [6].
In ihrer Serie “The Team” (2016) präsentiert Tabouret uns ein weibliches Basketballteam aus den 1930er Jahren. Jede Spielerin blickt mit derselben beunruhigenden Intensität in die Kamera, und doch scheint jede in ihrer eigenen existenziellen Blase isoliert zu sein. Genau dieses Paradoxon erforschte der deutsche Expressionismus: die Einsamkeit mitten in der Menge, die Entfremdung im Herzen der modernen Gesellschaft.
Diese Frauen, diese Kinder, die Claire Tabouret malt, haben etwas von den Figuren aus Fritz Langs “Metropolis” (1927) [7]. Sie sind zugleich präsent und abwesend, Individuen und Archetypen, Wesen aus Fleisch und Blut und Gespenster. Ihr Blick durchdringt den Bildschirm oder die Leinwand, um uns direkt anzusprechen und die Grenze zwischen Werk und Betrachter zu durchbrechen.
Was Tabouret von so vielen zeitgenössischen Künstlerinnen unterscheidet, ist ihr Ablehnen von einfacher Ironie und oberflächlichem Sozialkommentar. Ihre Malerei ist nicht konzeptuell im Sinne der Illustration einer vorbestehenden Idee. Vielmehr ist sie eine viszerale Erforschung der menschlichen Kondition, ein Eintauchen in die Abgründe des Bewusstseins.
Wenn sie diese grotesk geschminkten Kinder in der Serie “Les Déguisements” (2015) malt, begnügt sie sich nicht damit, die verlorene Unschuld oder die erzwungene Frühreife zu kommentieren. Sie konfrontiert uns mit der grundlegenden Angst des Seins, das sich hinter sozialen Masken sucht. Wie Sartre schrieb: “Ich bin, was ich nicht bin, und ich bin nicht, was ich bin” [8], eine Formulierung, die diese ambivalenten Figuren, auf halbem Weg zwischen Kindheit und Erwachsensein, zwischen Authentizität und sozialer Rolle, perfekt beschreiben könnte.
Der deutsche Expressionismus war vom Motiv des Doppelgängers, des unheimlichen Selbst, besessen, das uns an unsere eigene Fremdheit zu uns selbst erinnert. Denken Sie an “Der Student von Prag” (1913), in dem der Protagonist sein Spiegelbild dem Teufel verkauft [9]. Claire Tabouret erforscht dieses Thema ständig, insbesondere in ihren Selbstporträts, in denen sie sich verdoppelt darstellt, wie in “Self-portrait (double)” (2020), oder fragmentiert, wie in diesen Porträts, in denen ihr Gesicht unter der Wirkung gewaltiger malerischer Pinselstriche zu zerfließen scheint.
In ihren Gemälden auf Kunstfell, einer Serie, die 2023 im ICA Miami gezeigt wurde, treibt Tabouret diese Erforschung der Dualität noch weiter. Das Material selbst wird zur Metapher unserer gespaltenen Natur: synthetisch, aber organisch anmutend, weich, aber widerstandsfähig, vertraut, aber fremd. Diese Werke erinnerten mich an die Worte von Fritz Lang über den Doppelgänger: “Er ist unser Schatten, unser dunkler Teil, das, was wir in uns selbst nicht sehen wollen” [10].
Die Farbpalette von Claire Tabouret ist besonders interessant. Diese sauren Farben, diese phosphoreszierenden Grüntöne, diese elektrischen Rosa, die dunkleren Farbtönen zugrunde liegen, erzeugen eine visuelle Spannung, die an die revolutionäre Farbverwendung in den späten expressionistischen Filmen erinnert. Insbesondere denke ich an den Einsatz farbiger Filter in einigen Szenen von Murnaus “Faust” (1926), wo die Farbe nicht nur dekorativ, sondern Ausdruck psychologischer Zustände ist [11].
Das Werk von Tabouret überschreitet die traditionellen Grenzen zwischen Abstraktion und Figuration, genauso wie der deutsche Expressionismus die narrativen Konventionen seiner Zeit überschritt. Ihre Figuren treten aus einem Chaos von Farben und Texturen hervor, als kämpften sie darum, sich aus einem ursprünglichen Magma zu befreien. Diese Spannung zwischen Ordnung und Chaos, Form und Formlosigkeit steht im Kern der existenziellen Erfahrung, wie sie Sartre beschrieb.
Was ich in den Porträts von Claire Tabouret sehe, ist das visuelle Echo dieses Satzes aus “Sein und Nichts”: “Der Mensch ist eine unnütze Leidenschaft” [12]. Ihre Motive scheinen alle von diesem schmerzlichen Bewusstsein ihrer eigenen Kontingenz, ihrer eigenen Fragilität durchdrungen zu sein. Und dennoch bestehen sie fort, sie schauen uns an, sie bekräftigen ihre Präsenz trotz allem.
In einer von postmoderner Ironie und leichtem Zynismus überschwemmten Künstlerwelt wagt Claire Tabouret es dennoch, an die emotionale Kraft der Malerei zu glauben. Sie fürchtet sich nicht vor Authentizität, Pathos oder Aufrichtigkeit. Darin ist sie paradoxerweise radikaler als viele Künstler, die sich rühmen, Normen zu brechen, aber nur rebellische Posen recyceln, die konventionell geworden sind.
Die Kuratorin ihrer jüngsten Ausstellung “Au Bois d’Amour”, Kathryn Weir, sprach von der “Bildung der Subjektivität und dem Aufbau der Identität” [13] in Tabourets Werk. Diese gelehrte Formulierung wird der viszeralen Wirkung ihrer Malerei nicht gerecht. Denn was Tabouret erforscht, ist kein abstraktes Identitätskonzept, sondern die konkrete, verkörperte Erfahrung unseres Seins-in-der-Welt.
Sartre schrieb, dass “die Hölle, das sind die anderen” [14] sei, ein oft missverstandener Satz. Er wollte nicht sagen, dass die anderen von Natur aus höllisch seien, sondern dass wir durch den Blick des Anderen festgelegt, objektiviert und auf eine Essenz reduziert werden. Claire Tabourets Gruppenporträts veranschaulichen dieses Paradoxon perfekt: Jede Person ist zugleich subjektiver Betrachter und betrachtetetes Objekt, gefangen in einem unauflöslichen Netz von Blicken, die sie definieren und begrenzen.
Der deutsche Expressionismus war von der Gestalt der Autorität besessen, denken Sie an Dr. Caligari, Mabuse und all jene manipulativen Figuren, die eine unterdrückende Macht verkörpern. Ebenso scheinen die Kinderporträts von Tabouret alle einer unsichtbaren, aber bedrückenden Autorität zu begegnen. Ihre die Kamera herausfordernden Blicke sind stille Akte des Widerstands gegen diese Autorität, die versucht, sie zu definieren und zu katalogisieren.
Was ich an Claire Tabouret außerdem schätze, ist ihre Fähigkeit, Werke zu schaffen, die zugleich mit unserer Zeit und den ewigen Ängsten der menschlichen Existenz resonieren. Ihre Motive sind in der Geschichte verankert, jene Archivfotos, die sie als Ausgangspunkt nutzt, doch sie sprechen uns direkt an, als gäbe es keine Zeit.
Genau das hat doch auch der deutsche Expressionismus getan, nicht wahr? Diese Filme bedienten sich gotischer, volkskundlicher oder historischer Erzählungen, um die sehr zeitgenössischen Ängste der Weimarer Republik zu thematisieren. Ebenso, wenn Tabouret diese Debütantinnen in Kleidern des 19. Jahrhunderts, diese zeitlosen Badenden oder Goldgräber der Rushmore-Zeit malt, spricht sie in Wirklichkeit von uns selbst, unseren Unsicherheiten und unserer Suche nach Identität.
Claire Tabourets Werk ist eine visuelle Meditation über das, was Sartre “mauvaise foi” [15] nannte, jene Tendenz, die wir alle haben, uns selbst anzulügen und in vorgefertigte Identitäten zu flüchten, um die Angst vor Freiheit zu vermeiden. Ihre Motive scheinen alle jenem entscheidenden Moment verhaftet, in dem die Maske wankt und die Wahrheit des Ich droht, durch die Schichten sozialer Konventionen hindurchzubrechen.
Wie die gequälten Figuren des deutschen expressionistischen Films sind Tabourets Charaktere zugleich monströs und zutiefst menschlich, fremd und vertraut. Sie erinnern uns daran, dass das Fremde nicht außerhalb von uns liegt, sondern im Kern unserer Erfahrung der Welt.
Claire Tabouret braucht keine konzeptuellen Kunstgriffe oder theoretischen Diskurse, um ihre Malerei zu rechtfertigen. Sie steht in der langen Tradition von Künstlerinnen, für die Malerei kein Kommentar zur Welt ist, sondern eine Art, in der Welt zu sein, sie zu hinterfragen und zu transfigurieren. In unserer Zeit, in der sich zeitgenössische Kunst oft in steril selbstreferenziellen Spielen verliert, ist diese Authentizität ebenso erfrischend wie subversiv.
Die Buntglasfenster, die sie für Notre-Dame de Paris schaffen wird, werden zweifellos einen Wendepunkt in ihrer Karriere markieren. Ein Übergang vom Intimen zum Monumentalen, vom Säkularen zum Sakralen, dieses Projekt wird ihr ermöglichen, ihre Kunst in den Stein der Geschichte selbst einzuschreiben. Ich zweifle nicht daran, dass sie dieselbe psychologische Intensität einfließen lassen wird, die die Kraft ihrer Malerei ausmacht.
In der Zwischenzeit tauchen Sie ein in ihre Gemälde, lassen Sie sich von diesen Blicken fesseln, die Sie durch Zeit und Raum hindurch anstarren. Denn wie Sartre schrieb: “Das Wichtige ist nicht, was man aus uns macht, sondern was wir selbst aus dem machen, was man aus uns gemacht hat” [16]. Das Werk von Claire Tabouret ist eine Einladung zu dieser essentiellen Freiheit, zu dieser schwindelerregenden Verantwortung, man selbst zu sein in einer Welt, die ständig versucht, uns von außen zu definieren.
- Sartre, Jean-Paul, Der Existentialismus ist ein Humanismus, Editions Gallimard, 1946.
- Ebd.
- Eisner, Lotte H., Der dämonische Bildschirm: Die Einflüsse von Max Reinhardt und des Expressionismus, Editions Ramsay, 1985.
- Kracauer, Siegfried, Von Caligari zu Hitler: Eine psychologische Geschichte des deutschen Films, L’Âge d’homme, 1973.
- Ebd.
- Sartre, Jean-Paul, Das Sein und das Nichts, Editions Gallimard, 1943.
- Elsaesser, Thomas, Metropolis, British Film Institute, 2000.
- Sartre, Jean-Paul, Das Sein und das Nichts, Editions Gallimard, 1943.
- Eisner, Lotte H., Der dämonische Bildschirm: Die Einflüsse von Max Reinhardt und des Expressionismus, Editions Ramsay, 1985.
- Lang, Fritz, Interview mit Peter Bogdanovich, Who the Devil Made It, Alfred A. Knopf, 1997.
- Bouvier, Michel, Der Expressionismus im Kino, La Martinière, 2008.
- Sartre, Jean-Paul, Das Sein und das Nichts, Editions Gallimard, 1943.
- Weir, Kathryn, Ausstellungskatalog “Claire Tabouret: I am spacious, singing flesh”, Palazzo Cavanis, Venedig, 2022.
- Sartre, Jean-Paul, Geschlossene Gesellschaft, Editions Gallimard, 1947.
- Sartre, Jean-Paul, Das Sein und das Nichts, Editions Gallimard, 1943.
- Sartre, Jean-Paul, Saint Genet, Schauspieler und Märtyrer, Editions Gallimard, 1952.