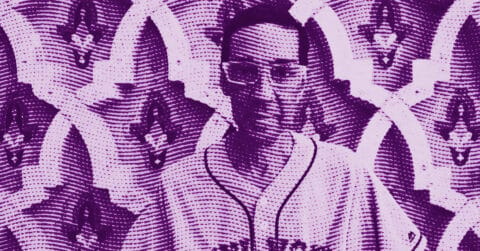Hört mir gut zu, ihr Snobs, Francesco Clemente entzieht sich ständig unserer Wahrnehmung. Dieser italienische Künstler, geboren 1952 in Neapel, ist ein wandelndes Rätsel, das jeder einfachen Klassifikation trotzt. Und das ist auch gut so. Seit mehreren Jahrzehnten pendelt er zwischen Kontinenten, Traditionen und Medien mit einer verblüffenden Flüssigkeit und schafft eine Kunst, die die Grenzen unseres Bewusstseins und die Grenzen unserer Vorstellungskraft in Frage stellt.
Als intellektueller Nomade par excellence hat Clemente die eindimensionalen Etiketten der Bewegung “Transavanguardia”, mit der er oft in Verbindung gebracht wird, überschritten. Sein Werk geht über bloße ästhetische Überlegungen hinaus und taucht in ein viel ambivalenteres Gebiet ein: die fortwährende Metamorphose, die fluide Identität und Erotismus als Erkenntnisweg.
Was sofort auffällt, ist die viszerale Intensität seiner Selbstporträts. Nehmen Sie sein “Selbstporträt mit einem Loch im Kopf” (1981), ein Werk, das nicht einfach ein Gesicht zeigt, sondern eine metaphysische Wunde offenlegt, eine Öffnung zu einem Jenseits des gewöhnlichen Bewusstseins. Clemente stellt sich mit unerschütterlicher Offenheit dar; sein Körper wird zu einem Schlachtfeld, auf dem widersprüchliche Kräfte aufeinandertreffen. Seine Öffnungen, Mund, Augen, Nasenlöcher, sind nicht bloß anatomische Merkmale, sondern Durchgänge zwischen den Welten, Übergangszonen zwischen Innen und Außen.
Wenn man die Einzigartigkeit Clementes wirklich verstehen will, muss man ihn an der Schnittstelle zweier wesentlicher intellektueller Traditionen verorten: der jungianischen Psychoanalyse und der tantrischen Philosophie. Die erste bietet uns einen Schlüssel zum Dekodieren seiner wiederkehrenden persönlichen Symbole; die zweite erhellt seine Auffassung vom Körper als Mikrokosmos.
Carl Jung, dieser Riese der Psychoanalyse, oft zu Unrecht in den Schatten Freuds gestellt, hinterließ uns das wesentliche Konzept des kollektiven Unbewussten, bevölkert von universellen Archetypen, die Kulturen und Epochen übergreifen [1]. Clemente schöpft reichlich aus diesem symbolischen Reservoir, das der Menschheit gemeinsam ist. Seine hybriden Figuren halb Mensch, halb Tier, seine körperlichen Metamorphosen, seine Bilder sexueller Vereinigung sind keine bloßen surrealistischen Fantasien, sondern Manifestationen von Archetypen, die tief in unserer kollektiven Psyche verankert sind.
“Das kollektive Unbewusste ist jener Teil der Psyche, der das gemeinsame psychologische Erbe der Menschheit bewahrt und weitergibt”, schrieb Jung in “Archetypen und das kollektive Unbewusste” [2]. Genau diese Dimension erforscht Clemente, wenn er uns traumhafte Szenen präsentiert, in denen die Grenzen zwischen Mensch, Tier und Göttlichem verschwimmen. In seiner Serie “The Fourteen Stations” (1981-82), erstmals in der Whitechapel Gallery in London ausgestellt, interpretiert Clemente den christlichen Kreuzweg durch ein persönliches Prisma, in dem Leiden und Transzendenz in einer halluzinatorischen Vision des menschlichen Körpers als Ort der spirituellen Transformation zusammenfließen.
Aber Clemente ist kein bloßer Illustrateur jungianischer Archetypen. Sein Ansatz ist viel körperlicher, sinnlicher. Hier kommt die tantrische Philosophie ins Spiel, mit ihrer Sicht auf den Körper als Vehikel des Wissens und der Befreiung. Nach seinen ersten Reisen nach Indien in den 1970er Jahren wurde Clemente tief von den spirituellen Traditionen des Subkontinents beeinflusst. In der Bibliothek der Theosophischen Gesellschaft in Madras, die er 1976 und 1977 regelmäßig besuchte, studierte er tantrische Texte, die den Körper nicht als Hindernis für Spiritualität betrachten, sondern als ihr bevorzugtes Instrument.
Die tantrische Sichtweise betrachtet den menschlichen Körper als Mikrokosmos, der das gesamte Universum widerspiegelt. Wie der Indologe Alain Daniélou erklärt: “Im tantrischen Verständnis ist der menschliche Körper eine Zusammenfassung des Universums. Alle kosmischen Prinzipien sind darin repräsentiert” [3]. Diese Entsprechung von Makrokosmos und Mikrokosmos durchdringt Clementes Werk, besonders in seinen Selbstporträts, in denen sein Körper zum Schauplatz einer persönlichen Kosmogonie wird.
Nehmen Sie seine berühmten Fresken, die nach uralten Techniken gefertigt wurden. In “Priapea” (1980), ausgestellt im Guggenheim, wird sein Körper wortwörtlich von molligen Putten demontiert in einer Szene, die gleichermaßen mystische Ekstase und Agonie evoziert. Es ist kein Zufall, dass Clemente die Freske als Medium gewählt hat, eine Technik, die, wie er selbst sagt, die “leuchtendste von allen” ist, weil das Pigment nicht mit Bindemitteln, sondern nur mit Wasser gemischt wird und so die absolute Reinheit der Farbe bewahrt. Diese Suche nach Reinheit und Leuchtkraft im malerischen Material spiegelt die spirituelle Suche wider, die sein Werk antreibt.
Doch Vorsicht, ich möchte Ihnen nicht weismachen, dass Clemente ein entrückter Mystiker ist, der über den irdischen Realitäten schwebt. Nein, die Stärke seiner Kunst liegt gerade in der Spannung zwischen spirituellem Streben und leiblicher Verankerung, zwischen Transzendenz und Immanenz. Sein Erotismus ist niemals beliebig, er ist mit metaphysischen Bedeutungen aufgeladen. Wie Georges Bataille in “Erotismus” schreibt: “Erotismus ist die Zustimmung zum Leben bis in den Tod” [4]. Diese Definition passt perfekt zu Clementes Werk, in dem Sexualität ständig mit Fragen von Identität, Auflösung und Wiedergeburt verflochten ist.
Auch die Literatur hat Clementes Fantasie genährt, insbesondere durch seine Zusammenarbeit mit dem Dichter Allen Ginsberg der Beat Generation. Ihre Begegnung Anfang der 1980er Jahre in New York führte zu mehreren Projekten, darunter die Illustration des Gedichts “White Shroud”. Ginsbergs Universum, mit seiner Verschmelzung von östlicher Spiritualität und amerikanischer roher Energie, findet im Werk Clementes eine natürliche Resonanz. Beide bemühen sich, die einfachen Gegensätze zwischen Ost und West, zwischen Heiligem und Profanem zu überwinden.
Ginsberg prangerte in seinem berühmten Gedicht “Howl” eine mechanisierte amerikanische Gesellschaft an, die die empfindlichsten Geister zerquetscht: “Ich habe die besten Geister meiner Generation gesehen, wie sie durch Wahnsinn zerstört wurden, verhungert, hysterisch, nackt…” [5]. Diese Kritik an der Mechanisierung und Entmenschlichung hallt tief mit Clementes Werk wider, das ständig danach strebt, die Welt durch eine üppige Phantasie und ungezügelte Sinnlichkeit wieder zu verzaubern.
Diese geteilte Vision von einer Kunst, die den westlichen Materialismus ablehnt, ohne in billigen Orientalismus zu verfallen, steht im Mittelpunkt von Clementes künstlerischem Schaffen. Sein Nomadentum ist keine Pose, sondern eine innere Notwendigkeit, eine Art, den reduzierenden Kategorien und festgefahrenen Identitäten zu widerstehen. Wie er in einem Interview erklärte: “Wenn Geschichte zu einer Sackgasse führen kann, dann kann vielleicht die Geographie das Territorium meiner Arbeit sein.”
Sehen Sie sich seine Aquarelle aus der Serie “No Mud, No Lotus” (2013-2014) an. Diese Werke, die nach Aufenthalten in Brasilien entstanden sind, vermischen Verweise auf die afro-brasilianische Religion Candomblé mit indischen Motiven und Reminiszenzen an die Malerei der italienischen Renaissance. Clemente begnügt sich nicht damit, diese Traditionen nebeneinanderzustellen; er lässt sie miteinander dialogisieren und schafft einen neuen symbolischen Raum, der ihre scheinbaren Unterschiede transzendiert.
Das ist es, was Clemente grundlegend von den Neo-Expressionisten unterscheidet, mit denen er oft zusammengefasst wurde. Im Gegensatz zu einem Anselm Kiefer, der von der deutschen Geschichte verfolgt wird, oder einem Julian Schnabel, der von seiner eigenen persönlichen Mythologie besessen ist, versucht Clemente, den historischen und kulturellen Determinismen zu entkommen. Seine Kunst ist keine Reaktion auf die konzeptuelle Kunst der 1970er Jahre, wie einige oberflächliche Kritiker vermuten, sondern ein Versuch, eine visuelle Sprache zu schaffen, die ihre Kraft aus den Bildtraditionen der ganzen Welt schöpft, ohne sich von irgendeiner einsperren zu lassen.
Diese Freiheit zeigt sich auch in seiner Technik. Clemente beherrscht eine breite Palette von Medien: Öl auf Leinwand, Pastell, Aquarell, Fresko, Zeichnung… Diese technische Vielfalt ist kein Selbstzweck; sie entspricht unterschiedlichen Bewusstseinszuständen, verschiedenen Formen des Welterlebens. Das Aquarell, mit seiner Transparenz und Flüssigkeit, eignet sich perfekt für flüchtige und sich wandelnde Visionen. Das Fresko, mit seiner mineralischen Solidität, verkörpert eine längere, monumentale Zeitlichkeit. Das Öl, mit seiner sensorischen Reichhaltigkeit, erlaubt es, die Tiefen von Fleisch und Verlangen zu erforschen.
Verstehen Sie mich nicht falsch: Clemente ist kein technischer Virtuose im traditionellen Sinne. Seine Zeichnung kann unbeholfen wirken, seine anatomischen Proportionen ungenau, seine Kompositionen manchmal unausgewogen. Aber diese scheinbaren Unvollkommenheiten sind absichtlich, sie sind Teil einer Strategie, um unsere gewohnten Wahrnehmungsmuster zu umgehen und uns die Welt mit einem neuen, von akademischen Konventionen befreiten Blick sehen zu lassen.
Der Kunsthistoriker Donald Kuspit sprach in Bezug auf Clemente von einer “seligen Lust”. Der Ausdruck ist schön, aber irreführend. Denn in Clementes Kunst ist nichts selig, im Gegenteil, sie ist durchdrungen von einer grundlegenden Sorge, einer ständigen Frage nach der Natur von Identität und Bewusstsein. Der Erotismus, der sein Werk durchdringt, ist keine naive Feier der Sinnlichkeit, sondern eine Erforschung der Grenzbereiche, in denen das Ich im Anderen aufgelöst wird, wo die Grenzen zwischen Innen und Außen verschwimmen.
Diese Auflösung des Ichs drückt Clemente meisterhaft in seinen doppelten Selbstporträts aus, in denen er sich im Gespräch, in der Konfrontation oder in der Gemeinschaft mit sich selbst darstellt. Diese Werke sind keine bloßen narzisstischen Spielereien; sie inszenieren die fundamentale Vielschichtigkeit unseres Seins, was der Philosoph Georges Gusdorf als “die Entdeckung des Selbst als ein Anderer als man selbst” [5] bezeichnete.
Clementes Kunst ist tief zeitgenössisch in ihrer Herangehensweise an Fragen von Identität, Geschlecht und Transkulturalität. Lange bevor diese Themen zu Gemeinplätzen des künstlerischen Diskurses wurden, erforschte Clemente bereits die Fluidität sexueller und kultureller Identitäten. Seine androgynen Figuren, seine metamorphischen Körper und seine respektvolle Aneignung nicht-westlicher Traditionen zeugen von einer Sensibilität, die reduzierende Spaltungen übersteigt.
Aber täuschen Sie sich nicht: Clemente ist kein “politisch korrekter” Künstler im zeitgenössischen Sinne. Seine Kunst lässt sich nicht auf Slogans oder ideologische Haltungen reduzieren. Sie ist zu komplex, zu ambivalent, zu ungreifbar dafür. Sie stellt uns unseren Widersprüchen, unseren ungesagten Sehnsüchten, unseren uralten Ängsten gegenüber. Sie bietet uns keine einfachen Lösungen, sondern lädt uns ein, die Komplexität unserer menschlichen Verfassung zu umarmen.
Das Werk von Francesco Clemente erinnert uns daran, dass Kunst kein bloßer ästhetischer Zeitvertreib ist, sondern eine Form von Erkenntnis, eine Erkenntnis, die durch den Körper, durch die Sinne, durch die Vorstellungskraft vermittelt wird. Eine Erkenntnis, die sich nicht in starre Kategorien zwängen lässt, sondern in den Zwischenräumen, in den Übergangsbereichen, in den liminalen Räumen gedeiht, wo Gegensätze sich treffen und gegenseitig verwandeln.
Vielleicht liegt hier das Geheimnis der anhaltenden Faszination, die die Kunst von Clemente ausübt: in seiner Fähigkeit, Bilder zu schaffen, die sich einer endgültigen Interpretation widersetzen und uns ständig einladen, unseren Blick und unser Denken zu erneuern. Bilder, die, wie Italo Calvino über die Literatur schrieb, “uns erlauben, weiterhin in der Ungewissheit zu leben, was bedeutet, sich aller offenen Möglichkeiten bewusst zu sein.”
- Jung, Carl Gustav. “Archetypen und das kollektive Unbewusste”, Éditions Albin Michel, 1986.
- Jung, Carl Gustav. “Psychologie und Alchemie”, Éditions Buchet/Chastel, 1970.
- Daniélou, Alain. “Shiva und Dionysos”, Éditions Fayard, 1979.
- Bataille, Georges. “Die Erotik”, Éditions de Minuit, 1957.
- Ginsberg, Allen. “Howl and Other Poems”, City Lights Books, 1956.