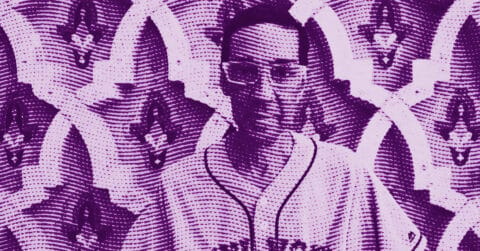Hört mir gut zu, ihr Snobs. Ihr steht da mit euren dicken Brillengestellen und euren monochromen Outfits und schaut auf Stefanie Heinzes Leinwände, als würdet ihr alles verstehen. Aber lasst mich euch eines sagen: Ihr versteht nichts. Und genau darin liegt die ganze Schönheit ihres Werks. Dieses Unverständnis, diese Verwirrung, die ihr beim Betrachten ihrer Bilder empfindet, ist genau das, was sie sucht.
Die mit grellen Farben und zweideutigen Formen überquellenden Gemälde dieser Berliner Künstlerin entführen uns in eine Welt, in der Materialität auf das Fremde trifft, in der Abstraktion mit der Figuration flirtet, ohne sich ihr wirklich zu unterwerfen. Sie verwandelt die Leinwand in ein Schlachtfeld, auf dem sich mutierende organische Formen mit Farben messen, die ihre Präsenz lautstark verkünden.
Wenn ich ihre Bilder betrachte, habe ich das Gefühl, im Kopf von Alice zu sein, nachdem sie alle Pilze aus dem Wunderland gegessen hat. Organe verwandeln sich in Haushaltsgegenstände, Genitalien werden lebendige Kreaturen, und die Farben überfallen uns mit einer fast unerträglichen Intensität. Kein Wunder, dass Sammler ihre Werke regelrecht reißen! Bei einer Auktion bei Christie’s im Dezember 2023 wurde ihr Bild “Third Date” für 239.000 Dollar verkauft, was das höchste Schätzgebot verdreifachte. Eine Woche später bei Sotheby’s übertraf “Vim” deutlich seine Schätzung und erreichte 203.000 Dollar. Und ehrlich gesagt, ich kann sie verstehen. In einem Markt, der von austauschbaren Werken übersättigt ist, bietet Heinze etwas wirklich Verstörendes.
Was ich an Heinzes Arbeit mag, ist die Art und Weise, wie sie den Schaffensprozess wie eine Alchemistin des Chaos handhabt. Sie beginnt mit sorgfältigen Zeichnungen, oft in kleinen Notizbüchern, die sie überallhin mitnimmt, und überträgt diese dann auf die Leinwand. Aber Vorsicht, das ist keine einfache Vergrößerung! Es ist eine Übersetzung mit all den Unfällen und Transformationen, die das mit sich bringt. Sie sagt selbst: “Ich habe keine Ahnung, wie es aussehen wird. Ich entdecke es, während ich es mache und vertraue einfach der Malerei.” Dieser intuitive Ansatz, dieses Vertrauen in den Prozess selbst, ist Lichtjahre entfernt von der kalten Konzeptkunst, die unsere Galerien allzu oft dominiert.
Franz Kafka hat uns in seiner Die Verwandlung gezeigt, wie ein Mann erwachen kann, verwandelt in ein monströses Insekt [1]. Dieser radikale Verwandlungsprozess, bei dem die stabile Identität plötzlich infrage gestellt wird, findet eine kraftvolle visuelle Entsprechung in Heinzes Gemälden. Sie zeigt uns, wie ein Topfhandschuh sich in eine tränende Kreatur verwandeln kann, wie eine Banane zu einem melancholischen Phallus wird oder wie entkörperte Organe eine betörende visuelle Symphonie bilden. Wie Gregor Samsa, der als Insekt erwacht, erfahren vertraute Gegenstände in Heinzes Bildern eine beunruhigende Metamorphose, werden sowohl wiedererkennbar als auch zutiefst fremd.
Die Anspielung auf Kafka ist nicht zufällig. Wie der Prager Schriftsteller beherrscht Heinze die Kunst, das Fremde vertraut und das Vertraute fremd zu machen. In “Odd Glove (Forgetting, Losing, Looping)” (2019) verwandelt sie einen einfachen Ofenhandschuh in eine Kreatur mit geschlossenen Augen, aus denen Tränen fließen, die bei näherer Betrachtung auch männliche Geschlechtsorgane sind. Diese Verwandlung von Haushaltsgegenständen in emotionale Wesen erinnert stark daran, wie Kafka banale Situationen in absurde bürokratische Albträume verwandelte.
Bei Kafka können gewöhnliche Gegenstände plötzlich bedrohlich oder unverständlich werden, wie in seiner Novelle “Die Sorge des Hausvaters”, wo ein einfacher Gegenstand, Odradek, zu einer rätselhaften Kreatur wird, die sich jeder Kategorisierung entzieht. Ebenso widerstehen die Formen in Heinzes Gemälden jeder stabilen Klassifizierung. Sie existieren in einem Zustand ständigen Flusses und rufen gleichzeitig mehrere Assoziationen hervor, ohne jemals eine eindeutige Identität anzunehmen.
“Vim” (2019) entführt uns in eine Welt, in der die Formen sich ständig zu verändern scheinen, als wollten sie sich keiner festen Identität unterwerfen. Diese Instabilität, diese formale Fluidität erinnert an die kafkaeske Vorstellung einer Welt, in der Identität immer prekär ist und stets von Auflösung bedroht wird. Kafkas Figuren stecken häufig in Situationen, in denen ihre soziale und persönliche Identität infrage gestellt wird, denken Sie an Joseph K. in “Der Prozess”, der eines Verbrechens beschuldigt wird, das er nicht begangen hat und dessen Natur er nicht einmal kennt. Ebenso scheinen die Formen in Heinzes Gemälden in einem ständigen Prozess der Identifikation und Desidentifikation gefangen zu sein, nie ganz sie selbst und immer dabei, etwas anderes zu werden.
Doch bleiben wir nicht bei Kafka. Heinzes Werk steht auch im Dialog mit dem Theater des Absurden, insbesondere mit den Stücken von Samuel Beckett. Wie der irische Autor schafft sie Welten, in denen traditioneller Sinn aufgehoben ist, in denen Körper fragmentiert sind und Warten und Ungewissheit herrschen [2]. In “Food for the Young (Oozing Out)” (2017) erinnern ihre cartoonhaften Formen, die in einem undefinierten Raum schweben, an die Atmosphäre von “Warten auf Godot”, in der die Figuren in einem zeitlichen und räumlichen Schwebezustand existieren und auf eine Lösung warten, die niemals kommen wird.
Becketts Art, die Sprache zu dekonstruieren und sie gleichzeitig komisch und verstörend zu gestalten, findet eine visuelle Resonanz in Heinzes Kompositionen. Ihre oft lyrischen Titel wie “High Potency Brood”, “A Hollow Place in a Solid Body”, “Frail Juice” fungieren als poetische Gegenstücke zur scheinbaren Anarchie ihrer Bilder. Wie in Beckett’s “Endspiel”, wo absurde Dialoge eine tiefe Meditation über die menschliche Existenz verbergen, verbergen Heinzes scheinbar chaotische Kompositionen eine subtile Reflexion über Machtverhältnisse und soziale Normen.
Becketts Figuren werden oft auf dysfunktionale Körper reduziert, die in engen Räumen eingesperrt sind; denken Sie an Winnie, die bis zur Taille und dann bis zum Hals vergraben ist in “Glückliche Tage”, oder die Figuren in Urnen in “Komödie”. Diese Reduzierung des Körpers auf eine zugleich komische und pathosgeladene Präsenz findet eine Parallele in Heinzes Art, die körperlichen Formen in ihren Gemälden zu fragmentieren und neu zu konfigurieren. Organe werden aus ihrem üblichen Kontext isoliert, Gliedmaßen winden sich zu unmöglichen Konfigurationen und erzeugen ein Gefühl von körperlicher Entfremdung, das zutiefst beckettisch ist.
Bei Beckett gibt es eine ständige Spannung zwischen Komik und Tragik, dem Banalen und dem Tiefgründigen. Dieselbe Spannung belebt die Gemälde von Heinze. Ihre biomorphen Formen erinnern sowohl an intime Organe als auch an Alltagsgegenstände und schaffen einen Dialog zwischen dem Körper und der materiellen Welt um uns herum. In “Der Professor” (2020) setzt sie Elemente nebeneinander, die mal die akademische Autorität und mal die körperliche Zerbrechlichkeit hervorrufen, in einer Komposition, die an das Theater des Absurden von Beckett erinnert, in dem Körper oft auf ihre grundlegendste Funktion reduziert werden.
Becketts schwarzer Humor, “Nichts ist lustiger als das Unglück”, wie Nell in “Endspiel” sagt, findet sein visuelles Pendant in Heinzes Ansatz. Sie nimmt potenziell schwere Themen, den Körper, das Geschlecht, die Macht, und behandelt sie mit einer Leichtigkeit, die ihre Ernsthaftigkeit nicht mindert, sondern sie zugänglicher, unmittelbarer macht. Diese Mischung aus Ernst und Verspieltheit erzeugt eine produktive Spannung, die den Betrachter dazu anregt, sich aktiv mit dem Werk auseinanderzusetzen, anstatt es passiv zu konsumieren.
Aber täuschen Sie sich nicht: Trotz dieser literarischen Bezüge ist Heinzes Kunst tief in der Materialität der Malerei verwurzelt. Sie illustriert keine Konzepte; sie schafft visuelle Erfahrungen, die unsere Wahrnehmung herausfordern. Wie sie selbst sagt: “Ich arbeite nicht nach anderen Künstlern. Ich sehe gerne Gemälde und mag viele Maler, aber ich arbeite nicht nach ihnen.” Diese unerschütterliche Unabhängigkeit ist Teil ihres Charmes. Sie ist nicht hier, um sich höflich in eine bereits bestehende künstlerische Linie einzufügen, sondern um ihre eigene visuelle Sprache, ihre eigene malerische Grammatik zu schaffen.
Was mir an ihren Bildern auch gefällt, ist diese spürbare Spannung zwischen Kontrolle und Hingabe. Heinze spricht oft über die Schwierigkeit, eine leere Leinwand anzugehen, über die Angst, die dem Wandel vorausgeht. Sie erwähnt “die Wahl zwischen Fähigkeit und Unfähigkeit”, die Kontrolle repräsentiert. Dieser Kampf, ein Gleichgewicht zwischen technischer Meisterschaft und dem Loslassen der Intuition zu finden, erinnert daran, wie Beckett versuchte, “eine Form zu finden, die das Chaos aufnimmt”, um seine eigenen Worte zu verwenden. In seinen Notizbüchern notierte Beckett: “Ich begann auf Französisch zu schreiben, weil es auf Französisch leichter ist, ohne Stil zu schreiben.” Ebenso sucht Heinze einen Malansatz, der etablierten Stilkonventionen entkommt und die direkte Erfahrung über technische Virtuosität stellt.
In “Breeze Blocks” (2024), einem ihrer jüngsten Werke, die in der Galerie Petzel in New York gezeigt wurden, treibt Heinze diese Erforschung der Grenzen zwischen Ordnung und Chaos noch weiter voran. Die Formen wirken gleichzeitig starr wie Bausteine und fließend wie sich bewegende Flüssigkeiten, was eine visuelle Spannung erzeugt, die daran erinnert, wie Beckett Wiederholung und Variation nutzte, um eine destabilierende Musikalität in seinen Texten zu schaffen. Dieses Werk verkörpert mit seinem fragilen Gleichgewicht zwischen Struktur und Auflösung perfekt die beckettische Ästhetik des kontrollierten Scheiterns, dessen, was er “immer wieder versuchen, immer wieder scheitern, besser scheitern” nannte.
Humor ist im Werk von Heinze ebenfalls allgegenwärtig. Ein scharfer, eigenwilliger Humor, der an jenen von Beckett erinnert. Wenn sie Körperteile in lebendige Kreaturen verwandelt oder Haushaltsgegenstände zu emotionalen Wesen macht, spielt sie mit unseren Erwartungen und schafft visuelle Situationen, die zugleich komisch und beunruhigend sind. Dieser Ansatz erinnert an die absurden Situationen in Becketts Stücken, in denen das Lachen oft aus einem tiefen existenziellen Unbehagen entsteht. So wie Beckett das Lachen als Form des Widerstands gegen die Absurdität der menschlichen Existenz nutzte, verwendet Heinze Humor als Strategie, um mit der Absurdität sozialer Normen und kultureller Erwartungen umzugehen.
Heinze teilt auch mit Kafka und Beckett ein Misstrauen gegenüber etablierten Machtstrukturen. Ihre Gemälde, deren Formen sich weigern, sich stabilen Kategorien zu unterwerfen, können als Kritik an starren sozialen Normen gelesen werden. In “a 2 sie” (2019), dessen Titel sich auf ihr kindliches Verständnis eines Popsongs mit den Worten “A to Z” bezieht, schlägt sie ein “neues Alphabet vor, vielleicht einen Neuanfang für Frauen.” Dieser Wunsch, eine neue visuelle Sprache zu schaffen, befreit von patriarchalen Zwängen, klingt in der Weise an, wie Kafka und Beckett beide versucht haben, dominante sprachliche Strukturen zu unterwandern.
Wie Kafka, der in einem bewusst vereinfachten Deutsch schrieb und einen Stil schuf, der sich den literarischen Konventionen seiner Zeit widersetzte, entwickelt Heinze ein visuelles Vokabular, das sich traditionellen künstlerischen Kategorien entzieht. Und wie Beckett, der das Englische zugunsten des Französischen aufgab, um sich vom Gewicht der englischsprachigen literarischen Tradition zu befreien, strebt Heinze danach, sich von den Erwartungen an traditionelle figurative oder abstrakte Malerei zu lösen.
Heinze beschreibt die Malerei als eine Form des Engagements mit “Leere, Angst, Unsicherheit.” Wie bei Beckett ist das Scheitern kein Hindernis, das es zu vermeiden gilt, sondern ein integraler Bestandteil des kreativen Prozesses, eine potenzielle Quelle von Entdeckung und Innovation. Sie nimmt die “Übersetzungsfehler” an, die auftreten, wenn sie ihre Zeichnungen auf die Leinwand überträgt, und sieht in diesen Zufällen keine Misserfolge, sondern Möglichkeiten, neue formale Möglichkeiten zu entdecken.
Während sich die Welt der zeitgenössischen Kunst oft in pedantischem Intellektualismus oder sterilen Minimalismus verliert, wagt Heinze es, exzessiv, sinnlich, emotional zu sein. Ihre Gemälde halten Sie nicht mit einem kalten Konzept auf Abstand; sie laden Sie ein, in ein Bad aus Farben und Formen einzutauchen, in dem der Sinn aus der sinnlichen Erfahrung und nicht aus vorgefasster Theorie hervorgeht. Sie verlangen eine viszerale Reaktion, keinen intellektuellen Entschlüsselungsprozess.
Dieses Engagement mit dem Körper, mit der Materialität, ist besonders erfrischend in einer Zeit, in der so viel zeitgenössische Kunst scheinbar hauptsächlich existiert, um fotografiert und auf Instagram geteilt zu werden. Die Gemälde von Heinze widerstehen der digitalen Reproduktion; ihre Farbnuancen, ihre Textur, ihr Maßstab müssen persönlich erlebt werden, um vollständig geschätzt zu werden. Sie erinnern uns daran, dass Kunst in ihrer besten Form eine physische Begegnung ist, kein virtuelles Konsumieren.
Ihre gerade zu Ende gegangene Ausstellung in der Fondazione Sandretto Re Rebaudengo mit dem Titel “Your Mouth Comes Second” vertieft ihre Erforschung von Zärtlichkeit, Verletzlichkeit und der Integration von alter und urbaner Spiritualität. Der Titel selbst deutet auf eine Umkehrung der üblichen Prioritäten hin, indem das, was dem Sprachlichen vorausgeht, Beobachtung, Sensibilität, Aneignung, Ungeschicklichkeit, Unsicherheit, in den Vordergrund gestellt wird. Diese Gewichtung der vor-linguistischen Erfahrung erinnert an Becketts Interesse an dem, was bleibt, wenn die Sprache versagt, an jene Momente, in denen Worte nicht mehr ausreichen und nur der Körper mit seinen Gesten und seinem Schweigen kommunizieren kann.
In einer Kunstwelt, die oft von Zynismus und Kalkül beherrscht wird, bietet uns Stefanie Heinze eine erfrischende, bizarre, bunte und vielleicht unbequeme, aber unbestreitbar lebendige Luftzufuhr. Sie versucht nicht, uns mit obskuren Theorien oder pompösen Referenzen zu beeindrucken. Sie lädt uns vielmehr ein, uns in ihren verwirrenden visuellen Welten zu verlieren, unsere eigenen Bedeutungen darin zu finden und die Unsicherheit als eine Form der Befreiung zu umarmen.
Und wenn es Ihnen nicht gefällt, nun ja, dann ist das Ihr Problem, nicht ihres. Heinzes Kunst ist nicht dazu gemacht, verstanden zu werden; sie ist dazu gemacht, erlebt zu werden. Wie die Werke von Kafka und Beckett konfrontiert sie uns mit der grundlegenden Fremdheit der Existenz, mit der Unzulänglichkeit der konventionellen Sprache, um unsere Welterfahrung auszudrücken, und mit der Notwendigkeit, neue Ausdrucksformen zu schaffen.
Also hören Sie beim nächsten Mal, wenn Sie vor einem ihrer Gemälde stehen, auf zu versuchen, es zu “verstehen”. Lassen Sie sich destabilisieren, verwirren, amüsieren. Gerade in diesem Ungleichgewicht liegt die Kraft ihrer Arbeit. Denn wie Beckett sagte: “Ein Künstler zu sein heißt scheitern, wie es kein anderer wagt.” Und Heinze zeigt uns in ihrem glorreichen und überschwänglichen Scheitern, wie Erfolg aussehen kann.
- Franz Kafka, Die Verwandlung, übersetzt von Alexander Vialatte, Gallimard, Paris, 1955.
- Samuel Beckett, Warten auf Godot, Les Éditions de Minuit, Paris, 1952.