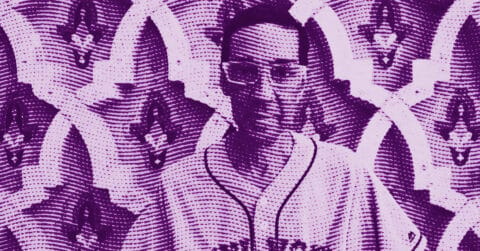Hört mir gut zu, ihr Snobs: Wir irren uns alle, wenn wir Karrieren verehren, die sich über Jahrzehnte erstrecken, vollständige Werke, die ganze Bibliotheken füllen, Künstler, die Zeit hatten, ihren Ruf bis zur Perfektion zu polieren. Joel Elenberg erinnert uns mit erschütternder Brutalität daran, dass ein Genie in drei Jahren reiner Schöpfung explodieren und ein Erbe hinterlassen kann, das der Zeit trotzt. 1980 starb dieser australische Bildhauer im Alter von zweiunddreißig Jahren in einer Villa auf Bali und komprimierte sein ganzes künstlerisches Leben in die Zeit zwischen seiner Entdeckung des Marmors im Jahr 1977 und seinem vorzeitigen Tod. Aber welche Kompression! Wie ein Diamant, der unter extremem Druck geformt wurde, strahlt Elenbergs Werk eine Intensität aus, die nur wenige Künstler im Laufe ihres Lebens erreichen.
1948 in Melbourne in einer jüdischen Familie aus Carlton geboren, besaß Elenberg diese ungezügelte Energie, die wahre Schöpfer kennzeichnet. Seine Angehörigen erinnern sich, wie er die schicken Straßen der Lygon Street durchstreifte, sich die teuersten italienischen Anzüge bei Delmonicos gönnte und einen Stil kultivierte, der ihn zu einer legendären Figur im bohèmehaften Viertel Carlton machte. Diese natürliche Eleganz, diese Fähigkeit, das Gewöhnliche in das Außergewöhnliche zu verwandeln, finden wir unverfälscht in seinen Marmorskulpturen wieder. Elenberg begann mit der Malerei, aber sobald er seine Hände auf den Stein legte, fand er sein Medium. „Ein Pinsel könnte niemals genügend Pigmente enthalten für das, was ich sagen will” [1], erklärte er mit jener Klarheit, die Künstler kennzeichnet, die von der Gnade berührt sind.
Elenbergs Geschichte ist untrennbar mit der von Constantin Brâncuși verbunden, dem rumänischen Meister, der die moderne Bildhauerei revolutionierte. Als Anna Schwartz, Elenbergs Partnerin, erklärt, dass „Brâncuși der einflussreichste Künstler auf Joels Arbeit war. Man sieht starke Einflüsse in dieser Art von Brâncuși-Formen, und die Basis ist sehr brâncusisch” [2], spricht sie den Kern einer geistigen Abstammung an, die über bloßen ästhetischen Einfluss hinausgeht. Brâncuși hatte ein revolutionäres Prinzip aufgestellt: Die Skulptur soll das Wesen der Dinge offenbaren und nicht ihre äußere Erscheinung. „Was real ist, ist nicht die äußere Form, sondern das Wesen der Dinge”, behauptete der Meister. Elenberg integrierte diese Philosophie in sein eigenes künstlerisches Fleisch, fügte ihr jedoch eine archaische Dimension hinzu, die ihm eigen ist.
Elenbergs italienische Periode von 1977 bis 1980 stellt den Höhepunkt dieser schöpferischen Synthese dar. Eingeladen von Arthur Boyd, seine toskanische Villa Il Paretaio zu bewohnen, und später ansässig in Carrara im SGF-Studio unter der Leitung der Handwerker Silvio Santini, Paolo Grassi und Mario Fruendi, entdeckte Elenberg ein Universum, in dem die jahrtausendealte Tradition der Marmorbearbeitung auf die zeitgenössische Avantgarde trifft. Diese Zusammenarbeit mit den Carrara-Meistern offenbart einen wesentlichen Aspekt seiner künstlerischen Persönlichkeit: Im Gegensatz zum romantischen Bild des einsamen Bildhauers war Elenberg zutiefst gesellig und fähig, Brücken zwischen Kulturen und Generationen zu bauen. Zeugnisse berichten, dass die italienischen Handwerker von ihm sagten, er habe „magische Hände”, die höchste Anerkennung in einem Handwerk, in dem technische Virtuosität seit der Renaissance von Meister zu Lehrling weitergegeben wird.
Das Marmorwerk von Elenberg offenbart ein tiefes Verständnis der Brâncușistischen Lehren sowie eine bemerkenswerte Fähigkeit, diese an seine persönliche Sensibilität anzupassen. Nehmen wir sein Totem von 1979, eine raffinierte Zusammenstellung aus statuarischem weißem Marmor und blutrotem Rosso di Portogallo. Dieses Werk verkörpert die brâncușianische Philosophie des offenbarten Wesens perfekt und zeigt gleichzeitig einen einzigartigen Umgang mit Farbe und Symbolik. Der chromatische Kontrast zwischen reinem Weiß und oxidrot erinnert, in den Worten von Anna Schwartz, an “Blut und den menschlichen Körper” [2]. Doch über diese wörtliche Auslegung hinaus funktioniert das Werk als System dynamischer Spannungen, in dem jedes geometrische Element mit den anderen in einem zerbrechlichen und poetischen Gleichgewicht steht.
Elenbergs Technik zeigt eine erstaunliche Beherrschung für einen so jungen Künstler. Die runden Formen des Totems wurden auf der Drehbank gedreht, die Einlagen wurden von Hand mit einem Diamantrad gefertigt, ein komplexer Prozess, der keinen Fehler toleriert. Diese technische Virtuosität im Dienst einer klaren künstlerischen Vision bringt Elenberg Brâncuși nahe, aber auch der Tradition der Meisterbildhauer der Renaissance. Wie diese versteht er, dass Technik niemals ein Selbstzweck ist, sondern ein Mittel, um eine höhere geistige Wahrheit zu erreichen. Seine Head III von 1978 und seine verschiedenen Masken zeugen von dieser ständigen Suche nach einem Gleichgewicht zwischen formaler Virtuosität und expressiver Kraft.
Hier tritt die jungianische Dimension in Elenbergs Werk ein, eine Dimension, die seine Faszination für Masken und Totems in einem neuen Licht erscheinen lässt. Carl Jung hatte das Konzept der Archetypen entwickelt, jener Urbilder, die das kollektive Unbewusste der Menschheit bewohnen. Für Jung besitzen bestimmte künstlerische Formen eine universelle Resonanz, weil sie aus diesem gemeinsamen Reservoir von Symbolen und Bedeutungen schöpfen. Elenbergs Masken, mit ihren polierten Oberflächen, die das Licht wie Spiegel reflektieren, funktionieren genau als jungianische Archetypen: Sie rufen gleichzeitig die Totenmasken der Antike, die Totems der ozeanischen Kulturen und die stilisierten Gesichter der traditionellen afrikanischen Kunst hervor.
Jung lehrte, dass Individuation, der Prozess, durch den ein Mensch ganz er selbst wird, durch die Auseinandersetzung mit dem Schatten verläuft, jenem dunklen und verdrängten Teil der Persönlichkeit. Elenbergs letzte Werke, geschaffen als er seine unheilbare Krankheit kannte, scheinen genau diese Begegnung mit dem Schatten zu verkörpern. Brett Whiteley, sein enger Freund, schlug vor, dass diese letzten Werke symbolisch als „eine majestätische Versuchsanstalt verstanden werden können, der großen geheimnisvollen Wahrheit Tribut zu zollen, der jeder von uns zu seiner Zeit begegnen muss” [3]. Diese eschatologische Dimension verleiht Elenbergs Masken eine Tiefe, die weit über eine Stilübung oder ästhetische Forschung hinausgeht.
Die jungianische Psychologie hilft uns auch, Elenbergs Anziehung zu tothematischen Formen zu verstehen. Jung sah in Totems Vermittlungsobjekte zwischen der bewussten und unbewussten Welt, Träger von Projektionen verdrängter psychischer Inhalte. Elenbergs Totem, mit seiner bestimmenden Vertikalität und ineinandergreifenden geometrischen Formen, fungiert als axis mundi, eine kosmische Achse, die Erde und Himmel, Materielles und Spirituelles verbindet. Diese sakrale Dimension ist kein Zufall: Sie wurzelt in Elenbergs Faszination für Ursprüngskulturen, seiner „besonderen Empathie für die Völker der Ersten Nationen” und seiner Leidenschaft für „alte afrikanische Kunst und Kunst vergangener Zeiten” [2].
Die jungianische Analyse zeigt auch, warum Elenbergs Werke weiterhin eine so starke Anziehungskraft auf das zeitgenössische Publikum ausüben. Jung unterschied zwei Arten künstlerischer Schöpfung: den psychologischen Modus, der die Realitäten des Alltagslebens widerspiegelt, und den visionären Modus, der “von oben nach unten den Vorhang zerrt, auf dem das Bild einer geordneten Welt gemalt ist, und es ermöglicht, den unergründlichen Abgrund dessen zu erblicken, was noch nicht geworden ist” [4]. Elenbergs Skulpturen gehören entschieden zum visionären Modus: Sie stellen uns Formen gegenüber, die scheinbar aus einer ursprünglichen Zeit hervorgehen, während sie eine technologische Zukunft heraufbeschwören, die wir noch nicht benennen können.
Diese doppelte Zeitlichkeit, die das Archaische und das Futuristische nebeneinander existieren lässt, ist eines der markantesten Merkmale von Elenbergs Stil. Seine Head III und seine verschiedenen Masken rufen gleichzeitig afrikanische Ebenholzskulpturen, japanische Nō-Theatermasken und Science-Fiction-Helme hervor. Diese zeitliche Vielseitigkeit ist kein Zufall: Sie spiegelt Elenbergs einzigartige Fähigkeit wider, aus dem kollektiven Unbewussten Formen zu schöpfen, die mit unserer Zeit sprechen und dennoch ihre Verwurzelung im angestammten Gedächtnis der Menschheit bewahren.
Die jungianische Dimension von Elenbergs Werk erhellt auch seine besondere Beziehung zum Material. Für Jung war die alchemistische Verwandlung, diese Umwandlung von Blei zu Gold, die von mittelalterlichen Alchemisten verfolgt wurde, eine perfekte Metapher für den Prozess der Individuation. Der Alchemist verwandelte nicht nur das Material: Er verwandelte sich selbst im Prozess. Elenberg bearbeitet den Marmor mit genau diesem alchemistischen Bewusstsein. Er beschränkt sich nicht darauf, den Stein zu meißeln: Er verwandelt ihn, indem er seine verborgenen Qualitäten offenbart, seine Fähigkeit, Licht einzufangen und zu reflektieren, seine taktile Sinnlichkeit, die zum Streicheln der polierten Oberflächen einlädt.
Der Einsatz des belgischen schwarzen Marmors in mehreren seiner Werke bezeugt diesen alchemistischen Ansatz. Dieser seltene und schwer zu bearbeitende Stein wird unter seinen Händen zu einem Material von außergewöhnlicher optischer Tiefe, das das Licht absorbieren und gleichzeitig subtile Reflexionen erzeugen kann. Der Wechsel zwischen Schwarz und Weiß der Marmorarten wurde vom Künstler als “die Darstellung der zwei Pole des Lebens” gesehen, eine neue Manifestation dieses jungianischen Dialektik zwischen Schatten und Licht, Unbewusstem und Bewusstem, die sein gesamtes Werk durchdringt.
Elenbergs fulminante Entwicklung wirft Fragen zur Natur der künstlerischen Zeit auf. In drei Jahren intensiver Schöpfung hat er ein Werk geschaffen, das mit dem von Künstlern konkurriert, die Jahrzehnte gearbeitet haben. Diese zeitliche Verdichtung ist kein Zufall: Sie offenbart eine existentielle Dringlichkeit, die jedem Werk eine besondere Intensität verleiht. Im Wissen um seine tödliche Krankheit lebte Elenberg seine letzten Jahre in einer schöpferischen Beschleunigung, die an Beethovens letzte Sonaten oder Van Goghs letzte Selbstporträts erinnert. Dieses Bewusstsein der Endlichkeit schärft die künstlerische Sicht bis zu einer prophetischen Schärfe.
Die Ausstellung “Joel Elenberg: Stone Carving 1977-1978, Italy-Australia” in der Robin Gibson Gallery in Sydney im Oktober 1978 markiert den Höhepunkt dieser Schaffensperiode. Die Kritikerin Nancy Borlase schrieb damals, dass “die Ausstellung die Skulptur wieder auf ihr Podest stellt und ihren kostbaren Status als edle Kunst neu bestätigt” [5]. Diese kritische Anerkennung kam zu dem Zeitpunkt, an dem Elenberg seine plastische Sprache perfekt beherrscht und die Synthese zwischen brâncusianischen Einflüssen und persönlicher Vision ihren ausgereiftesten Gleichgewichtspunkt erreicht hat.
Doch was Elenbergs Werk wirklich einzigartig macht, ist seine Fähigkeit, diese kulturelle Synthese in eine persönliche Sprache zu verwandeln. Wo andere sich vielleicht darauf beschränkt hätten, Brâncuși zu imitieren oder Formen der primitiven Kunst zu reproduzieren, schafft Elenberg ein originäres plastisches Vokabular, das seine geistige Handschrift trägt. Seine Masken sind weder Kopien afrikanischer Objekte noch Variationen zu brâncusi’schen Themen: Sie sind authentische Kreationen, die aus diesen Quellen schöpfen, um etwas Neues zu erfinden.
Diese schöpferische Authentizität erklärt, warum der Kunstmarkt den herausragenden Wert von Elenbergs Werken anerkannt hat. Im Jahr 2023 erreichte seine “Maske (1)” von 1978 bei einer Auktion 550.000 Euro [6], mehr als das Doppelte der oberen Schätzung, und stellte einen neuen Rekord für den Künstler auf, womit er seinen Platz im Pantheon der zeitgenössischen australischen Skulptur bestätigte. Doch jenseits dieser marktwirtschaftlichen Erwägungen ist es das Fortbestehen der ästhetischen Emotion, das die wahre Prüfung großer Kunst ausmacht. Fünfundvierzig Jahre nach seinem Tod lösen Elenbergs Skulpturen weiterhin jene “unheimliche Fremdheit” aus, die Freud authentischen Meisterwerken zuschrieb.
Elenbergs Vermächtnis wirft bedeutende Fragen zur Beziehung zwischen Tradition und Innovation in der zeitgenössischen Skulptur auf. In einer Zeit, in der Konzeptkunst die internationalen Avantgarden beherrschte, entschied sich Elenberg, zur jahrtausendealten Tradition des direkten Bearbeitens zurückzukehren und diese mit einer entschieden modernen Sensibilität zu durchdringen. Diese Haltung mag konservativ erscheinen, offenbart aber in Wirklichkeit eine seltene künstlerische Intelligenz: die Erkenntnis, dass wahre Innovation nicht aus der reinen Abspaltung entsteht, sondern aus der schöpferischen Neuerfindung der Tradition.
Der Werdegang von Elenberg verdeutlicht auch die Bedeutung von Begegnungen in der Entwicklung eines Künstlers. Seine Beziehung zu Brett Whiteley, seine Freundschaft mit Arthur Boyd, seine Zusammenarbeit mit den Handwerkern von Carrara, seine Komplizenschaft mit Anna Schwartz, all diese menschlichen Verbindungen nährten seine Schaffenskraft und ermöglichten ihm, seine künstlerische Sprache in einem Kontext fruchtbarer Austausche zu entwickeln. Diese relationale Dimension der Kunst, die von der Kritik zu oft vernachlässigt wird, ist jedoch ein wesentlicher Aspekt zeitgenössischer Kreation.
Heute, da die zeitgenössische Skulptur neue Materialien und neue Technologien erforscht, erinnert uns Elenbergs Werk daran, dass wahre künstlerische Innovation nicht in der Neuheit der Mittel liegt, sondern in der Authentizität der Vision. Seine Marmorskulpturen, mit jahrtausendealten Techniken geschaffen, sprechen zu unserer Zeit mit einer Schärfe, die nicht immer von den technologisch ausgefeiltesten Installationen erreicht wird.
Elenbergs Beispiel lehrt uns auch, dass die Kürze einer Karriere nicht notwendigerweise ein künstlerisches Handicap darstellt. Wie Basquiat, wie Raduan Nassar, wie all jene Schöpfer, die in ihrem Schwung zu früh dahingerafft wurden, gelang es Elenberg, in wenigen Jahren eine schöpferische Intensität zu konzentrieren, die die Kürze seines Gesamtwerks mehr als wettmacht. Diese Ökonomie der Mittel, diese Fähigkeit, zum Wesentlichen zu kommen, ohne sich in Wiederholungen zu verlieren, ist vielleicht das Zeichen der reinsten künstlerischen Temperamente.
Das Werk von Elenberg konfrontiert uns letztlich mit einer verstörenden Wahrheit: Authentische Kunst entsteht oft aus der Auseinandersetzung mit der Endlichkeit, mit dem scharfen Bewusstsein des Todes, das die Wahrnehmung schärft und den kreativen Ausdruck intensiviert. Seine letzten Skulpturen, im Schatten der Krankheit geschaffen, erreichen eine emotionale Dichte, die nur wenige Kunstwerke zu erreichen vermögen. Sie erinnern uns daran, dass Kunst, jenseits ihrer ästhetischen und konzeptuellen Dimensionen, vor allem ein Sieg über die Zeit ist, eine Art, eine Vision in die Materie einzuschreiben, die über ihren Schöpfer hinaus bestehen wird.
Joel Elenberg verließ uns im Alter von zweiunddreißig Jahren, doch hinterließ er ein Werk, das uns weiterhin hinterfragt und berührt. In seinen polierten Marmorwerken, in seinen geometrischen Assemblagen, in seinen rätselhaften Masken finden wir jene “große geheimnisvolle Wahrheit”, von der Brett Whiteley sprach. Eine Wahrheit, die uns alle betrifft, die uns mit unseren entferntesten Ursprüngen und unseren geheimsten Schicksalen verbindet. Das ist das Genie von Elenberg: in Stein jenes Stück Ewigkeit kristallisieren zu lassen, das im Herzen unserer sterblichen Existenz schlummert.
- Menzies Art Brands, “Joel Elenberg”, www.menziesartbrands.com/blog/joel-elenberg, Website im Juli 2025 besucht
- Anna Schwartz in Queensland Art Gallery, “Anna Schwartz reflektiert über das Werk von Joel Elenberg”, 2024.
- Brett Whiteley zitiert in Deutscher und Hackett, “Maske, 1979”, Verkaufskatalog, 2011
- Carl Jung, “Der Mensch und seine Seele”, 1939
- Nancy Borlase, “The Weekend Australian”, 14.-15. Oktober 1978
- Artprice, “Ergebnisse der Zwangsversteigerungen für Werke von Joel Elenberg”, Website im Juli 2025 besucht