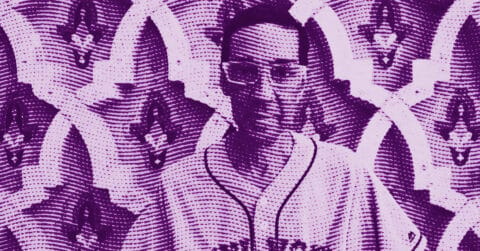Hört mir gut zu, ihr Snobs: Katherine Bernhardt ist nicht die Künstlerin, die ihr zu kennen glaubt. Ihre überschwänglichen Gemälde, die vor lebhaften Farben und Bildern aus unserer konsumorientierten Welt strotzen, sind nicht nur spielerische Arrangements von Pop-Objekten. Nein, was Bernhardt uns liefert, ist eine freudige Dekonstruktion ästhetischer Hierarchien, eine chromatische Freude, die künstlerische Konventionen mit einer absichtlich lässigen Haltung sprengt, hinter der sich eine unerwartete Tiefe verbirgt. Diese in Missouri geborene Künstlerin, von manchen als “böses Mädchen” der zeitgenössischen Kunst betrachtet, entzieht sich jeder einfachen Einordnung: Sie ist weder ganz Pop, noch völlig abstrakt, noch wirklich figurativ. Sie besetzt ein singuläres malerisches Terrain, einen Raum, in dem Chaos herrscht, aber jedes Element auf geheimnisvolle Weise seinen Platz findet.
In ihrem Atelier in St. Louis hat diese Künstlerin einen malerischen Ansatz entwickelt, den einige als chaotisch, andere als befreiend bezeichnen würden. Bernhardt arbeitet wie eine Naturgewalt, ein farbenstürmischer Orkan, der mit fast meteorologischer Energie auf die Leinwand niedergeht. Vor ihren riesigen am Boden liegenden Gemälden, von denen einige bis zu zehn Meter lang sind, wie das auf der Art Basel Unlimited 2018 präsentierte, zeichnet sie mit Spray ungefähre Konturen von Wassermelonen, Zigaretten, Pink Panther oder Hammerhaien, bevor sie verdünnte Acrylfarbe aufträgt, die sich verteilt, verläuft und bunte Pfützen bildet. Sie bekämpft Unfälle nicht, sie provoziert, umarmt und tanzt mit ihnen. Wasser wird zu ihrem entscheidenden Verbündeten, wie sie selbst sagt: “Ich liebe Wasser in meinen Gemälden. Das Wasser arbeitet für mich an meinen Gemälden und verwandelt sie.” Diese Zusammenarbeit mit den Elementen, diese Akzeptanz des Zufalls verleihen ihren Werken eine fast atmosphärische Dimension, als würden wir ein seltsames Wetterphänomen betrachten und kein Gemälde.
Diese Methode erinnert an das, was Georges Bataille in L’Expérience intérieure die “Souveränität” nennt, jenen Teil der Existenz, der der utilitaristischen Rationalität entkommt und sich dem Spiel, dem unproduktiven Aufwand hingibt. “Ich kann nichts Nützliches malen”, scheint Bernhardt uns durch ihre Werke zu sagen, in denen Doritos, Melonenstücke und Mobiltelefone wild durcheinanderliegen, wie in einem chaotischen Supermarkt nach einem Erdbeben. Für Bataille ist die Souveränität jener Teil von uns, der sich der bestehenden Ordnung widersetzt und sich nicht den produktiven Zielen unterordnet. Bernhardts Gemälde feiern genau diese Souveränität, jene ungezügelte Freiheit, die sich von den Zwängen der “guten Malerei” befreit [1].
Bernhardts Ansatz erinnert auch an das, was Susan Sontag in ihren Notes on Camp als eine Sensibilität beschrieb, die “alles in Anführungszeichen sieht” und das schätzt, was “gut ist, weil es schrecklich ist” [2]. Es gibt etwas Unbestreitbar Kitschiges in der Art und Weise, wie Bernhardt sich diese Konsumkitsch-Symbole aneignet: Crocs, Pac-Man, E.T., Garfield, Wassermelonen, Smartphones, um sie in einen wahren malerischen Karneval zu verwandeln. Diese Totems unserer konsumistischen Zeit reißt sie aus ihrer Banalität und haucht ihnen neues, explosives, lebendiges Leben ein. Sie begnügt sich nicht damit, diese Gegenstände darzustellen, sie inszeniert ihre wahnwitzige Parade in einem Raum ohne visuelle oder symbolische Hierarchie. In diesem fröhlichen visuellen Chaos kann sich eine Xanax-Stange neben einer Cartoonfigur befinden, eine Packung Doritos schwebt neben einer Zigarette oder einem Hammerhai, alle mit derselben formalen Begeisterung, derselben chromatischen Freude behandelt. Genau diese Abwesenheit von Hierarchie verleiht ihrem Werk seine tief verwurzelte zeitgenössische Dimension und spiegelt eine Welt wider, in der traditionelle Kategorien zusammenbrechen und die Unterscheidungen zwischen Hoch- und Popkultur verschwimmen.
Aber lassen Sie sich nicht täuschen: Hinter der scheinbaren technischen Lässigkeit verbirgt sich eine meisterhafte Beherrschung des Mediums. Wie ihr Galerist Phil Grauer hervorhebt: “Die Leute sind einfach von ihrer Leidenschaft begeistert und bewundern, wie ihre Werke gleichzeitig von Natur aus unvollkommen und von Natur aus schön sind, gemalt mit perfekter Beherrschung.” Diese Spannung zwischen Kontrolle und Loslassen verleiht ihren Werken eine rohe Energie, die sofort fasziniert.
Im Gegensatz zu vielen zeitgenössischen Künstlerinnen, die mühsam einen theoretischen Diskurs um ihre Werke aufbauen, weigert sich Bernhardt hartnäckig, ihre Praxis zu intellektualisieren. Das stellt sie in einem Interview für Artspace im Jahr 2015 unmissverständlich klar: “Ich glaube, gute Malerei braucht das alles nicht. Ich glaube, die besten Malerinnen intellektualisieren ihre eigene Kunst nicht, sie machen einfach Dinge. Es geht mehr um Farbwahl und Farbkombinationen.” Diese Haltung ist keine bloße Provokation, sondern eine echte künstlerische Ethik. Sie lehnt die pompösen Diskurse ab, die oft die zeitgenössische Kunst umgeben, und hält sich lieber an das Wesentliche: Farbe, Form, Material.
Auf die Frage, warum sie Alltagsgegenstände malt, antwortet sie mit verblüffender Einfachheit: “Sie haben gute Farben und gute Formen. Toilettenpapier ist ein quadratisches Oval. Eine Zigarette ist eine Linie. Eine Rückenflosse ist ein Dreieck, ebenso wie ein Dorito.” Dieser formale, fast naive Ansatz, der die Objekte auf ihre grundlegenden visuellen Eigenschaften reduziert, offenbart einen Blick von außergewöhnlicher Frische auf unsere durch Bilder übersättigte Welt. Bernhardt besitzt das, was der Schriftsteller Milan Kundera “die Weisheit der Unsicherheit” nannte, die Fähigkeit, die Welt ohne den Filter vorgefasster Ideen und fertiger Theorien zu sehen.
Bernhardts Malerei erinnert uns auch an das, was Maurice Blanchot den “literarischen Raum” nannte, einen Ort, an dem Dinge von ihrem Nutzen befreit sind und in einer reinen Gegenwart existieren. In Der literarische Raum schreibt Blanchot, dass Kunst “nicht die Realität der Dinge ist, sondern ihre Verwandlung, ihre vergrößerte Nicht-Realität, ihr Rückzug zur Reinheit ihres Wesens” [3]. Ist das nicht genau das, was Bernhardt tut, wenn sie alltägliche Gegenstände aus ihrem funktionalen Kontext reißt, um sie in den malerischen Raum zu versetzen? Ein Garfield ist in ihren Gemälden kein Comiccharakter mehr, sondern wird zu einem vibrierenden orangen Fleck, einem reinen Zeichen, losgelöst von seiner ursprünglichen Bedeutung.
Diese radikale Kontextentfremdung erinnert mich auch an die Schriften des Italieners Italo Calvino in La Machine Littérature, wo er über die Fähigkeit der Literatur spricht, alltägliche Gegenstände “zu entfremden”, sie wieder sichtbar zu machen, indem sie ihrer Banalität entrissen werden [4]. Durch das ständige Sehen von Wassermelonen, Haien oder Chipstüten sehen wir sie nicht mehr wirklich. Indem Bernhardt sie mit dieser seltsamen Kombination aus Präzision und Unschärfe malt, zwingt sie uns, sie erneut anzuschauen, um ihre grundlegende Fremdheit wiederzuentdecken.
Einige Kritiker sahen in ihren Werken einen Kommentar zum amerikanischen Konsumismus. Das ist möglich, aber Bernhardt selbst lehnt diese zu offensichtliche Lesart ab. “Vielleicht”, sagt sie, wenn man ihr eine ökologische Interpretation ihrer Haie, die zwischen Toilettenpapierrollen schwimmen, vorschlägt. Sicher ist, dass ihre Gemälde die zeitgenössische Erfahrung in all ihrem visuellen Kakophonien und Informationsüberflutung einfangen. In einer Welt, in der wir ständig mit Bildern, Logos und Waren bombardiert werden, absorbiert Bernhardt dieses Chaos und übersetzt es auf ihre Leinwände mit einer manischen Energie, die unsere eigene alltägliche Erfahrung widerspiegelt.
Der Kunstkritiker Christopher Knight schrieb, dass ihre Gemälde “die von Paradies und Hölle der Konsumgüter überschwemmte Welt” zeigen. Diese Formulierung trifft die Ambivalenz ihrer Gemälde perfekt: Sie feiern die farbenfrohe Vitalität unserer materiellen Kultur, während sie zugleich die entfremdende Raserei unserer Beziehung zu Gegenständen andeuten. In dieser Spannung zwischen Staunen und Kritik, zwischen Faszination und Distanz liegt etwas zutiefst Amerikanisches.
Italo Calvino sprach in Leçons américaines von den wesentlichen Eigenschaften der Literatur der Zukunft: Leichtigkeit, Schnelligkeit, Genauigkeit, Sichtbarkeit, Vielfältigkeit [5]. Könnte man nicht sagen, dass Bernhardts Gemälde genau diese Eigenschaften verkörpern? Die Leichtigkeit in ihrem flüssigen, aquarellartigen Pinselstrich, die Schnelligkeit in ihrer energischen Ausführung, die Genauigkeit in ihrer Synthese der Formen, die Sichtbarkeit in ihren leuchtenden Farben, und die Vielfältigkeit in der Gegenüberstellung disparater Elemente.
Ihre Arbeitsmethode selbst beruht auf dieser Vielfältigkeit: Bernhardt ist eine zwanghafte Sammlerin, eine Aufleserin von Bildern und Referenzen, eine unersättliche Aufnahme von visueller Kultur. Sie ist ständig in Bewegung, körperlich und geistig. Wie sie selbst sagt: “Ich bin eine Workaholic und höre nicht auf, bis ich erschöpft bin.” Diese manische Energie spiegelt sich in ihrer Malerei wider, in Kompositionen, die immer kurz davor zu stehen scheinen, zu explodieren, aus dem Rahmen zu fallen.
Von ihren Reisen nach Marokko, wo sie Berberteppiche für ihren Laden Magic Flying Carpets importiert (ein paralleles Geschäft neben ihrer künstlerischen Karriere), bis zu ihren Aufenthalten in Puerto Rico, wo sie ein brutalistisches Haus in San Juan gekauft hat, nimmt sie die chromatischen und formalen Einflüsse verschiedener Kulturen auf. Diese Nomadentätigkeit ist nicht nur eine einfache Vorliebe für Exotik, sondern eine echte Arbeitsmethode, eine Art, ihr visuelles Vorstellungsvermögen ständig zu nähren. Ihr rosa Haus in St. Louis, das durch einen Bericht der New York Times bekannt wurde, ist selbst eine Verlängerung ihres malerischen Universums: eine totalisierte Umgebung, in der Kunstwerke, Vintage-Möbel, Fundstücke und bunte Textilien angesammelt werden.
Ihre gesättigte Farbpalette erinnert ebenso an afrikanische Stoffe wie an die Farben der Karibik, während ihr Umgang mit dem sich wiederholenden Muster an Batikstoffe und marokkanische Teppiche denken lässt. Diese persönliche Geographie, diese affektive Kartographie spiegelt sich in ihren Gemälden wider: ein Raum, in dem die Grenzen zwischen Kulturen verschwimmen, in dem sich die Referenzen frei vermischen und ein neues visuelles Esperanto schaffen, das alle ohne Unterscheidung von Herkunft, Alter oder sozialem Umfeld anspricht.
In ihren eigenen Worten: “Ich versuche immer, die offensichtlichsten, die meist übersehenen Dinge zu malen und sie in meinen Gemälden lustig oder lebendig zu machen.” Diese Suche nach dem banal Verwandelten steht im Zentrum ihres Schaffens. Wie die Ready-mades von Duchamp laden ihre Gemälde uns ein, unsere Beziehung zu Alltagsgegenständen neu zu bedenken, jedoch mit einer Sinnlichkeit und Exubérance, die der Meister des Konzeptuellen nicht gehabt hat.
Katherine Bernhardt ist zweifellos eine der wenigen Künstlerinnen, die den Geist unserer Zeit einzufangen vermag, ohne in Zynismus oder Nostalgie zu verfallen. Sie beklagt nicht die Konsumgesellschaft, sie feiert sie und verwandelt sie zugleich. Sie betrauert nicht den Bedeutungsverlust, sie schafft neue bedeutungsvolle Konstellationen aus den kulturellen Trümmern, die uns umgeben. Und vor allem nimmt sie sich nie zu ernst, eine seltene Eigenschaft in der Welt der zeitgenössischen Kunst.
Ihre Gemälde erinnern uns an das, was Susan Sontag in Against Interpretation schrieb: “Anstelle einer Hermeneutik brauchen wir eine Erotik der Kunst”[6]. Bernhardts Leinwände sind genau das: ein direktes sinnliches Erlebnis, ein chromatischer Angriff, der unsere Tendenz zur Überinterpretation aushebelt. Sie laden uns ein, uns dem reinen Vergnügen von Farbe und Form hinzugeben, eine spielerische und sinnliche Beziehung zu den Bildern zu finden, die unseren Alltag bevölkern.
Vielleicht liegt gerade darin die wirklich subversive Kraft ihres Werks: in der Fähigkeit, unsere Beziehung zur materiellen Welt neu zu verzaubern, Freude und Fremdheit in unsere Interaktionen mit den banalsten Objekten zu bringen. Sie dekonstruiert ästhetische Hierarchien nicht durch theoretische Diskurse, sondern durch den Akt des Malens selbst, durch diese demokratische Geste, die E.T., eine Tüte Doritos und eine Wassermelone auf die gleiche Stufe stellt.
Ihre Serie von Gemälden über E.T., präsentiert in ihrer Ausstellung “Done with Xanax” in der Galerie Canada im Jahr 2019, ist emblematisch für diesen Ansatz. Der Titel selbst spielt mit der Zweideutigkeit zwischen persönlicher Referenz und Kommentar zur zeitgenössischen Pharmakultur. Indem Bernhardt diese ikonische Figur der Popkultur der 80er Jahre malt, verfällt sie nicht einfach in Nostalgie; sie schlägt eine Brücke zwischen ihrer Kindheit und unserer gegenwärtigen Welt, die von Medikamenten, Ängsten und Zuflucht in der Popkultur geprägt ist. Wie ihre Schwester Elizabeth in einem begleitenden Text zur Ausstellung schrieb: “Katherine und E.T. haben vieles gemeinsam… Als sie in den Vororten aufwuchs, identifizierte sie sich sofort mit E.T., der selbst in einem Vorort landete und nicht wusste, wie er entkommen sollte, während er große existenzielle Schmerzen erlitt.”
In einer Kunstwelt, die oft von strenger Konzeptkunst oder didaktischem Sozialkommentar dominiert wird, erinnert uns Bernhardt daran, dass Kunst gleichzeitig kritisch und genussvoll, komplex und zugänglich, raffiniert und unmittelbar sein kann. Sie vollbringt diese seltene Meisterleistung: Werke zu schaffen, die sowohl Kinder als auch erfahrene Sammler, Anfänger wie erfahrene Kritiker ansprechen. Diese Universalität ist kein Ergebnis zynischer Kalküle, sondern einer grundsätzlichen Authentizität, einer Treue zu ihrer persönlichen Vision, die die üblichen Spaltungen in der Kunstwelt überwindet.
Dann hört auf, nach verborgenen Botschaften in diesen Pink Panthers und Melonenscheiben zu suchen. Lasst euch stattdessen von der chromatischen Welle, von diesem Tsunami aus säuerlichen Farben, mitreißen, der die Hierarchien zwischen Hoch- und Popkultur vernichtet. Denn wenn Bernhardts Kunst uns etwas sagt, dann dass das zeitgenössische Leben ein fröhliches Chaos ist und unsere einzige mögliche Antwort darin besteht, diese farbenfrohe Anarchie mit befreiendem Lachen zu umarmen.
- Bataille, Georges. Das innere Erlebnis. Paris: Gallimard, 1943.
- Sontag, Susan. “Notizen zum Camp” in Gegen die Interpretation und andere Essays. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1966.
- Blanchot, Maurice. Der literarische Raum. Paris: Gallimard, 1955.
- Calvino, Italo. Die Literaturmaschine. Paris: Seuil, 1993.
- Calvino, Italo. Amerikanische Lektionen: Erinnerungen für das nächste Jahrtausend. Paris: Gallimard, 1989.
- Sontag, Susan. “Gegen die Interpretation” in Gegen die Interpretation und andere Essays. New York: Farrar, Straus and Giroux, 1966.