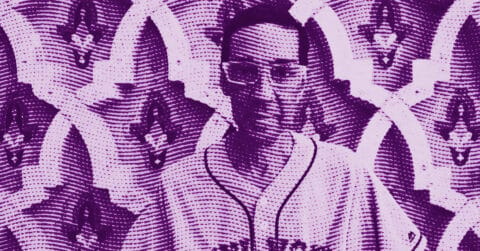Hört mir gut zu, ihr Snobs. Wenn ihr denkt, zeitgenössische Kunst beschränke sich auf absurde NFTs und pretentiöse Installationen, dann wart ihr noch nie vor einem Werk von Celina Portella. Diese Brasilianerin, geboren 1977 in Rio de Janeiro, bewegt sich mit einer Leichtigkeit durch die Kunstgefilde, die selbst die größten Seiltänzer erröten lassen würde.
Portella ist keine Künstlerin wie die anderen. Ihre Werke wurden 2021 mit dem renommierten Luxembourg Art Prize ausgezeichnet, einem internationalen Preis für zeitgenössische Kunst, der ihre weltweite Anerkennung bezeugt. Ihr akademischer und beruflicher Werdegang offenbart sofort die Reichhaltigkeit ihrer künstlerischen Arbeit: Ausgebildet im Design an der PUC in Rio und anschließend mit einem Abschluss in Bildender Kunst an der Universität Paris VIII, tanzte sie zudem für die Compagnie von Lia Rodrigues, bevor sie eine multidisziplinäre künstlerische Karriere begann.
Diese doppelte Ausbildung in Tanz und Bildender Kunst verleiht ihr einen einzigartigen Blick auf den Körper, seine Bewegung im Raum und seine Repräsentation. Portella bewegt sich mit verblüffender Flüssigkeit zwischen den Disziplinen und verwandelt jedes Medium, das sie berührt, in einen Erkundungsraum der Grenzen zwischen Realität und Repräsentation, Materialität und Virtualität, Präsenz und Abwesenheit.
Was sofort ins Auge fällt bei Portellas Werk, ist ihre Art, das Banale in das Außergewöhnliche zu verwandeln. In der Serie “Corte” (2019) fotografiert sie sich dabei, wie sie ihr eigenes Bild auseinander schneidet und so eine schwindelerregende Mise en abyme schafft, in der das Subjekt zugleich Schöpfer und Zerstörer ist. Das Fotopapier wird physisch zerschnitten, was eine perfekte Kontinuität zwischen der dargestellten Aktion und dem materiellen Träger schafft. Diese materielle Intervention auf der Bildoberfläche erinnert an die Experimente von Lucio Fontana, aber Portella fügt eine performative Dimension hinzu, die den zerstörerischen Akt in eine schöpferische Geste verwandelt.
Die Kinetik des Körpers steht im Zentrum ihrer Arbeit. In “Movimento²” (2011) bewegen sich die Bildschirme, die ihre choreographierten Performances projizieren, synchron mit den Bewegungen ihres Körpers im Rahmen. Die Illusion ist so perfekt, dass man unwillkürlich nach den unsichtbaren Fäden sucht, die das Bild mit seiner physischen Manifestation verbinden. Dieses Werk illustriert perfekt Portellas Fähigkeit, Vorrichtungen zu schaffen, die unsere Wahrnehmung der Realität verwischen und uns einladen, unser Verhältnis zu Bildern zu hinterfragen.
Portella spielt ständig mit den Grenzen zwischen Realem und Virtuellem, verwischt die Grenzlinien zwischen Performance, Architektur, Film und Skulptur. In “Vídeo-Boleba” (2012) spielen Kinder Murmeln auf dem Bildschirm, und wenn ihre Murmeln den Rahmen verlassen, erscheinen echte Murmeln auf dem Boden des Ausstellungsraums. Dieser raffinierte Trompe-l’oeil erinnert uns eindringlich daran, dass jede Darstellung eine Konstruktion ist, ein Kunstgriff, der manipuliert, umgelenkt, subvertiert werden kann.
Portellas Verhältnis zum kinetischen Ikonoklasmus stellt eine der interessantesten Dimensionen ihres Werks dar. In “Derrube” (2009) schlägt sie buchstäblich auf ihr eigenes projiziertes Bild mit einer Masse ein und erzeugt so einen visuellen Zusammenbruch, der unser Verhältnis zu Bildern in einer von Repräsentationen übersättigten Welt hinterfragt. Diese Arbeit erinnert an die Überlegungen von Vilém Flusser zu unserer von technischen Bildern dominierten Gesellschaft. Wie er in “Für eine Philosophie der Fotografie” schrieb: “Technische Bilder sind keine Spiegel, sondern Projektoren. Sie spiegeln nicht die Welt wider, sondern projizieren Bedeutungen auf sie” [1]. Portella scheint diese Idee so sehr verinnerlicht zu haben, dass sie die Rohstoffquelle ihrer künstlerischen Arbeit bildet und nicht nur hinterfragt, was die Bilder uns zeigen, sondern auch, wie sie unsere Wahrnehmung der Welt prägen.
Dieses Verhältnis zum Bild als formbare Materie findet sich auch in ihrer Serie “Dobras” (2017), in der Fotografien von Körperteilen gefaltet und gerahmt werden, als wollte sie dem, was zuvor auf die Zweidimensionalität des Papiers beschränkt war, Volumen und Bewegung verleihen. Diese Bild-Objekte rufen die Forschungen von Paul Virilio über die Dromologie hervor, jene Wissenschaft, die die Auswirkungen der Geschwindigkeit auf unsere Wahrnehmung der Welt untersucht. Virilio bemerkte, dass “Geschwindigkeit die Welt auf nichts reduziert” [2], und genau das scheint Portella durch die Verleihung von Materialität, physischer Präsenz und die Verankerung ihrer Bilder im dreidimensionalen Ausstellungsraum entgegenzuwirken.
In ihrer Serie “Puxa” (2015) treibt sie diese Übung noch weiter, indem sie Foto-Objekte schafft, bei denen der Körper, der unter Spannung von Seilen steht, materiell aus dem Rahmen herausragt. Die im Bild sichtbaren Seile sind dieselben, die das Gewicht des Rahmens im Ausstellungsraum tragen. Diese visuelle Kontinuität zwischen dem Dargestellten und dem Realen erzeugt ein seltsames Gefühl der Verdopplung, als wären wir zwischen zwei parallelen Dimensionen gefangen, zwischen zwei unterschiedlichen Zeitlichkeiten, die im gegenwärtigen Moment der Betrachtung auf wundersame Weise zusammenfinden.
Diese Arbeit über Verdopplung und Doppeldeutigkeit erinnert an die Forschungen des russischen Filmemachers Sergei Eisenstein über den intellektuellen Schnitt. Eisenstein versuchte, durch die Gegenüberstellung zweier unterschiedlicher Bilder ein “drittes mentales Bild” zu erzeugen. Er behauptete, dass der Schnitt keine Idee sei, die aus aufeinanderfolgenden, aneinandergereihten Einstellungen besteht, sondern eine Idee, die aus dem Aufprall zwischen diesen Einstellungen entsteht [3]. Portella scheint dieses Prinzip nicht mehr auf die zeitliche Abfolge des Films, sondern auf das räumliche Nebeneinander von Bild und Träger, von Darstellung und Materialisierung anzuwenden. Der Aufprall zwischen diesen beiden Realitäten erzeugt eine dritte Realität, eine mentale, die die Grenzen der einen und der anderen transzendiert.
Jüngst hat Portella in ihrer Serie “Fogo” (2020) begonnen, die zerstörerischen Möglichkeiten des Feuers als transformierendes Element des Bildes zu erforschen. In “Queimada”, einer Serie identischer Fotografien, auf denen sie eine Streichholzschachtel hält, werden verschiedene Stellen verbrannt und so Öffnungen in der Papieroberfläche geschaffen. Der Körper wird so zum Zerstörungsagenten seines eigenen Bildes, und die dargestellte Handlung scheint in die Realität überzugehen. Diese Werke können als Metapher für unsere hypervernetzte Zeit verstanden werden, in der Bilder ebenso schnell verbrennen, wie sie im unaufhörlichen Strom der sozialen Medien entstehen, und dabei vergängliche Spuren ihres Durchgangs hinterlassen.
Die Verwendung von Feuer als künstlerisches Medium erinnert unweigerlich an die Überlegungen von Gaston Bachelard zur symbolischen Kraft dieses Elements. In “Die Psychoanalyse des Feuers” erforscht Bachelard die symbolischen und psychologischen Dimensionen des Feuers, seine Macht der Transformation und Regeneration. Bei Portella zerstört das Feuer das Bild nicht einfach, es verwandelt es, formt es, verleiht ihm eine neue Dimension, die seine zweidimensionale Natur transzendiert. Es ist ein paradoxes Handeln, zugleich zerstörerisch und schöpferisch, das an bestimmte rituelle Performances von Ana Mendieta oder die Brandaktionen von Catherine Mayer erinnert.
Was Portella von vielen zeitgenössischen Künstlerinnen unterscheidet, ist ihre Fähigkeit, sich zwischen verschiedenen Disziplinen zu bewegen, ohne jemals in die Falle der Zerstreuung oder Oberflächlichkeit zu geraten. Jedes Werk ist als autonomes Ökosystem konzipiert, in dem jedes Element (Körper, Bild, Trägermaterial, Raum) mit den anderen in einer sorgfältig orchestrierten Choreographie interagiert. Diese konzeptionelle und formale Kohärenz verleiht ihrer Arbeit trotz der Komplexität der angesprochenen Themen bemerkenswerte Kraft und Verständlichkeit.
Ihre Arbeit ist ebenfalls bemerkenswert zugänglich, ohne simpel zu sein. Ihre Trompe-l’oeil und Spielereien mit der Wahrnehmung enthalten etwas unmittelbar Faszinierendes, das selbst den skeptischsten Betrachter zeitgenössischer Kunst einlädt, sich auf das Werk einzulassen. Doch verbirgt diese Zugänglichkeit eine konzeptionelle Tiefe, die einen genaueren Blick und intensivere Reflexion belohnt. Portella vollbringt die seltene Meisterleistung, Werke zu schaffen, die auf mehreren Ebenen funktionieren und jedem Betrachter eine bereichernde Erfahrung bieten, unabhängig von seiner Vertrautheit mit zeitgenössischer Kunst.
Diese seltene Verbindung von konzeptioneller Intelligenz und formaler Verführung macht Portella zu einer so wichtigen Künstlerin in der gegenwärtigen Landschaft. In einer Zeit, in der zeitgenössische Kunst oft zwischen kargem Konzeptualismus und oberflächlichem Spektakel zu schwanken scheint, erinnert sie uns daran, dass es möglich ist, Werke zu schaffen, die sowohl intellektuell anregend als auch sinnlich ansprechend sind, Werke, die sowohl unseren Geist als auch unseren Körper ansprechen.
Portella hört nicht auf, uns zu überraschen. Mit jeder neuen Serie erweitert sie die Grenzen dessen, was ein Bild sein kann, was ein Körper tun kann, was ein Rahmen enthalten kann. Sie erinnert uns daran, dass Kunst kein unbewegtes Objekt ist, das passiv betrachtet wird, sondern eine lebendige Erfahrung, die uns ebenso verwandelt, wie wir sie verwandeln, ein ständiger Dialog zwischen Werk und Betrachterin, zwischen Virtuellem und Realem, zwischen der in der Bild festgehaltenen Vergangenheit und der Gegenwart ihrer Betrachtung.
In einer Welt, in der wir ständig mit Bildern bombardiert werden, in der Realität und Fiktion auf den Bildschirmen unserer Smartphones verschmelzen, bietet uns Portellas Arbeit einen Raum, über unsere Beziehung zu Bildern und zu unserem eigenen Körper nachzudenken. Sie lädt uns ein, eine Form des Staunens gegenüber der Welt wiederzuentdecken, die Macht der Illusion und Transformation neu zu erfahren und die anhaltende Materialität unserer Erfahrung in einer zunehmend virtuellen Welt anzuerkennen.
Das Werk von Celina Portella stellt einen grundlegenden Beitrag zum zeitgenössischen ästhetischen Denken dar. Indem sie systematisch die Grenzen zwischen Virtuellem und Materiellem verwischt, entwickelt sie eine wahre Phänomenologie des Bildes, die die simplistischen Dichotomien unserer Zeit übersteigt. Ihr Ansatz greift die schärfsten philosophischen Fragestellungen zur Natur der Wahrnehmung und der Repräsentation auf und macht sie zugleich durch eine direkte sinnliche Erfahrung zugänglich. Indem sie uns einlädt, unser Verhältnis zu Bildern nicht als flache Oberflächen zur Betrachtung, sondern als hybride Entitäten, die den Raum bewohnen und verwandeln, neu zu überdenken, trägt Portella zur Entwicklung einer neuen visuellen Ontologie für das 21. Jahrhundert bei. Sie bietet uns somit nicht nur Werke zum Sehen, sondern eine tiefgreifend erneuerte Weise, die Welt zu sehen.
- Flusser, V. (1996). Für eine Philosophie der Fotografie. Circé.
- Virilio, P. (1977). Geschwindigkeit und Politik. Galilée.
- Eisenstein, S. (1976). Der Film: seine Form, seine Bedeutung. Christian Bourgois.