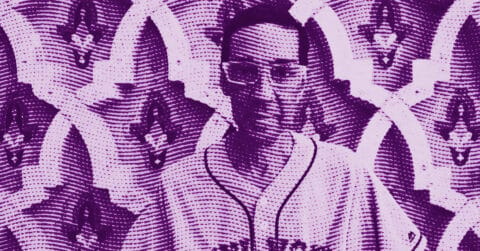Hört mir gut zu, ihr Snobs, hört auf, euch vor den letzten geschmacklosen konzeptuellen Trends zu verneigen und spitzt die Ohren. Ich werde euch von Mimmo Paladino erzählen, diesem italienischen Künstler, der eure Aufmerksamkeit mehr verdient als jede eingebildete Videoinstallation. Das ist ein Künstler, der den Mut hatte, die gegenständliche Malerei in einer Zeit wiederzubeleben, als die Avantgarde sie für tot und begraben hielt. Im Jahr 1977, als die kalte konzeptuelle Kunst dominierte, wagte Paladino die Schaffung von “Silenzioso, mi ritiro a dipingere un quadro” (Still, ich ziehe mich zurück, ein Bild zu malen), ein visuelles Manifest, das seine bewusste Rückkehr zur Malerei ankündigte mit all der subversiven Kraft, die diese Geste mit sich brachte [1]. Es war, als hätte er dem Kunstestablishment gesagt: “Leckt mich am Arsch, ich werde malen, was ich will.”
Diese Trotzhaltung war nicht nur eine rebellische Pose, sondern verkörperte eine tiefe künstlerische Vision. Paladino schöpfte aus den archäologischen Untergründen seines italienischen Heimatlands, um eine visuelle Sprache zu erschaffen, die die Zeit übersteigt. Geboren 1948 in Paduli bei Benevent, wuchs er umgeben von den Relikten einer Region auf, die von Geschichte durchdrungen ist, wo griechische, römische und christliche Überreste neben der Gegenwart koexistieren [2]. Diese Nähe zur Vergangenheit erzeugte bei ihm keinen nostalgischen Sentimentalismus, sondern vielmehr ein scharfes Bewusstsein für die Persistenz mythischer und archaischer Symbole in unserem kollektiven Bewusstsein.
Was mich an Paladino beeindruckt, ist, dass er zeitliche und stilistische Grenzen sprengt, ohne jemals ins Pastiche zu verfallen. Nehmen Sie seine “Montagna di sale” (Salzberg), diese kolossale Installation, die zuerst 1990 in Gibellina gezeigt wurde, dann in Neapel und Mailand. Dreißig verbrannte Holzpferde, die aus einem fünfzehn Meter hohen Salzberg auftauchen [3], was für eine Vision! Das ist visuelles Theater im großen Maßstab, eine apokalyptische Szene, die wie eine kollektive Halluzination wirkt.
Paladino pflegt eine faszinierende Beziehung zur Architektur, die weit über die Ästhetik hinausgeht. Seine architektonischen Werke sind keine bloßen Bauwerke, sie funktionieren als existentielle Metaphern, als Fragen nach dem Platz des Menschen im Universum. Als Paladino 1992 seinen “Hortus Conclusus” im Kreuzgang von San Domenico in Benevent errichtete, verwandelte er nicht nur einen öffentlichen Raum, sondern schuf eine persönliche Kosmologie, ein Mikrokosmos, in dem jedes Element Teil eines größeren Bedeutungssystems ist [4].
Architektur wird bei Paladino zu einem Vermittler zwischen dem menschlichen Körper und dem Kosmos. Wie der Architekt Peter Eisenman betonte: “Architektur ist jene Disziplin, die die Begegnung des Körpers mit dem Anderen organisiert, sei es ein anderer Körper oder das Universum” [5]. Paladino geht über die bloße architektonische Zusammenarbeit hinaus, um Räume zu entwerfen, die unsere gewohnte Wahrnehmung erschüttern. Seine Neugestaltung der Piazza dei Guidi in Vinci im Jahr 2006 beschränkt sich nicht darauf, den urbanen Raum zu verschönern, sie schafft einen visuellen Dialog mit dem Erbe Leonardos, indem sie geometrische Formen verwendet, die an die mathematischen Studien des Renaissance-Meisters erinnern [6].
In seinen Gemälden erscheint die Architektur selbst wie eine geisterhafte Präsenz. Seine Serien mit dem Titel “Architettura” (2000) zeigen flüchtige Zeichen und Bilder, die auf Reliefs aus Karton gezeichnet sind, und interpretieren den Kubo-Futurismus und den Konstruktivismus mit erfinderischer Freiheit neu [7]. Diese Werke stellen nicht einfach Gebäude dar, sie hinterfragen den Begriff des Bauens, des Zusammenfügens, der Struktur, sowohl materiell als auch mental.
Was Paladinos architektonische Herangehensweise auszeichnet, ist, dass sie nie funktionalistisch oder rationalisierend ist. Im Gegenteil, sie umarmt das Geheimnisvolle, das Irrationale, das Symbolische. Seine Umgebungen sind Orte der Kontemplation, Grenzräume, an denen der Betrachter eine andere Zeitlichkeit erfahren kann. Hier findet man eine Resonanz mit dem, was Martin Heidegger “bauen, wohnen, denken” nannte, die Idee, dass die authentische Architektur jene ist, die es dem Menschen ermöglicht, wirklich in der Welt zu wohnen und dort sein Zuhause zu finden [8].
Das “Tor von Lampedusa” (2008), eine monumentale Struktur aus Terrakotta und Eisen, die den auf See gestorbenen Migranten gewidmet ist, veranschaulicht diese existenzielle Dimension perfekt. Dieses Tor, das auf nichts Konkretes, sondern auf das kollektive Vorstellungsbild öffnet, fungiert als symbolische Schwelle zwischen Leben und Tod, Vergessen und Erinnerung [9]. Es konfrontiert den Betrachter mit seiner eigenen Sterblichkeit und lädt zugleich zu einer Meditation über die menschliche Bedingung ein.
Paladinos Anziehung zum primitiven Kunst ist keine bloße formale Aneignung, sondern eine Haltung des Widerstands gegenüber einer entzauberten Moderne. Im Gegensatz zur kolonialistischen Sichtweise des Primitivismus am Anfang des 20. Jahrhunderts sucht Paladino weder das Exotische noch das Naive. Er interessiert sich vielmehr für das, was der Anthropologe Claude Lévi-Strauss die “wilde Denkweise” nannte, nicht primitiv im abwertenden Sinne, sondern strukturell anders, organisiert nach einer Logik des Konkreten [10].
Die stilisierten Figuren von Paladino, seine totemartigen Tiere und rätselhaften Masken sind keine bloßen visuellen Zitate. Sie funktionieren wie zeitgenössische Hieroglyphen, Symbole, deren Bedeutung nie festgelegt, sondern immer im Fluss ist. In seinen Skulpturen wie “Untitled” (1985), dieser Kalksteinfigur mit tiefen Markierungen auf ihrer Oberfläche, findet man eine formale Einfachheit, die an Stammeskunst und archaïsche Kouros erinnert [11]. Aber Paladino imitiert nicht, er erfindet neu.
Dieser Primitivismus wird zu einem Akt der Subversion in einer Kunstwelt, die oft von technologischer und konzeptioneller Raffinesse beherrscht wird. Wie der Kunstkritiker Arthur Danto über Paladino schrieb, gibt es in seiner Arbeit “eine eigene Erhabenheit” [12], eine Präsenz, die Respekt gebietet durch ihre offensichtliche Verbindung mit den Wurzeln des menschlichen künstlerischen Ausdrucks.
Diese Verbindung mit dem Primitiven ist weder nostalgisch noch regressiv, sie ist zutiefst zeitgenössisch. In einer Welt, die von digitalen und virtuellen Bildern übersättigt ist, bekräftigt Paladino die Bedeutung von Materialität, Gestik, Spur. Seine Arbeiten auf Papier, insbesondere seine Serien von Radierungen und Holzschnitten, zeugen von einer taktilen Sensibilität, die sich der zunehmenden Entmaterialisierung unserer Erfahrung widersetzt [13].
Diese Herangehensweise spiegelt die Überlegungen des Philosophen Jean-François Lyotard zur postmodernen Bedingung wider, in der die Vielzahl von Erzählungen die großen einheitlichen Meta-Erzählungen ersetzt [14]. Paladino schlägt keine Rückkehr zu einer mythischen Ursprungs- oder verlorenen Authentizität vor, sondern schafft vielmehr einen Spielraum, in dem verschiedene Zeitlichkeiten und Traditionen koexistieren und in Dialog treten können. Seine Bezüge zur ägyptischen, etruskischen und Stammeskunst werden nicht hierarchisiert, sondern in einem Sichtfeld nebeneinandergestellt, in dem die Bedeutung aus ihrer Interaktion entsteht.
Was bemerkenswert an diesem zeitgenössischen Primitivismus ist, ist sein Selbstbewusstsein. Paladino weiß, dass er nicht zu einer unschuldigen vor-sündhaften Zeit zurückkehren kann; er agiert stets im Kontext einer Kultur, die von Bildern und Bezügen gesättigt ist. Dennoch gelingt es ihm, Werke zu schaffen, die eine fast rituelle Ausdruckskraft bewahren. Seine “Dormienti” (Die Schläfer), diese 32 unbeweglichen Tonfiguren, die 2021 in der Cardi Gallery in Mailand ausgestellt wurden, besitzen diese zeitlose Qualität ritueller Objekte, während sie eindeutig das Werk eines Künstlers sind, der sich der Kunstgeschichte voll bewusst ist [15].
Als herausragendes Mitglied der italienischen Transavantgarde zeichnet sich Paladino durch seine Fähigkeit aus, die gewöhnlichsten Materialien in bedeutungsschwere Objekte zu verwandeln. Bei ihm ist Malerei niemals nur Malerei, es ist eine fast alchemistische Substanz, die das Banale in das Außergewöhnliche verwandeln kann. Die Art und Weise, wie er gefundene Gegenstände, Äste, Fahrräder, Regenschirme in seine Gemälde aufnimmt, zeugt von dieser transformativen Sichtweise [16].
Was Paladino unter seinen Zeitgenossen auszeichnet, ist, dass er eine produktive Spannung zwischen Abstraktion und Figuration, Narrativem und Symbolischem aufrechterhält. Im Gegensatz zu seinen Kollegen der Transavantgarde wie Chia oder Clemente, deren Werke manchmal in einen einfachen Expressionismus abgleiten können, bewahrt Paladino immer eine gewisse Zurückhaltung, eine Mittelknappheit, die die Wirkung seiner Bilder intensiviert.
Ich bin überzeugt, dass Paladinos Kunst den vorübergehenden Moden überdauern wird, gerade weil er sich weigert, sich in einfache Kategorien einordnen zu lassen. Er ist weder Avantgardist noch Traditionalist, weder abstrakt noch figurativ, er ist all dies zugleich, und das macht seine Stärke aus. Wie er selbst sagte: “Ich glaube, dass oberflächliche Kunst sehr gut zu unserer schnelllebigen Zeit passt” [17]. Paladino lädt uns ein, langsamer zu werden, zu betrachten, sich auf eine ästhetische Erfahrung einzulassen, die sich nicht sofort offenbart, sondern sich über die Zeit entfaltet.
In einer Kunstwelt, die von Neuheit besessen ist, erinnert uns Paladino daran, dass wahre Innovation oft darin besteht, das, was vergessen oder vernachlässigt wurde, wiederzuentdecken. Sein Werk ist kein Kommentar zur Kunst, es ist Kunst in ihrer unmittelbarsten und kraftvollsten Form. Und das, liebe Snobs, ist etwas, das eure Aufmerksamkeit verdient.
- Norman Rosenthal, “C.C.C.P.: Zurück in die Zukunft”, in Italienische Kunst des zwanzigsten Jahrhunderts. Malerei und Skulptur, 1900-1988, Prestel mit der Royal Academy, London, herausgegeben von Emily Braun, 1989.
- Flavio Arensi, “Paladino im Palazzo Reale”, mit Essays von Arthur Danto und Germano Celant, Florenz, Giunti, 2011.
- F. Arensi in J. Antonucci, Mimmo Paladino, Frederik Meijer Gardens & Sculpture Park, 2016.
- Enzo Di Martino und Klaus Albrecht Schröder, Mimmo Paladino, Grafikwerk 1974-2001, New York, Rizzoli International Publications, 2002.
- Peter Eisenman, “The End of the Classical: The End of the Beginning, the End of the End”, Perspecta, Band 21, 1984.
- Norman Rosenthal, Mimmo Paladino, Schwarz und Weiß, Waddington Galleries, London, 2006.
- Massimo Carboni, “Mimmo Paladino”, Centro Pecci, Prato, Artforum, 2002.
- Martin Heidegger, “Bauen, Wohnen, Denken”, Essays und Vorträge, Gallimard, 1958.
- Paolo Granata, Universität Bologna, Präsentation der Ausstellung “Mimmo Paladino Grafie della Vita”, 2013.
- Claude Lévi-Strauss, Das wilde Denken, Plon, 1962.
- The Metropolitan Museum of Art, Werkbeschreibung “Untitled”, 1985, Mimmo Paladino.
- A. Danto, “Mimmo Paladino. Transavantgarde bis Meridionalismus”, in F. Arensi, Paladino Palazzo Reale, Ausstellungskatalog, 2011, Giunti Editore.
- Michael Desmond, “Aus Geschichte und Mythos gezeichnet”, in Memories and Voices, Die Kunst von Mimmo Paladino, National Gallery of Australia, 1990.
- Jean-François Lyotard, Das postmoderne Wissen, Éditions de Minuit, 1979.
- Demetrio Paparoni, Ausstellungskatalog “I Dormienti”, Cardi Gallery, Mailand, 2021.
- Massimo Carboni, “Mimmo Paladino”, Centro Pecci, Prato, Artforum, 2002.
- Flash Art, zitiert von Irving Sandler, Art of the Post-Modern Era, Icon Editions, Harper Collins, New York, 1996.