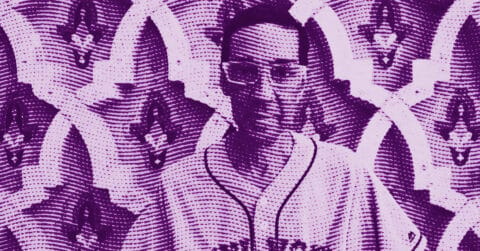Hört mir gut zu, ihr Snobs. Nalini Malani trifft uns mit einer Evidenz, die unsere westliche Arroganz beharrlich zu ignorieren versucht: Zeitgenössische Kunst beschränkt sich nicht auf eure sterilen Galerien, in denen Champagner an eine Elite serviert wird, die vorgibt, weiße Quadrate vor weißem Hintergrund zu verstehen. Nein, die indische Künstlerin, geboren 1946 in Karachi, ein Jahr vor der blutigen Teilung des Subkontinents, präsentiert ein viszerales, politisches und sinnliches Werk, das die künstlichen Grenzen zwischen den Medien überschreitet. Durch ihre Video-Installationen, ihre hypnotischen “Schattenstücke”, digitalen Animationen und ihre reversen Mylar-Gemälde, dieses innovative Material aus Polyester, das eine sehr dünne und widerstandsfähige Oberfläche bietet, reißt Malani den Schleier des kulturellen Konsenses auf, um uns mit Wahrheiten zu konfrontieren, die wir lieber ignorieren.
Als sie 1999 erstmals im Prince of Wales Museum in Mumbai ihre Installation “Remembering Toba Tek Singh” zeigte, inspiriert von der berührenden Novelle von Saadat Hasan Manto über die Teilung, geschah dies nicht, um das Ego der Sammler zu schmeicheln, sondern um täglich 3.000 Museumsbesucher mit den verheerenden Folgen der von Indien durchgeführten unterirdischen Nuklearversuche zu konfrontieren. Das Werk ist keine Wanddekoration, um das Prestige eines bürgerlichen Salons zu steigern, sondern ein politischer Akt, eine Geste des Widerstands gegen den Wahnsinn von Führern, die im Namen des Nationalismus das Überleben der Menschheit selbst bedrohen.
Car Malani geht unermüdlich gegen politische Gewalt, die Unterdrückung von Frauen und soziale Ungerechtigkeiten vor. Ihre Installation “Unity in Diversity” (2003) reagiert auf die blutigen Unruhen in Gujarat im Jahr 2002, bei denen mehr als tausend Menschen, hauptsächlich Muslime, ums Leben kamen. In einem Zimmer, das ein indisches Wohnzimmer der Mittelschicht darstellt, werden Musikerinnen verschiedener kultureller Herkunft brutal durch Schüsse unterbrochen, während im Hintergrund die nationalistischen Reden von Nehru und Bilder der blutigen Opfer zu hören sind. Der Titel bezieht sich auf das Gründungsideal des modernen Indien, eine pluralistische und säkulare Vision, die heute durch die Kräfte des religiösen Sektierertums bedroht ist.
Die Ästhetik von Malani ist niemals beliebig. Ihre technische Beherrschung dient einem Anliegen, einer Dringlichkeit. Wenn sie die umgekehrte Malerei auf Mylar verwendet, eine hybride Technik zwischen traditioneller indischer und zeitgenössischer Kunst, dann um die komplexen Beziehungen zwischen Erinnerung, Identität und historischer Gewalt zu erforschen. In ihrer Serie “Stories Retold” (2002) interpretiert sie hinduistische Mythen neu, um den von der Geschichte vergessenen Frauen eine Stimme zu geben. Ihre Radha ist nicht mehr einfach die spirituelle Geliebte Krishnas, wie es die verharmloste zeitgenössische Interpretation möchte, sondern eine Göttin, die das gesamte Spektrum sinnlichen Vergnügens verkörpert und frei in ihrem eigenen Fleisch schwebt.
Was in Malanis Werk auffällt, ist ihre filmische Intelligenz. Sie wurde an der J.J. School of Arts in Mumbai ausgebildet und experimentierte bereits 1969 mit Film dank des Vision Exchange Workshop, initiiert von Akbar Padamsee. Die Kurzfilme, die sie damals drehte, insbesondere “Still Life”, “Onanism” und “Utopia”, zeigen bereits eine Künstlerin, die sich den Konventionen widersetzt. In “Utopia” (1969/76) erschafft sie eine abstrakte urbane Landschaft, die die von Nehru geförderte modernistische Architektur dekonstruiert und so das postkoloniale indische Idealismus und seine unerfüllten Versprechen hinterfragt.
Die filmische Resonanz ihrer Arbeit ist kein Zufall. Malani begegnete in Paris, wo sie von 1970 bis 1972 lebte, Intellektuellen wie Noam Chomsky, Claude Lévi-Strauss, Jean-Paul Sartre und Simone de Beauvoir. Sie traf sogar Jean-Luc Godard. Diese internationale Offenheit, kombiniert mit einem tiefen Verständnis der indischen Traditionen, ermöglicht es ihr, eine einzigartige visuelle Sprache zu schaffen, die, wie sie selbst sagt, darauf abzielt, “eine Verbindung zwischen verschiedenen Kulturen herzustellen” [1].
Ihr Zugang zu Video und Installation verdankt sie dem Theater. Während ihres Studiums arbeitete Malani am Bhulabhai Memorial Institute in Mumbai, einem multidisziplinären Raum, in dem sie mit Schauspielern, Musikern, Dichtern und Tänzern zusammenarbeitete. Sie erkannte, dass Theater ein Publikum erreichen kann, das niemals die elitären Kunstgalerien der Stadt betreten würde. Diese performative Dimension zeigt sich in ihren “Erasure Performances” wie “City of Desires” (1992), einer temporären Wandzeichnung, die nur fünfzehn Tage in der Gallery Chemould in Mumbai ausgestellt war.
Die Gewalt gegen Frauen steht im Zentrum ihres Werkes. “Can You Hear Me?” (2018-2020), präsentiert in der Whitechapel Gallery in London, ist eine Antwort auf die Vergewaltigung und Ermordung eines achtjährigen Mädchens in Kaschmir. Diese immersive Installation, bestehend aus 88 digitalen Animationen, die auf dem iPad erstellt wurden, versetzt uns in ein Universum fragmentierter Gedanken, in dem sich Texte, Gesichter und Figuren in einem hektischen Rhythmus formen und auflösen. Diese sich ständig bewegenden Zeichentrickfilme erinnern an ein aufgewühltes Bewusstsein, das verzweifelt versucht, dem Entsetzen einen Sinn zu geben.
Was Malani von vielen zeitgenössischen Künstlerinnen unterscheidet, ist ihr Widerstand, sich auf eine festgefahrene Identität festlegen zu lassen. Im Gegensatz zu jenen, die ihre “Indianness” als exotisches Kapital nutzen, um westliche Institutionen zu bezaubern, verwendet sie ihre einzigartige Position, um eine wahrhaft kosmopolitische Kunst zu schaffen. Sie schöpft sowohl aus griechischen als auch indischen Mythen, wie ihr Werk “Sita/Medea” (2006) zeigt, das diese beiden tragischen Frauenfiguren auf einer einzigen Bildebene vereint.
Ihre Praxis ist tief in der Literatur verwurzelt. Für ihre Installation “In Search of Vanished Blood” (2012) ließ sie sich vom Roman “Kassandra” von Christa Wolf und der mythischen Gestalt der Prophetin inspirieren, die dazu verdammt ist, die Wahrheit zu sagen, ohne jemals geglaubt zu werden. Es ist kein Zufall, dass sich Malani mit Kassandra identifiziert, jener Frau, deren Stimme systematisch von männlicher Macht infrage gestellt wird. Als weibliche Künstlerin in einer von Männern dominierten Kunstwelt hat sie lange das erlitten, was die Anthropologin Veena Das als “die herablassende Behandlung” ihrer männlichen Kollegen bezeichnet [2].
Die Installation “Mother India: Transactions in the Construction of Pain”, die für die Biennale von Venedig geschaffen wurde, behandelt offen die sexuellen Gewaltakte an Frauen während der Teilung Indiens. Inspiriert von Veena Das’ Essay “Language and Body: Transactions in the Construction of Pain” untersucht Malani, wie der weibliche Körper in Konfliktzeiten zur Metapher für die Nation wird. Während der Teilung wurden etwa 100.000 Frauen auf beiden Seiten der Grenze entführt und vergewaltigt. Wie Das schreibt: “Die Körper der Frauen waren Metaphern der Nation, sie mussten die Zeichen ihrer Besitznahme durch den Feind tragen” [3].
Was Malani ausmacht, ist ihre Fähigkeit, diese traumatischen Themen in kraftvolle ästhetische Erfahrungen zu transformieren. Ihre “Video/Schatten-Spiele” wie “Gamepieces” (2003) oder “Remembering Mad Meg” (2007) schaffen immersive Umgebungen, in denen Licht, Schatten, Farbe und Klang zu einer synästhetischen Erfahrung verschmelzen. Die rückwärts bemalten rotierenden Zylinder werfen bewegte Schatten an die Wände, während Videos durch sie hindurch projiziert werden; so entstehen mehrere narrative Schichten, die sich überlagern und verweben.
Malanis Interesse an der Figur der “Mad Meg” (Dulle Griet) von Bruegel ist aufschlussreich. Diese Frau, die einen Kochtopf auf dem Kopf trägt und Küchenutensilien an ihrem Gürtel befestigt hat und eine Armee von seltsamen Kreaturen anführt, wird in ihrem Werk zum Symbol weiblicher Stärke und Tapferkeit. In einer Zeit, in der solche Frauen als Hexen verbrannt wurden, erscheint Meg als Widerstandsfigur, die entschlossen durch das Land zieht.
Im Gegensatz zu vielen Künstlerinnen, die sich darauf beschränken, zu kritisieren, ohne Alternativen anzubieten, schlägt Malani einen Weg zur kollektiven Heilung vor. In einem kürzlichen Interview betont sie, dass “die Zukunft weiblich ist. Es gibt keinen anderen Ausweg” [4]. Für sie hat die Dominanz traditionell männlicher Werte zur Zerstörung der Umwelt und zur Unterdrückung der Marginalisierten geführt. Die Lösung liegt in einem Gleichgewicht zwischen den weiblichen und männlichen Tendenzen, die in uns allen existieren.
Ihre kürzliche Praxis digitaler Animationen auf Instagram zeugt von ihrem ständigen Bestreben, ein breiteres Publikum zu erreichen und die Torwächter der Kunstwelt zu umgehen. Diese “animierten Notizbücher”, wie sie sie nennt, sind unmittelbare Reaktionen auf politische und soziale Ereignisse. In einem davon, während der Coronavirus-Pandemie erstellt, blinken eine Waffe mit der Aufschrift “der Staat” und eine ausgestreckte Hand, die “der Bürger” repräsentiert, auf dem Bildschirm, gefolgt von einer Zeile aus Langston Hughes’ Gedicht “Out of Work”.
Was Malanis Werk heute so relevant macht, ist auch ihre Fähigkeit, die künstlichen Trennlinien zwischen Ost und West zu überwinden. In der Ausstellung “My Reality is Different” in der National Gallery in London benutzt sie ihr iPad, um westliche Meisterwerke zu animieren und zu verwandeln, indem sie sie mit ihrer eigenen Perspektive konfrontiert. Rote skizzierte Figuren fallen durch Fragmente großer Gemälde, rutschen entlang der Bünde der Laute in “Die Gesandten” von Holbein oder hauchen der Luftpumpe im “Alptraum des Doktors” von Wright of Derby Leben ein.
Dieser Dialog zwischen den Kulturen ist keine willkürliche Aneignung. Wie Malani betont: “Das Kompendium aller Kulturen ist ein Lexikon für alle Künstler” [5]. Sie lehnt die Vorstellung ab, dass westliche Künstler wie Picasso mehr Legitimität hätten, sich von anderen Kulturen inspirieren zu lassen, als Künstler aus ehemals kolonialisierten Ländern, die oft als “abgeleitet” bezeichnet werden, wenn sie dasselbe tun.
Die politische Dimension ihrer Arbeit ist niemals dogmatisch. In “The Future is Female”, einem jüngeren Werk, erforscht sie, wie traditionell mit der Erde verbundene weibliche Werte eine Alternative zum zerstörerischen Kapitalismus bieten könnten, der die Natur als unendliche Ressource behandelt. Während der COVID-19-Pandemie stellte sie fest, dass die Verschmutzung in Mumbai und Delhi erheblich zurückgegangen ist, was dazu führte, dass Flamingos zahlreich in die Feuchtgebiete der Stadt zurückkehrten. Für sie bestätigt dies Cassandras Vision: Die Wahrheit liegt vor unseren Augen, wir müssen sie nur anerkennen und entsprechend handeln.
Was Nalini Malani groß macht, ist, dass sie Kunst schafft, die uns auf mehreren Ebenen anspricht. Wie sie erklärt: “Es ist eine Beziehung zwischen drei Körpern, dem Künstler, dem Kunstwerk und dem Betrachter. Zusammen erwecken sie die Kunst zum Leben; andernfalls bleibt sie im Schlummer” [6]. Ihre Arbeit lädt uns ein, aktiv an der Bedeutungsfindung teilzunehmen, uns kritisch mit Geschichte, Politik und Kultur auseinanderzusetzen.
Mit über 70 Jahren hat Malani weder an Relevanz noch an Innovationskraft eingebüßt. Als erste Empfängerin des National Gallery Contemporary Fellowship-Stipendiums erforscht sie weiterhin neue Wege des Geschichtenerzählens und hinterfragt dominante Narrative. Ihre Praxis erinnert uns daran, dass Kunst kein überflüssiger Luxus ist, sondern, wie sie treffend sagt, “wie Sauerstoff, wie frische Luft” [7], essenziell für unser kollektives Überleben.
In einer Welt, in der abweichende Stimmen zunehmend marginalisiert werden und Nationalisten sowie Fundamentalisten in vielen Ländern an Boden gewinnen, erinnert uns Malanis Werk daran, wie wichtig es ist, Widerstand zu leisten, Zeugnis abzulegen und alternative Zukünfte zu imaginieren. Sie zeigt uns, dass Kunst politisch engagiert und ästhetisch kraftvoll zugleich sein kann, dass sie uns mit ihrer Schönheit verzaubert und gleichzeitig mit den unangenehmsten Wahrheiten unserer Zeit konfrontiert.
- Malani, Nalini. Gespräch mit Johan Pijnappel, 2005. Webseite der Künstlerin, nalinimalani.com.
- Pijnappel, Johan. “Nalini Malani”, Frieze, 1. Januar 2008.
- Das, Veena. “Sprache und Körper: Transaktionen bei der Konstruktion von Schmerz”, In Social Suffering, herausgegeben von Arthur Kleinman, Veena Das und Margaret Lock. Oxford University Press India, 1998.
- Rix, Juliet. “Nalini Malani, Interview: ‚Die Zukunft ist weiblich. Es gibt keinen anderen Weg‘”, Studio International, 2020.
- Luke, Ben. “Nalini Malani in der National Gallery, Rezension: Eine neue Perspektive für die Meisterwerke der Sammlung”, Evening Standard, 2023.
- Ray, Debika. “Kunst ohne Grenzen, ein Interview mit Nalini Malani”, Apollo Magazine, September 2020.
- Malani, Nalini. Zitiert in “Nalini Malani, Interview: ‚Die Zukunft ist weiblich. Es gibt keinen anderen Weg‘”, Studio International, 2020.