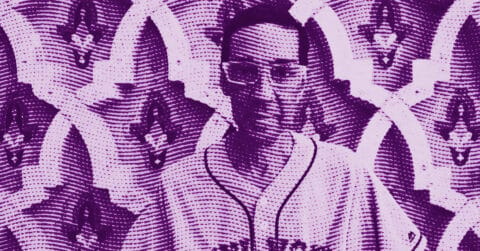Hört mir gut zu, ihr Snobs. Hier ist ein Künstler, der eure wohlgeordneten Klassifikationen und vorgefertigten Theorien kategorisch ablehnt. Rodel Tapaya, geboren 1980 in Montalban in der Provinz Rizal auf den Philippinen, malt Gemälde, die wie topografische Karten des philippinischen kollektiven Unbewussten funktionieren. Seine Werke illustrieren nicht nur folkloristische Erzählungen; sie offenbaren die geologischen Schichten des kulturellen Gedächtnisses mit chirurgischer Präzision und verheerender Poesie.
Die strukturelle Anthropologie des zeitgenössischen Mythos
Tapayas Werk findet seine tiefste theoretische Resonanz in den Arbeiten von Claude Lévi-Strauss, insbesondere in seiner Auffassung des Mythos als strukturierende Sprache des unbewussten Denkens. Der Künstler selbst erkennt diesen Einfluss an, wenn er sagt: “Wie Lévi-Strauss glaubte, sind Mythen nicht einfach eine zufällige Konstruktion primitiver Glaubensvorstellungen oder rückständiger Mentalitäten, sondern Pseudo-Geschichten. Sie liefern das Rohmaterial für eine systematische Analyse der Funktionsweise des unbewussten Geistes” [1]. Dieser theoretische Ansatz strukturiert das gesamte kreative Vorgehen des Künstlers seit seinen ersten Untersuchungen zum Mythos von Bernardo Carpio: “Als imaginativer und leichtgläubiger Junge war ich überzeugt, dass es wahr sei” [2]. Dieser Ansatz bildet die Grundlage für Tapayas künstlerische Praxis, die wie ein Ethnograph der zeitgenössischen Imagination arbeitet.
In Baston ni Kabunian, Bilang pero di Mabilang (2011), einem Werk, das ihm den prestigeträchtigen Signature Art Prize einbrachte, entfaltet Tapaya eine bemerkenswert ausgefeilte Methode der strukturellen Analyse philippinischer Mythen. Die Figur Kabunian, Schöpfergottheit der Bergregion der Nord-Luzon-Kordilleren, wird zum organisierenden Zentrum eines komplexen Netzwerks binärer Beziehungen: Tradition/Moderne, Natur/Kultur, Heiliges/Profanes. Der Künstler illustriert nicht nur den Mythos; er zerlegt seine konstitutiven Elemente, um sie nach einer Logik neu zu kombinieren, die die tiefen Strukturen des zeitgenössischen philippinischen Denkens offenlegt.
Diese Methode entspricht direkt der strukturellen Anthropologie Lévi-Strauss’ in ihrer Fähigkeit, mythische Konstanten jenseits kultureller Variationen zu identifizieren. Tapaya betreibt eine wahre Archäologie symbolischer Formen, indem er fundamentale Mythemes ausgräbt, um sie im postkolonialen Kontext zu aktualisieren. Seine seit 2011 systematisch entwickelte Collagetechnik reproduziert mimetisch den mythischen Bastelprozess, wie ihn der französische Anthropologe analysierte. Jedes visuelle Fragment fungiert als Mythos-Einheit, eine minimale Bedeutungseinheit, die gemäß neuer Logiken rekombiniert werden kann.
Der Ansatz von Tapaya weist jedoch eine wichtige Besonderheit im Vergleich zum Strukturalismus von Lévi-Strauss auf: Er integriert die diachrone Dimension der philippinischen Kolonialgeschichte. Seine Werke offenbaren nicht nur die universellen Strukturen des menschlichen Geistes, sondern auch die spezifischen Transformationen, die diese Strukturen unter dem Einfluss der spanischen, amerikanischen Kolonisation und der zeitgenössischen Globalisierung durchlaufen. The Chocolate Ruins (2013) veranschaulicht diesen Ansatz, indem gezeigt wird, wie Kakao, das koloniale Produkt par excellence, zu einem mythischen Transformationsfaktor wird, der die Veränderungen der philippinischen Vorstellungskraft unter dem Einfluss des globalen Kapitalismus enthüllt.
Der Künstler manipuliert auch die mythischen Zeitlichkeiten nach einer Logik, die an Lévi-Strauss’ Analysen des wilden Denkens erinnert. In Aswang Enters the City (2018) dringen die mythischen Kreaturen Aswang in den zeitgenössischen urbanen Raum ein und fungieren als symbolische Vermittler zwischen der traditionellen Ordnung und dem modernen Chaos. Dieses Werk zeigt auf, wie archaische mythische Strukturen weiterhin die Wahrnehmung der Gegenwart organisieren, insbesondere im Kontext der außergerichtlichen Gewalt unter der Duterte-Administration.
Die kollektive Dimension dieser künstlerischen Produktion entspricht schließlich Lévi-Strauss’ Auffassung des Mythos als Eigentum der Gruppe und nicht des Individuums. Tapaya arbeitet systematisch auf Basis informeller ethnographischer Untersuchungen in den philippinischen Provinzen und sammelt lokale Varianten traditioneller Erzählungen. Diese Methode verwandelt den Künstler in einen Kulturvermittler, der kollektive Erzählstrukturen reaktiviert, um sie für städtische Generationen zugänglich zu machen, die von ihren ländlichen Wurzeln getrennt sind. Sein Atelier in Bulacan fungiert somit als ein Labor für angewandte Anthropologie, in dem die Mythen ihre ursprüngliche soziale Funktion wiederfinden.
Die Architektur der Seele: Psychoanalytische Dimension des Werks
Tapayas Kunst zeigt auch tiefe Resonanzen mit der Architektur des Unbewussten, wie sie von Carl Gustav Jung analysiert wurde, besonders in seiner Theorie der Archetypen und des kollektiven Unbewussten. Die Gemälde des philippinischen Künstlers wirken wie zeitgenössische Mandalas, d.h. komplexe Kreisstrukturen, die die grundlegenden psychischen Spannungen der postkolonialen Gesellschaft enthüllen. Diese psychoanalytische Dimension manifestiert sich besonders eindrücklich in seiner Serie der “Scrap Paintings”, die seit 2019 entsteht, wobei die zwanghafte Anhäufung visueller Fragmente die von Freud in seiner Analyse der Traumprozesse beschriebenen Mechanismen der Verdichtung und Verschiebung evoziert.
Die psychische Topographie von Tapayas Werken weist eine bemerkenswert kohärente Struktur auf, die an die jungianische Kartographie der Psyche erinnert. Seine dichten Kompositionen, bei denen “kein Raum leer bleibt”, reproduzieren das für die philippinische Volkskunst typische horror vacui, offenbaren zugleich aber auch eine tiefere existentielle Angst, die mit der postkolonialen Identitätsfragmentierung zusammenhängt. Diese kompositorische Dichte ist nicht bloß dekorativ; sie stellt plastisch den psychischen Sättigungszustand einer Gesellschaft dar, die mit widersprüchlichen Informationen und heterogenen kulturellen Bezügen bombardiert wird.
Die jungianische Analyse ermöglicht es, zu verstehen, warum die hybriden Kreaturen von Tapaya eine so mächtige Faszination auf die zeitgenössischen Betrachter ausüben. Die Aswang, Tikbalang und andere philippinische mythologische Wesen, die er darstellt, fungieren als Archetypen des Schattens, jenes verdrängten Teils der kollektiven Psyche, der in Zeiten sozialer Krisen wieder auftaucht. Hooded Witness (2019) veranschaulicht diese Dynamik perfekt: die vermummte Figur, Erbin der makapili-Kollaborateure der japanischen Besatzung, offenbart die Persistenz von Denunziations- und Gewalttätigkeitsmechanismen im zeitgenössischen Philippinen. Das Werk fungiert als Enthüller der verdrängten Inhalte des nationalen Bewusstseins.
Die systematische Verwendung tierischer Metamorphosen durch Tapaya fügt sich in diese psychoanalytische Perspektive ein. Seine Figuren, die sich in Schweine, Krokodile oder Affen verwandeln, aktualisieren die archaischen Projektionmechanismen, die Jung beschreibt, bei denen menschliche Triebe sich in tierischer Form kristallisieren. Multi-Petalled Beauty (2012) zeigt so einen sich verwandelnden Affen, der unweigerlich an zeitgenössische Fantasien von Körpermodifikation und genetischer Verbesserung erinnert. Das Tier wird zum Träger einer Reflexion über narzisstische Wunschvorstellungen von Perfektionierung, die die globalisierte Konsumgesellschaft durchdringen.
Die kathartische Funktion dieser Darstellungen ähnelt den therapeutischen Mechanismen der jungianischen Kunsttherapie. Indem Tapaya unbewusste Inhalte sichtbar macht, vollzieht er eine wahrhafte kollektive psychoanalytische Kur. Seine Gemälde fungieren als Übergangsbereiche, in denen die philippinische Gesellschaft ihre historischen Traumata konfrontieren kann, ohne von der emotionalen Last überwältigt zu werden. The Sacrificial Lamb (2015) exemplifiziert diese heilende Funktion, indem es ein brüderliches Opfer darstellt, das gleichzeitig vorchristliche Traditionen und die christliche Passion evoziert und so eine symbolische Integration der verschiedenen religiösen Schichten der philippinischen Kultur ermöglicht.
Die obsessive Wiederkehr bestimmter Motive in Tapayas Werk offenbart schließlich die Existenz wahrer Komplexe im jungianischen Sinne. Der menschliche Schädel, allgegenwärtig in seinen Kompositionen, fungiert als emotionaler Kern, um den die kollektiven Ängste im Zusammenhang mit gewaltsamem Tod und Straflosigkeit kreisen. Diese Totensymbolik ist nicht bloß makaber; sie drückt die notwendige psychische Integration einer Gesellschaft aus, die mit außergewöhnlichen Gewaltleveln konfrontiert ist.
Die wesentliche Innovation Tapayas liegt in seiner Fähigkeit, diese archaischen psychischen Inhalte in eine zeitgenössische bildnerische Sprache zu verwandeln. Seine Kollagen reproduzieren mimetisch die assoziativen Prozesse des Unbewussten, bei denen sich Bilder gemäß nicht-rationalen Logiken verbinden, die tiefere Wahrheiten offenbaren als eine bloße konzeptuelle Analyse. Diese Methode reiht den Künstler unter die großen Entdecker des Unbewussten ein, von André Breton bis Max Ernst, bewahrt dabei jedoch eine unüberwindbare philippinische kulturelle Spezifität.
Das postkoloniale Epos der Gegenwart
Was Tapaya grundlegend von anderen zeitgenössischen narrativen Malern unterscheidet, ist seine einzigartige Fähigkeit, politische Aktualität in epische Materie zu verwandeln. Seine Gemälde beschreiben nicht; sie verklären. Wenn er die außergesetzlichen Hinrichtungen der Duterte-Administration in Aswang Enters the City malt, produziert er keine klassische kämpferische Kunst, sondern eine wahre Kosmogonie der zeitgenössischen Macht. Die in mythische Kreaturen verwandelten Polizisten offenbaren, wie staatliche Gewalt in archaischen imaginären Strukturen verwurzelt ist, die die demokratische Moderne nie wirklich ausgerottet hat.
Tapayas Ansatz verbindet hier die tiefgründigsten Analysen der postkolonialen Situation. Seine Werke offenbaren, wie die Gesellschaften des Globalen Südens in einem zerrissenen Raum-Zeit-Kontinuum navigieren, in dem mehrere Zeitregime gleichzeitig koexistieren: die zirkuläre Zeit der traditionellen Mythen, die lineare Zeit der westlichen Moderne und die beschleunigte Zeit der zeitgenössischen Globalisierung. Diese zeitliche Polyrhythmik strukturiert sein gesamtes künstlerisches Schaffen und verleiht ihm seine ästhetische Besonderheit.
Seine Kollagetechnik stellt plastisch diese multiple Temporalität dar. In Instant Gratification (2018) überlagert der Künstler Referenzen an José Rizal, den Nationalhelden des 19. Jahrhunderts, mit Bildern von Spielautomaten und zeitgenössischen Lotteriescheinen. Diese Gegenüberstellung ist kein einfacher postmoderner Eklektizismus; sie zeigt, wie die millenaristischen Sehnsüchte der philippinischen Volks-Tradition in den konsumistischen Fantasien des globalisierten Kapitalismus neu verwertet werden.
Die Originalität von Tapaya liegt in seiner Fähigkeit, den Fallen des Culturalism und des Exotismus zu entgehen. Seine mythologischen Referenzen dienen niemals als dekorative Ornamente, um westliche Blicke zu verführen, sondern als Instrumente kritischer Analyse der zeitgenössischen Moderne. The Chocolate Ruins verwandelt somit die spanische Kolonialgeschichte in einen Schlüssel zum Verständnis der aktuellen neokolonialen Mechanismen und zeigt auf, wie die Rohstoffextraktion weiterhin die Beziehungen zwischen den Philippinen und der Weltwirtschaft strukturiert.
Diese kritische Dimension zeigt sich ebenfalls in seiner Auseinandersetzung mit der Umwelt. Tapaya gehört zu jener Künstlergeneration des Südens, die mit dem scharfen Bewusstsein der globalen ökologischen Katastrophe aufgewachsen ist. Seine üppigen Wälder, bevölkert von fantastischen Kreaturen, rufen zugleich das präkoloniale Eden und die zeitgenössische Umweltapokalypse hervor. Manama’s Abode (2013) zeigt eine Landschaft, in der Mensch und Mineral in einer pantheistischen Vision verschmelzen, die prächristliche animistische Kosmologien evoziert und gleichzeitig die heutige Bergbauvernichtung anprangert.
Der Künstler entwickelt somit eine Ästhetik des Widerstands, die weder durch primitivistische Nostalgie noch durch futuristische Utopien geprägt ist, sondern durch die kritische Reaktivierung mythischer Vergangenheit. Seine hybriden Wesen, weder ganz menschlich noch völlig tierisch, verkörpern die nicht realisierten Potenziale einer alternativen Moderne, die von nationalen Befreiungsbewegungen getragen wurden, bevor sie von neokolonialen Logiken zerschlagen wurden.
Diese politische Vision kristallisiert sich besonders eindrucksvoll in seinen architektonischen Darstellungen. Die in seinen Bildern verstreuten Gebäude im Stil der spanischen Kolonialzeit fungieren nie nur als Dekorelemente, sondern als Markierungen der räumlichen Eintragung von Macht. In Whisper Cutler (2014) erinnert das dominierende klassizistische Gebäude zugleich an koloniale Justizpaläste und zeitgenössische demokratische Institutionen und offenbart die Kontinuität von Unterdrückungsstrukturen über politische Regimewechsel hinweg.
Tapaya gilt somit als einer der durchdringendsten Chronisten der zeitgenössischen postkolonialen Situation. Seine Kunst zeigt auf, wie Gesellschaften, die aus der Dekolonisation hervorgegangen sind, weiterhin geistige Räume bewohnen, die durch die koloniale Erfahrung geformt wurden, und gleichzeitig kreative Strategien der kulturellen Aneignung entwickeln. Wie er selbst ausdrückt: “In gewisser Weise erkenne ich, dass die alten Geschichten nicht nur Metaphern sind. Ich kann Verbindungen zur zeitgenössischen Epoche finden. Es ist, als wären die Mythen poetische Erzählungen der Gegenwart” [3]. Diese politische Dimension beeinträchtigt niemals die plastische Qualität seiner Werke; im Gegenteil, sie nährt sie, indem sie ihr diese existentielle Dringlichkeit verleiht, die große Kunstwerke kennzeichnet.
Das Atelier als anthropologisches Laboratorium
Man muss verstehen, dass Tapayas Atelier in Bulacan wie ein echtes ethnografisches Forschungslabor funktioniert. Der Künstler führt dort seit Jahren eine systematische Untersuchung der philippinischen mündlichen Traditionen durch, wobei er lokale Varianten von Mythen und Legenden bei den Alten aus verschiedenen Provinzen sammelt. Diese Arbeitsmethode, die er selbst als forschungsbasiert bezeichnet, verändert den Status des zeitgenössischen Künstlers radikal: Tapaya ist nicht mehr nur ein Bildermacher, sondern ein kultureller Vermittler, der die verborgenen Erinnerungen seines Landes reaktiviert. Auf seinen kreativen Prozess angesprochen, erklärt der Künstler, wie “Collage nicht nur ein vorläufiger kreativer Prozess für die von mir in der Serie ‚Scrap Paintings‘ verwendete Technik wurde, sondern auch das zentrale Thema meiner Arbeit insgesamt ist” [4].
Diese ethnografische Dimension seiner Praxis greift die aktuellsten Anliegen der globalen zeitgenössischen Kunst auf, in der viele Künstler quasi-anthropologische Ansätze entwickeln. Aber Tapaya vermeidet die Falle der westlichen relationalen Kunst, indem er eine unverzichtbare ästhetische Autonomie bewahrt. Seine Feldforschungen werden niemals zu bloßer Dokumentation; sie nähren einen plastischen Schaffensprozess, der die gesammelten Materialien radikal verwandelt.
Die bedeutende Neuerung dieses Ansatzes liegt in seiner Fähigkeit, traditionelle soziale Funktionen der Kunst zu reaktivieren und gleichzeitig die formalen Anforderungen der künstlerischen Moderne zu bewahren. Tapayas Gemälde fungieren gleichzeitig als autonome Kunstwerke für den internationalen Markt und als Träger kultureller Überlieferung für die philippinischen Gemeinschaften. Diese Doppelfunktion vermeidet die charakteristische Spaltung vieler zeitgenössischer Künstler des Globalen Südens, die gezwungen sind, zwischen den widersprüchlichen Erwartungen lokaler und internationaler Märkte zu navigieren.
Die politische Ökonomie des Bildes
Die wachsende internationale Anerkennung Tapayas, von seinem prestigeträchtigen Preis im Jahr 2011 bis hin zu den jüngsten Ausstellungen in großen asiatischen und europäischen Galerien, zeigt die Transformation des globalen zeitgenössischen Kunstmarktes. Der philippinische Künstler verkörpert das Aufkommen einer neuen Generation von Künstlern des Südens, die ihre spezifischen kulturellen Referenzen ohne Zugeständnisse an die orientalistischen Erwartungen des westlichen Marktes durchsetzen. Seine Werke werden heute in großen Auktionshäusern zu Summen verkauft, die mitunter über 300.000 Euro liegen, was den wachsenden Appetit der Sammler auf Kunst bezeugt, die formale Raffinesse und authentische kulturelle Verankerung verbindet.
Dieser kommerzielle Erfolg darf die grundlegende kritische Dimension von Tapayas Werk nicht verdecken. Tapaya gehört zu jener Künstlergeneration, die mit dem scharfen Bewusstsein für neokoloniale Mechanismen aufgewachsen ist und besonders ausgefeilte ästhetische Widerstandsstrategien entwickelt. Seine ständigen Verweise auf die Patronagesysteme aus der spanischen Kolonialzeit zeigen, wie die zeitgenössischen philippinischen Eliten Herrschaftsstrukturen perpetuieren, die mehrere Jahrhunderte zurückreichen.
The Chocolate Ruins fungiert somit als eine echte marxistische Analyse der politischen Ökonomie der Philippinen und zeigt, wie die Rohstoffextraktion weiterhin die Beziehungen zwischen dem Archipel und der Weltwirtschaft strukturiert. Diese Kritik äußert sich jedoch durch eine plastische Sprache von außergewöhnlicher formaler Reichhaltigkeit, die jede propagandistische Dimension vermeidet. Der Künstler beherrscht perfekt die Codes der internationalen zeitgenössischen Kunst und bewahrt zugleich eine unüberwindbare kulturelle Spezifik.
Die Zukunft einer Ästhetik
Rodel Tapaya stellt den Höhepunkt eines langen historischen Prozesses dar: die Entstehung einer zeitgenössischen Kunst des Globalen Südens, die ihre eigenen Referenzen ohne Komplexe oder Unterwerfung unter westliche Kanons durchsetzt. Seine Werke zeigen, wie sich eine lokale künstlerische Tradition im Kontakt mit der globalen Moderne radikal erneuern kann, ohne ihre spezifische Identität zu verlieren. Diese kreative Synthese eröffnet neuartige ästhetische Perspektiven, die den Rahmen der philippinischen Kunst bei weitem überschreiten.
Der zunehmende Einfluss Tapayas auf der internationalen Kunstszene zeugt von einer tiefgreifenden Veränderung der globalen kulturellen Machtverhältnisse. Künstler des Südens begnügen sich nicht mehr damit, die formalen Innovationen des Nordens anzupassen; sie entwickeln eigene plastische Sprachen, die wiederum die Entwicklung der globalen zeitgenössischen Kunst beeinflussen. Diese Dynamik zeigt das Entstehen eines echten polyzentrischen künstlerischen Weltbildes, das die kulturellen Hierarchien der Kolonialzeit infrage stellt.
Tapayas Kunst kündigt so das Entstehen einer wahrhaft globalen Ästhetik an, die die Vielfalt der menschlichen Kulturtraditionen ohne Hierarchisierung integriert. Seine Gemälde offenbaren, wie archaische Mythen zeitgenössische Kreationen radikaler Modernität nähren und unerforschte Wege für die Kunst des 21. Jahrhunderts öffnen. Diese kreative Synthese von Tradition und Moderne, Lokalem und Globalem ist vielleicht einer der wichtigsten Beiträge der zeitgenössischen Kunst des Südens zur Weltkultur.
In einer zunehmend fragmentierten und polarisierten Welt erinnert uns die Kunst von Rodel Tapaya daran, dass künstlerische Schöpfung eine einzigartige Fähigkeit bewahrt, die tiefen Verbindungen zu offenbaren, die die Menschheit jenseits offensichtlicher kultureller Unterschiede vereinen. Seine Werke zeugen von dieser Universalität menschlicher Erfahrung, die in der Vielfalt kultureller Traditionen kein Hindernis, sondern ihren reichsten Ausdruck findet. Vielleicht liegt darin die wahre Größe dieses Künstlers: in seiner Fähigkeit, die philippinische Kunst zum Spiegel der zeitgenössischen menschlichen Existenz zu machen.
- Rodel Tapaya, zitiert in “Dichotomy and Integration of Science and Myth”, On Art and Aesthetics, 19. Mai 2020.
- Rodel Tapaya, Interview mit A3 Editorial, “A3 Behind the Scenes”, 26. April 2016.
- Rodel Tapaya, zitiert in der Ausstellung “Rodel Tapaya: New Art from the Philippines”, National Gallery of Australia, 2017.
- Tang Contemporary Art, “Random Numbers Exhibition”, 22. April 2021.