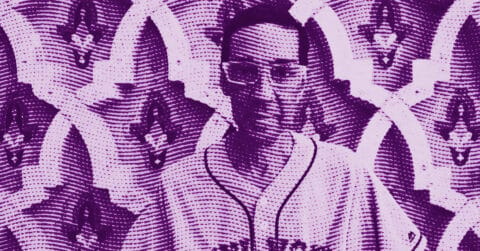Hört mir gut zu, ihr Snobs, die zerrissenen, verzerrten und verflochtenen Körper von Sema Maskili konfrontieren uns mit unserer angeborenen Wildheit, die wir verzweifelt versuchen, unter dem Lack unserer vermeintlichen Zivilisation zu verbergen. Ihre mächtigen Gemälde packen einen beim ersten Blick an der Kehle. Es ist unmöglich, den Blick von diesen Fleischgemischen abzuwenden, in denen die menschliche Anatomie, misshandelt von wütenden Pinselstrichen, sich in ein groteskes Theater unserer grundlegenden Wildheit verwandelt. Selten habe ich zeitgenössische Malerei gesehen, die so mutig die Abgründe der menschlichen Seele erkundet.
1980 in Edirne in der Türkei geboren, hat Maskili sich nach jahrelangem strengen Studium an der Mimar-Sinan-Universität der Schönen Künste in Istanbul einen unverwechselbaren Stil erarbeitet. Ihre klassische Ausbildung zeigt sich in ihrer technischen Meisterschaft, doch findet sie ihre wahre Stimme in der expressionistischen Verzerrung. Die Einflüsse sind offensichtlich: Gericault, Goya, Bacon, Freud, doch Maskili verarbeitet sie vollständig, um etwas radikal Eigenes zu schaffen. Und das tut weh. Sehr weh. Ihre Arbeit reißt einem die Augen auf, um zu erzwingen, dass man sieht, was man lieber ignorieren würde.
Ihre Serie “Die Macht schafft Monster”, die sie seit 2017 entwickelt, stellt den Höhepunkt ihrer künstlerischen Vision dar. Der Titel selbst ist eine konzeptuelle Ohrfeige, direkt, brutal, kompromisslos. In diesen monumentalen Werken wie “The Power Worshippers” (230 x 200 cm) oder “Barbarians” (185 x 145 cm) zeigt Maskili uns unverfälscht, was der Wille zur Herrschaft mit unseren Körpern und unserem Geist macht. Die menschlichen Silhouetten prallen mit animalischer Gewalt aufeinander, verwandeln sich in zerteilte Fleischmassen ohne individuelle Identität, reduziert auf ihren Herrschaftstrieb. Die Menschlichkeit wird hier auf ihre roheste Dimension zurückgeführt, den ewigen Kampf um die Vorherrschaft.
Diese Erforschung der der menschlichen Natur innewohnenden Gewalt ruft unweigerlich die nietzscheanischen Theorien vom “Wille zur Macht” hervor. Nietzsche behauptet in “Jenseits von Gut und Böse”, dass “das Leben selbst im Wesentlichen Aneignung, Verletzung, Eroberung des Fremden und Schwächeren, Unterdrückung, Härte, das Aufzwingen eigener Formen, Inkarnation und zumindest in den moderateren Fällen Ausbeutung” [1] sei. Genau das fängt Maskili in ihren chaotischen Kompositionen ein, diesen grundlegenden Drang zur Herrschaft, der jeder Moral vorausgeht, jene Lebenskraft, die, wenn sie pervertiert wird, Menschen zu Raubtieren ihrer Mitmenschen macht.
Maskilis Malerei ist nicht einfach eine Illustration der nietzscheanischen Konzepte, sie führt sie zu ihrem visuellen Höhepunkt und verkörpert sie in gefolterten Körpern, die um ihr symbolisches Überleben kämpfen. In ihrer Vision ist der “Wille zur Macht” nicht jene schöpferische Kraft, die Nietzsche gelegentlich wertschätzte, sondern vielmehr seine zerstörerische Seite, seine monströse Entgleisung, wenn er nicht mehr durch ethische Überlegungen gebremst wird. Maskilis Gemälde sind bevölkert von degenerierten Übermenschen, berauscht von ihrer eigenen Macht, aber leer von jeglicher Menschlichkeit.
Ihre Körper sind nicht einfach nur Körper, sie sind ideologische Schlachtfelder, umstrittene Territorien, auf denen viszerale Machtkämpfe ausgetragen werden. Sehen Sie sich “Mob Psychology” (110 x 85 cm) an, wo sich die Gruppendynamik in eine unkontrollierbare Horde verwandelt. Das Werk analysiert, wie das Individuum, in der Masse aufgehend, seine Menschlichkeit ablegt, um sich den niedersten Instinkten hinzugeben. Ich bin beeindruckt von der Art, wie Maskili Gelb-, Grün- und Zitronenrosa-Töne verwendet, um eine toxische Atmosphäre anzudeuten, in der abscheuliche Verhaltensweisen gedeihen. Ihre chromatischen Entscheidungen sind von klinischer Präzision und rufen moralischen Zerfall so sicher hervor wie Gangrän den bevorstehenden Tod von Gewebe.
Durch ihre Gemälde etabliert sich Maskili als eine der eindringlichsten Stimmen der zeitgenössischen türkischen Kunst. Es ist kein Zufall, dass sie 2022 eine der drei Preisträgerinnen des Luxembourg Art Prize war, einem renommierten internationalen Preis für zeitgenössische Kunst. Ihre künstlerische Vision überschreitet kulturelle Grenzen, um eine universelle Wahrheit über unsere menschliche Bedingung zu erreichen. Sie gehört zu jenen seltenen Künstlerinnen, die es schaffen, das Wesentliche unserer Epoche zu erfassen, die Spannung zwischen unseren zivilisatorischen Bestrebungen und unseren primitiven Trieben, die ständig droht, unseren zerbrechlichen Gesellschaftsvertrag zum Explodieren zu bringen.
Maskilis Stärke liegt in ihrem kategorischen Ablehnen einfacher Ästhetik. Sie lehnt konventionelle Schönheit ab, um Bilder zu schaffen, die tief verstören und beunruhigen. Ihre verzerrten Körper erinnern an Michel Foucaults Sicht auf Machtverhältnisse, die sich direkt in den menschlichen Körper einschreiben. In “Überwachen und Strafen” schreibt Foucault, dass “der Körper unmittelbar in ein politisches Feld eingetaucht ist; Machtverhältnisse wirken unmittelbar auf ihn ein; sie besetzen, markieren, dressieren, foltern und zwingen ihn zu Arbeiten” [2]. Die verstümmelten und ineinander verstrickten Körper bei Maskili illustrieren diese Theorie perfekt, sie sind das Terrain, auf dem Macht- und Herrschaftsverhältnisse ausgeübt werden, passive Empfänger institutioneller und zwischenmenschlicher Gewalt.
Foucaults Ansatz des Körpers als Ort der Einschreibung von Machtverhältnissen findet in Maskilis Werk eine beeindruckende visuelle Umsetzung. Jede Verzerrung, jede anatomische Deformation kann als physische Manifestation einer normalisierten sozialen Gewalt gelesen werden. In “Barbarians” (185 x 145 cm) erinnern die gestapelten, gesichtslosen Körper an die “politische Anatomie”, von der Foucault spricht, jene folgsamen Körper, die durch die disziplinierenden Mechanismen der modernen Gesellschaft erzeugt werden. Maskili geht jedoch weiter, indem sie die Rebellion des Fleisches gegen diese Zwänge zeigt, deren Weigerung, sich vollständig den Normen zu beugen, die versuchen, es zu domestizieren.
Die metaphysischen Räume, in denen Maskili ihre Figuren platziert, verstärken deren existentielle Entfremdung. Diese abstrakten Hintergründe mit abrupten Lichtübergängen, blockierten Farben und unsicheren Landschaften symbolisieren eine Welt, die unter unseren Füßen zerbricht, ein Universum ohne stabile Orientierungspunkte, in dem die Wesen ohne Richtung umherirren. Es sind Nicht-Orte im anthropologischen Sinn, Übergangsräume, in denen Identität und persönliche Geschichte im Anonymat verschwinden. Maskilis Figuren scheinen zu einem ewigen Umherirren in diesen malerischen Zwischenwelten verurteilt, weder ganz hier noch ganz dort, schwebend in einem unbequemen Zwischenzustand, der die prekäre Lage des zeitgenössischen Individuums widerspiegelt.
In ihrem Werk “Selbstporträt” schenkt uns Maskili einen Moment roher Wahrheit von seltener Intensität. Sie stellt sich mit abgeschnittenem Haar dar, als Hommage an den Widerstand der iranischen Frauen nach dem Tod von Mahsa Amini. Es ist ein Bild, das die Ästhetik übersteigt, um eine starke politische Dimension zu erreichen, ein Akt der Solidarität, der ihre Arbeit in die zeitgenössischen feministischen Kämpfe einordnet. Durch diese Geste bekräftigt Maskili, dass Kunst nicht nur eine formale oder konzeptuelle Erkundung ist, sondern eine ethische Haltung gegenüber Machtmissbrauch, eine Wortmeldung, die die Verantwortung der Künstlerin angesichts der Ungerechtigkeiten ihrer Zeit fordert.
Dieses Porträt stellt einen Wendepunkt in Maskilis Ansatz dar, den Moment, in dem das Universelle und das Besondere, das Persönliche und das Politische in einer kraftvollen Synthese zusammenkommen. Indem sie sich die Haare schneidet, macht die Künstlerin ihren eigenen Körper zum Ort eines symbolischen Widerstands. Sie reiht sich somit in die lange Tradition von Künstlerinnen ein, die ihren Körper als politisches Medium nutzten, doch tut sie dies mit einer Zurückhaltung, die die Falle des Spektakulären vermeidet. In dieser Geste steckt nichts Beliebiges, sie steht in tiefer Logik mit ihrer Arbeit an den Machtverhältnissen und der Verdinglichung der Körper.
Erwarten Sie nicht, die Begegnung mit Maskilis Werk unversehrt zu überstehen. Ihre Bilder werden Sie verfolgen, sich unter Ihre Haut bohren wie schmerzhafte Splitter, die kein konzeptuelles Pinzette mehr entfernen kann. Sie zwingt Sie, jenem dunklen Teil ins Gesicht zu sehen, den wir lieber ignorieren, unserem Potenzial zur Monstrosität, wenn wir der Versuchung der Macht erliegen. Ihr Werk ist ein gnadenloser Spiegel, der der Menschheit vorgehalten wird, die in der Regel schmeichelhafte Spiegelbilder den verstörenden Wahrheiten vorzieht.
Die gewaltigen Farbflächen und die hektischen Pinselstriche von Maskili erinnern an den deutschen Expressionismus, jedoch mit einer zeitgenössischen Intensität, die von den spezifischen Spannungen unserer Epoche zeugt. Ihre Palette, die oft von leichenhaften Grüntönen, fleischfarbenen Rosatönen und ungesunden Gelbtönen dominiert wird, verstärkt den Eindruck von durch systemische Gewalt korrumpiertem Fleisch. Diese chromatischen Entscheidungen sind nicht willkürlich; sie spiegeln eine nüchterne und ernüchterte Sicht auf die Menschheit wider, einen Blick, der die Oberflächen durchdrungen und den harten Kern unserer Existenz erreicht hat.
Maskilis malerische Technik ist besonders interessant. Ihr Pinselstrich wechselt zwischen anatomischer Präzision, wie sie von klassischen Meistern geerbt wurde, und expressionistischen Verformungen, die die Gewalt der Emotionen widerspiegeln. Diese technische Dualität spiegelt perfekt die zentrale Spannung ihres Werks wider, jene zwischen unserer zivilisatorischen Oberfläche und unseren primitiven Trieben. In bestimmten Bereichen ihrer Bilder beherrscht sie ihr Medium meisterhaft und schafft Passagen von bemerkenswerter Feinheit, bevor sie zu impulsiveren, fast wilden Gesten übergeht, die den Kontrollverlust und das Eindringen des Chaos in die fragile Ordnung des menschlichen Daseins suggerieren.
Maskilis Kunst reiht sich in eine malerische Tradition ein, die bis zu Goya und seinen “Desastres de la guerra” zurückreicht, wo das Grauen ungeschönt gezeigt wird. Wie Goya weigert sie sich, den Blick vor den Abgründen der menschlichen Existenz zu wenden. Doch im Unterschied zu dem spanischen Meister dokumentiert sie keine spezifischen historischen Gräueltaten, sondern untersucht ausschließlich die universellen psychologischen Mechanismen, die sie ermöglichen, die mentalen Strukturen, die gewöhnlichen Menschen erlauben, außerordentliche Grausamkeiten zu begehen. Es ist diese archetypische Dimension, die ihrer Arbeit ihre universelle Kraft verleiht.
Einige Kritiker könnten in ihrer Arbeit einen übermäßigen Pessimismus sehen, eine reduzierende Sicht auf den Menschen, die keinen Raum für Transzendenz oder Erlösung lässt. Aber das würde das Wesentliche ihres Ansatzes verfehlen. Maskili verurteilt die Menschheit nicht, sie befragt sie mit schonungsloser Klarheit. Ihre Malerei ist ein verzerrender, aber notwendiger Spiegel, der uns auf unsere eigene moralische Ambivalenz zurückwirft, auf jene grauen Zonen des Bewusstseins, in denen unsere erklärten Prinzipien mit unseren ungesagten Trieben kollidieren. In diesem Sinne ist ihr Werk tief ethisch; es lädt uns zu einer unbequemen, aber potenziell heilsamen Selbstreflexion ein.
In “Power Causes Monsters Serie (4)” (140 x 165 cm) behandelt Maskili speziell, wie unterdrückte Frauen dieselben Herrschaftsmuster untereinander reproduzieren können, wenn sie in einem Kontext konkurrieren und Hierarchie wertgeschätzt wird. Es ist eine feine Analyse der Macht-Dynamiken, die sich nicht mit einer binären Sichtweise von Unterdrücker/Unterdrückte begnügt. Sie zeigt, wie Herrschaftsstrukturen internalisiert und auf allen Ebenen der Gesellschaft weitergegeben werden, wie Opfer wiederum zu Tätern in einem perversen Kreislauf werden können, der das System nur weiter verstärkt, das sie angeblich bekämpfen. Diese Klarheit angesichts menschlicher Widersprüche ist genau das, was Maskilis Werk intellektuelle Glaubwürdigkeit und emotionale Tiefe verleiht.
Der Platz der Frauen in Macht-Strukturen ist übrigens ein wiederkehrendes Thema in Maskilis Arbeit. Nicht weil sie eine essentialistische Haltung einnimmt, die Weiblichkeit als Garantie gegen Gewalt sieht, ganz im Gegenteil: Sie zeigt, wie Frauen ebenso wie Männer durch Macht korrumpiert werden können, wenn sie diese nach denselben dominierenden Paradigmen ausüben. Dabei steht sie in der Tradition von Foucaults Perspektive über die diffuse und allgegenwärtige Natur von Macht, die sich nicht auf eine einfache binäre Beziehung zwischen Herrschenden und Beherrschten reduzieren lässt, sondern durch den gesamten sozialen Körper in einem komplexen Netz von Mikro-Beziehungen zirkuliert.
Durch ihre Einzelausstellungen der letzten Jahre, darunter die jüngste “Power Causes Monsters” in der Istanbul Concept Gallery (2023), hat Maskili eine kohärente visuelle Sprache entwickelt, die unermüdlich die Spannungen zwischen unseren ethischen Aspirationen und unseren animalischen Trieben erforscht. Ihr Ansatz ist nicht nur ästhetisch; er ist zutiefst philosophisch. Er reiht sich ein in die Tradition großer Fragesteller der menschlichen Existenz, jener Künstlerinnen, die sich nicht mit der bloßen Darstellung der Welt begnügen, sondern danach streben, die verborgenen Mechanismen, die uns Verhalten und Beziehungen bestimmen, aufzudecken.
Was an Maskilis Entwicklung beeindruckt, ist die Kohärenz ihrer künstlerischen Vision im Laufe der Jahre. Von ihrer ersten Einzelausstellung “Dağınık Düşler” (Unordentliche Träume) im Jahr 2006 bis zu ihrem aktuellen Erkunden der Macht-Dynamiken ist eine logische Progression spürbar, ein ständiges Vertiefen ihrer bevorzugten Themen. Jede neue Ausstellung stellt keinen Bruch zu den vorherigen dar, sondern eher eine tiefere Ausgrabung derselben psychischen Territorien, als würde die Künstlerin geduldig einen Tunnel zur unterirdischen Wahrheit unserer Menschlichkeit graben.
Die Ausstellung “Was ist gut, was ist böse?” (Qu’est-ce que le bien ? Qu’est-ce que le mal ?) von 2017 markiert einen wichtigen Wendepunkt in ihrem Werdegang. Indem sie sich direkt mit der grundlegenden ethischen Frage auseinandersetzt, die die Menschheit seit ihren Anfängen beschäftigt, ordnet Maskili ihre Arbeit ausdrücklich in eine philosophische Perspektive ein. Sie verweist dabei auf die Figur von Bosch und seinem “Garten der irdischen Lüste” und zieht eine Parallele zwischen ihrem eigenen Vorgehen und dem des flämischen Meisters, der unter dem Deckmantel religiöser Bildsprache eine tiefgreifende Meditation über die Torheiten und Laster der Menschheit lieferte. Wie Bosch schafft Maskili ihre eigene Ikonographie, ihre eigene visuelle Sprache, um die moralischen Widersprüche unserer Spezies zu erforschen.
Die Arbeit von Maskili erinnert uns daran, dass die bedeutendste zeitgenössische Kunst nicht die ist, die uns in unseren Gewissheiten bestärkt, sondern diejenige, die uns mit unseren schmerzhaftesten Widersprüchen konfrontiert. In einer Welt, die von geglätteten und vermarkteten Bildern übersättigt ist, die für einen risikofreien Konsum gestaltet sind, wirken ihre Gemälde wie ein elektrischer Schlag; sie wecken unsere durch die tägliche visuelle Bombardierung taube Sensibilität und führen uns brutal auf das Wesentliche zurück: diesen ewigen Kampf zwischen unseren zivilisatorischen Bestrebungen und unseren zerstörerischen Trieben.
Maskilis Kunst ist politisch, aber nicht im trivialen Sinne, dass sie eine bestimmte spezifische Sache verteidigen würde. Sie ist politisch in einem viel tieferen Sinne, da sie die Grundlagen des Zusammenlebens selbst hinterfragt, die Möglichkeitsbedingungen einer Gesellschaft, die nicht einfach nur vom Recht des Stärkeren beherrscht wird. Indem sie die latente Gewalt enthüllt, die unseren sozialen Interaktionen zugrunde liegt, lädt sie uns ein, uns andere Formen der Beziehung und andere Arten der Machtausübung vorzustellen, die nicht zwangsläufig durch die Unterdrückung des Anderen verlaufen.
In dieser Hinsicht ist es verlockend, in Maskilis Vorgehen eine Illustration von Nietzsches Thesen über die Möglichkeit einer Umwertung der Werte zu sehen. Indem sie uns mit dem Entsetzen dessen konfrontiert, was wir sind, oder zumindest was wir werden können, wenn wir unseren Herrschaftstrieben nachgeben, öffnet sie paradoxerweise einen Raum, um sich vorzustellen, was wir sein könnten. Ihre Malerei bietet keine einfachen Lösungen oder Wundermittel gegen die menschliche Gewalt an. Sie begnügt sich damit, die Diagnose mit chirurgischer Präzision zu stellen und überlässt jedem Betrachter die Verantwortung, über die Implikationen dessen, was er sieht, nachzudenken.
Wenn Sie nicht bereit sind, destabilisiert zu werden und Ihren eigenen Schattenanteil zu hinterfragen, gehen Sie bitte weiter. Die Kunst von Sema Maskili ist nicht dazu gemacht, Ihre sterilen Innenräume zu dekorieren oder Ihre Gäste bei gesellschaftlichen Abendessen zu beeindrucken. Sie ist da, um Sie zu erschüttern, zu stören und Sie zu zwingen, das zu betrachten, was Sie lieber ignorieren würden: die Gewalt, die im Herzen unserer Menschlichkeit schlummert. Und vielleicht finden wir in dieser unangenehmen Auseinandersetzung mit uns selbst die Ressourcen, um neue Wege zu erfinden, gemeinsam menschlich zu sein, jenseits der Gewalt- und Herrschaftszyklen, die bisher unsere kollektive Geschichte definiert haben.
- Friedrich Nietzsche, “Jenseits von Gut und Böse”, Gesamtausgabe der philosophischen Werke, Gallimard, 1971.
- Michel Foucault, “Überwachen und Strafen: Die Geburt des Gefängnisses”, Gallimard, 1975.