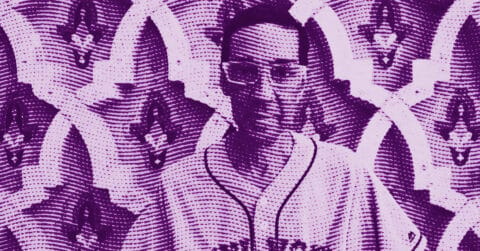Hört mir gut zu, ihr Snobs, Thomas Houseago ist nicht der Künstler, für den ihr ihn haltet. Hinter diesem Bild des britischen Enfant terrible, der in Kalifornien lebt, verbirgt sich ein Bildhauer, dessen Werk sich jeder einfachen Klassifikation entzieht. Seine kolossalen Kreaturen, diese mit Gips überzogenen, deformierten Körper, die aus einer archaischen Vergangenheit zu erwachen scheinen, blicken uns mit beunruhigender Intensität an. Eine Intensität, die uns an unsere eigene Zerbrechlichkeit erinnert.
Auf der Biennale von Venedig 2011 erhob sich Houseagos “Der eilige Mann” monumentaler Bronze vor dem Palazzo Grassi. Diese monumentale Bronzeskulptur eines gehenden Mannes schien aus dem Großen Kanal entkommen zu wollen, wie ein Titan, der aus einer anderen Zeit auftaucht, gedrängt, unsere banale Realität zu betreten, um sie zu unterwandern. Dieses emblematische Werk veranschaulicht perfekt die Spannung zwischen Anziehung und Abstoßung, die seine Skulpturen hervorrufen.
Houseago, 1972 in Leeds, einer Industriestadt im Norden Englands geboren, hat einen verschlungenen Weg zurückgelegt, bevor er 2003 in Los Angeles sesshaft wurde. Ausgebildet am Jacob Kramer College und dann an der Central Saint Martins in London, hat er seine Vision wirklich erst in den De Ateliers in Amsterdam geprägt, im Kontakt mit figurativen Künstlern wie Marlene Dumas, Thomas Schütte und Luc Tuymans. Dann kam Brüssel, wo er acht wichtige Jahre seiner Karriere verbrachte, bevor er den Atlantik überquerte, um sich in Kalifornien niederzulassen.
Was sofort an Houseagos Werk auffällt, ist diese rohe, fast gewaltsame Materialität. Gips, Holz, Hanf und Metallframeworks werden mit bewusster Rauheit behandelt. In seiner Serie von Masken und Köpfen ist der Einfluss primitiver Kunst spürbar, ebenso der von Picasso. Die Gesichter sind wie geografische Karten primaler Emotionen: Angst, Sorge, Überraschung. Seine bildhauerischen Techniken vermischen Zeichnung und dreidimensionales Volumen und schaffen eine permanente Spannung zwischen der zweiten und dritten Dimension.
Monumentalität ist eine weitere grundlegende Eigenschaft seiner Arbeit. Seine Figuren erreichen oft beeindruckende Dimensionen, als wollten sie uns stärker mit ihrer physischen Präsenz konfrontieren. Anders als in der klassischen Tradition, die nach Erhebung des Materials sucht, preist Houseago dessen zerbrechliche Natur an. Der Gips zeigt Spuren der Bearbeitung, die Armaturen sind sichtbar, die Verbindungen bleiben offen. Diese Ästhetik des Fragmentarischen, des Unvollendeten, knüpft an eine lange philosophische Tradition an, die von Nietzsche bis Georges Bataille reicht.
Denn bei Houseagos Werk handelt es sich tatsächlich um Philosophie. Genauer gesagt, seine Skulptur lässt sich durch das prisma des nietzscheanischen Konzepts des “Dionysischen” gegenüber dem “Apollinischen” lesen [1]. Während das Apollinische Ordnung, Maß und Harmonie der Formen repräsentiert, verkörpert das Dionysische chaotische, irrationale und leidenschaftliche Kräfte. Houseagos Kreaturen mit ihren verdrehten Körpern und dramatischen Proportionen gehören eindeutig zum Bereich des Dionysischen. Sie versuchen nicht, unseren Blick zu beruhigen, sondern ihn zu stören und verborgene Triebe in uns zu wecken.
Diese philosophische Dimension geht einher mit einer Reflexion über Zeit und Erinnerung. Houseagos Werke scheinen stets zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu oszillieren, als wären sie archäologische Überreste einer zukünftigen Zivilisation. In dieser mehrdeutigen Zeitlichkeit hinterfragt der Bildhauer unsere Beziehung zu Gründungserzählungen, zu den großen Mythen, die uns weiterhin heimsuchen. Seine Minotauren, maskierten Figuren, hybriden Kreaturen knüpfen an ein uraltes Imaginäres an und aktualisieren es zugleich in zeitgenössischen Materialien.
Der Ausdruck des Körpers steht in seiner Herangehensweise ebenfalls im Mittelpunkt. Houseago versucht nicht, idealisierte Körper darzustellen, sondern kämpfende Körper, durchdrungen von widersprüchlichen Kräften. Wie Nietzsche in “Also sprach Zarathustra” schrieb: “In deinem Leib ist mehr Verstand, als in deinem besten Weisen” [1]. Diese Vorrangstellung des Körpers vor dem Intellekt, diese somatische Intelligenz, die sich durch das gestaltete Material ausdrückt, kennzeichnet sein gesamtes Werk. Seine Figuren scheinen stets im Werden, niemals in einer endgültigen Form erstarrt, als ob sie sich weiterhin vor unseren Augen verwandeln würden.
Houseago jedoch nur als einfachen Erben Nietzsches zu bezeichnen, wäre zu einfach. Seine Arbeit steht auch im Dialog mit der Psychoanalyse, insbesondere im Hinblick auf das Trauma. Die unregelmäßigen Oberflächen seiner Skulpturen, ihre manchmal monströsen oder beunruhigenden Aspekte, können als Manifestationen einer ursprünglichen psychischen Verletzung interpretiert werden. Der Künstler selbst hat seine eigenen Kindheitstraumata und deren Einfluss auf seine künstlerische Praxis erwähnt. In einem Interview im Jahr 2021 sagte er: “Ich glaube, dass Kunst zu bestimmten Zeiten eine traumatische Schleife war. In meinem Versuch, das Trauma durch die Skulptur somatisch zu befreien, traumatisierte ich mich gleichzeitig wieder” [2].
Diese psychoanalytische Dimension wirft ein neues Licht auf das, was als einfache Faszination für das Primitive oder Groteske erscheinen könnte. Die anatomischen Verzerrungen, die gequälten Gesichter, die fragmentierten Körper werden zu Ausdrucksformen eines leidenden Psyche, die versucht, das Unaussprechliche Gestalt zu geben. Man denkt hier an gewisse Analysen von Julia Kristeva zur Abjektion als Versuch, eine Grenze zwischen Selbst und Anderem, zwischen Innen und Außen zu ziehen. Houseagos Skulpturen konfrontieren uns in ihrer beunruhigenden Fremdheit mit unseren eigenen Grenzen, mit jenen unsicheren Zonen, in denen unsere Identität ins Wanken gerät.
Diese psychoanalytische Lesart wird durch den Schaffensprozess des Künstlers selbst verstärkt. Houseago arbeitet oft durch Akkumulation, durch Überlagerung von Schichten von Material, als handle es sich darum, Erfahrungen, Erinnerungen, Empfindungen zu sedimentieren. Der Gips, das bevorzugte Material seiner frühen Werke, eignet sich besonders gut für diesen Ansatz: formbar, bewahrt er die Spuren jedes Eingriffs, jeder Geste. Sein Studio in Los Angeles, bestehend aus vier Industriegebäuden entlang des Flusses, ist zum Laboratorium dieser besonderen Alchemie geworden, in der sich tote Materie in eine nahezu lebendige Präsenz verwandelt.
Die jüngste Entwicklung seines Werkes hin zur Malerei, insbesondere seine Serien von Landschaften und Blumen, markiert eine bedeutende Wende. Nach seiner Nervenerkrankung im Jahr 2019 und seinem Aufenthalt in einem Rehabilitationszentrum in Arizona begann Houseago, hellere, ruhigere Themen zu erforschen. Diese neuen Werke mit ihren lebendigen Farben zeugen von einer inneren Transformation, einer Suche nach Heilung durch die Kunst. Wie er erklärt: “Ich begann Freude zu empfinden, eine Verbindung zu einer höheren Energie, in der Natur und in Beziehungen. Ich wollte diese Reise aus der Verzweiflung, aus einem Ort, von dem ich nicht dachte, dass ich überleben würde, zeigen, und ich wollte diese Freude festhalten” [2].
Diese Wende zur Malerei stellt jedoch keinen Bruch mit seinen früheren Anliegen dar. Man findet dieselbe Intensität, dieselbe expressive Dringlichkeit, jedoch auf neue Horizonte ausgerichtet. Die leuchtenden Blumen, die stürmischen Himmel, die kosmischen Landschaften setzen seine Reflexion über die menschliche Bedingung fort und verankern sie gleichzeitig in einem erneuerten Verhältnis zur natürlichen Welt. Die Figur weicht der Landschaft, der Anthropomorphismus dem Kosmischen, doch die Suche bleibt dieselbe: dem Formlosen Gestalt zu geben, das Unsichtbare sichtbar zu machen.
Diese kosmische Dimension ermöglicht es uns, eine Verbindung zur Filmkunst herzustellen, einem weiteren wichtigen Bezugsfeld zum Verständnis von Houseagos Werk. Seine monumentalen Skulpturen erinnern oft an die Ästhetik bestimmter Science-Fiction-Filme, diese Visionen einer archaischen Zukunft, in der kolossale Kreaturen die Landschaft beherrschen. Besonders denkt man an “2001: Odyssee im Weltraum” von Stanley Kubrick mit seinem rätselhaften Monolithen oder an die biomechanischen Kreaturen, die H.R. Giger für “Alien” entworfen hat. Diese Verwandtschaft mit dem Kino ist kein Zufall: Houseago pflegt enge Beziehungen zur Hollywood-Industrie und zählt Schauspieler wie Brad Pitt und Leonardo DiCaprio zu seinen engen Freunden.
Das Kino hat ihm zweifellos die Kunst der Inszenierung, des Bildausschnitts und der Dramaturgie gelehrt. Seine skulpturalen Installationen funktionieren oft wie Filmsets, bei denen der Zuschauer zum Schauspieler einer fragmentarischen Erzählung wird. Die 2015 im Rockefeller Center installierten riesigen Masken, die ein Pentagon bildeten, in das das Publikum eintreten konnte, illustrieren diesen immersiven Ansatz perfekt. Das Erlebnis ist nicht mehr nur visuell, sondern voll und ganz körperlich und fordert alle Sinne in einer sorgfältig orchestrierten räumlichen Choreografie heraus.
Der Kritiker David Salle schrieb über diese Installation: “Ihre theatralische Monumentalität ist nicht die der Alten, sie scheint völlig erfunden. Houseagos Skulpturen fehlen eine überzeugende Persönlichkeit; es ist wie jemand, der zu laut schreit, weil er Angst hat, nicht gehört zu werden” [3]. Diese Kritik, so streng sie auch ist, weist dennoch auf einen wesentlichen Aspekt von Houseagos Arbeit hin: seine bewusste Theatralik, seine Art, mit den Codes der Darstellung zu spielen, um dramatische Effekte zu erzeugen.
Doch diese Theatralik ist nicht willkürlich. Sie gehört zu einer filmischen Tradition, die das Spektakuläre als Zugang zu tiefen existenziellen Fragestellungen nutzt. Die Filme von Kubrick, Bergman oder Tarkowski, die Houseago als Einflüsse nennt, teilen dieses Anliegen: die sinnlichen Ressourcen des Mediums zu nutzen, um eine transzendentale Erfahrung zu provozieren. Ebenso zielen seine Skulpturen nicht nur darauf ab, durch Größe oder Ausdruckskraft zu beeindrucken, sondern uns in einen Raum der Kontemplation zu führen, in dem unsere Gewissheiten ins Wanken geraten.
Diese filmische Dimension verbindet sich auch mit einem ausgeprägten Interesse an mythologischer Erzählung. Seine Figuren erinnern oft an archaische Gestalten: den Minotaurus, den wilden Mann, den Riesen, den Zyklopen. Diese Kreaturen, die aus den Gründungsmythen unserer Zivilisation stammen, spuken weiterhin in unserem kollektiven Vorstellungsraum. Indem Houseago sie in einer zeitgenössischen skulpturalen Sprache neu aktualisiert, bestätigt er die Relevanz dieser Mythen zum Verständnis unserer gegenwärtigen Lage. Der Kritiker Luke Heighton bemerkt treffend: “Was ebenso auffällig ist, wenn auch paradoxerweise, ist die Leichtigkeit dieser Werke, ein Effekt, der teilweise durch die Einbeziehung von Zeichnung in seine skulpturalen Werke erzielt wird” [4].
Diese paradoxe Leichtigkeit, diese Fähigkeit, das Monumentale und das Zerbrechliche, das Mythische und das Alltägliche nebeneinander bestehen zu lassen, ist wohl einer der größten Erfolge von Houseago. Seine Kreaturen, so imposant sie auch sind, erdrücken uns nie vollständig. Sie laden uns vielmehr ein, mit ihnen in einen Dialog zu treten, in ihren gequälten Körpern das Spiegelbild unserer eigenen Widersprüche zu erkennen. Wie Lilly Wei schreibt: “Houseago und seine Skulpturen scheinen sich gegenseitig zu nähren, so sehr, dass man schwören könnte, die Energie zu spüren, die zwischen ihm und den imposanten und bedrohlichen Figuren, für die er bekannt ist, hin und her springt.” [5].
Diese Energie, die zwischen dem Künstler und seinen Kreationen, dann zwischen diesen und uns, den Betrachtern, zirkuliert, definiert das einzigartige Erlebnis, das Houseago bietet. Ein Erlebnis, das an das Kino in seiner kollektiven und immersiven Dimension erinnert. Wir sind gleichzeitig Zuschauer und Akteure, Beobachter und Teilnehmer eines Dramas, das an der Grenze zwischen Realität und Imagination stattfindet.
In den letzten Jahren hat sich das Werk von Houseago erheblich weiterentwickelt. Seine Ausstellung “Night Sea Journey” in der Galerie Lévy Gorvy Dayan in New York im Jahr 2024 zeugt von einem neuen Kapitel in seiner Schaffensgeschichte. Der Titel selbst, entlehnt von Carl Jung, verweist auf eine innere Reise in die Tiefen der Psyche. Die Installation ist als metaphorischer Weg von der Dunkelheit zum Licht, vom Trauma zur Heilung konzipiert. Im ersten Stock stellen bedrohliche Figuren die Abgründe des Unbewussten dar, während in den oberen Stockwerken leuchtendere Werke das allmähliche Hervortreten in einen beruhigten Bewusstseinszustand symbolisieren.
Diese Entwicklung spiegelt den eigenen Weg des Künstlers wider, geprägt von Kindheitstraumata, denen er sich schrittweise durch seine künstlerische Praxis gestellt hat. Seine Nervenkrise 2019, gefolgt von einer Phase intensiver Behandlung, hat seine Beziehung zur Kunst tiefgreifend verändert. Wie er erklärt: “Meine Arbeit vor der Heilung war knorrig, sie war furchterregend. Ich wurde in der Nacht, als ich ein Kind war, missbraucht. In vielen meiner früheren Werke zeige ich buchstäblich, was mir angetan wurde” [2].
Dieses erschütternde Geständnis wirft ein neues Licht auf sein Gesamtwerk. Die fragmentierten Körper, die gequälten Gesichter, die enthaupteten Figuren, die seine skulpturale Welt bevölkern, erscheinen nun als Manifestationen eines tiefen persönlichen Traumas. Kunst wird so zu einem Mittel, das Unsagbare zu formen, die eigenen Dämonen in Szene zu setzen, um sie besser zu bändigen.
Doch Houseago begnügt sich nicht mit dem kathartischen Ausdruck seines Leidens. Er sucht auch danach, diese individuelle Erfahrung zu transzendieren, um eine universelle Dimension zu erreichen. Seine jüngsten Werke, insbesondere seine Gemälde von kosmischen Landschaften und seine Blumenskulpturen, zeugen von dieser Suche nach dem Sublimen, nach einer Schönheit, die das Grauen ausgleichen kann. Wie Rachel Corbett feststellt: “Houseagos Vision für die Ausstellung würde sich wie seine eigene psychologische Transformation vollziehen, beginnend mit der Verzweiflung im Erdgeschoss, wo die monströsesten Kreaturen stehen, die die Täter aus der Sicht eines Kindes darstellen, und sich hoffnungsvoll in den oberen Stockwerken fortsetzen” [6].
Dieser Dialektik zwischen Abscheu und Sublimem, zwischen Trauma und Heilung, zwischen Dunkelheit und Licht bildet den Leitfaden seines jüngsten Werks. Sie ist eingebettet in eine lange künstlerische Tradition, die von Goya bis Francis Bacon versucht hat, die menschliche Bedingung in ihrer ganzen Komplexität darzustellen, ohne ihre dunkelsten Aspekte zu beschönigen und dennoch die Möglichkeit einer Transzendenz offen zu halten.
Das Werk von Thomas Houseago lädt uns dazu ein, unsere Beziehung zum Körper, zum Trauma, zum Gedächtnis und zum Erhabenen neu zu überdenken. Seine monumentalen Skulpturen, seine beunruhigenden Masken und seine kosmischen Gemälde bilden ebenso viele Meilensteine einer existenziellen Suche, die tief in unserer Zeit verwurzelt ist. Eine Zeit, die durch die Fragmentierung kollektiver Erzählungen, durch das Wiederauftauchen lange verdrängter historischer Traumata und durch die Suche nach einer neuen Spiritualität geprägt ist, die unserer enttäuschten Welterfahrung Sinn geben kann.
Insofern erscheint Houseago als ein symptomatischer Künstler unserer Gegenwart mit ihren Widersprüchen und Bestrebungen. Sein Werdegang von Leeds nach Los Angeles, von expressionistischer Skulptur zu kosmischer Malerei, von Dunkelheit zu Licht zeichnet eine Spur, die tief mit den Sorgen und Hoffnungen unserer Zeit mitschwingt. Ohne je in die Leichtigkeit des spektakulären Nichts oder in elitären Hermetismus zu verfallen, hält er die Möglichkeit offen, dass Kunst uns verwandeln, uns unseren Dämonen stellen und uns zugleich den Weg zu einer möglichen Erlösung zeigen kann.
- Friedrich Nietzsche, “Die Geburt der Tragödie” und “Also sprach Zarathustra”, Sämtliche Werke, Gallimard, Paris, 1977.
- Kate Brown, “Ich dachte nicht, dass ich überleben würde: Der Bildhauer Thomas Houseago über seine Nervenzusammenbruch, seine Heilung und wie die Verarbeitung des Traumas seine Kunst verändert hat”, Artnet News, 27. Juni 2021.
- David Salle, “Thomas Houseago”, Artforum, 26. September 2023.
- Luke Heighton, “Thomas Houseago: What Went Down”, Michael Werner Gallery, 2010.
- Lilly Wei, “Thomas Houseago: Night Sea Journey”, Studio International, 9. September 2024.
- Rachel Corbett, “Thomas Houseago zu seiner neuen Ausstellung, Night Sea Journey”, Vulture, 9. September 2024.