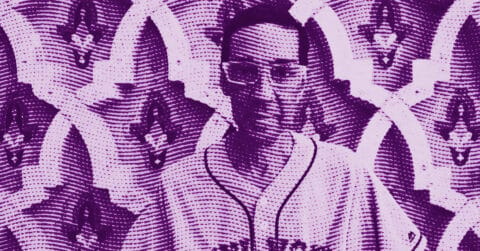Tomoo Gokita ist ein japanischer Maler, geboren 1969, der sich einen Namen gemacht hat, indem er Gesichter verzerrt und die Grenzen zwischen Abstraktion und Figuration verwischt. Der ehemalige Grafiker, der Künstler wurde, verwandelte die pornografischen Magazine seines Vaters und amerikanische Wrestlerinnen in eine eigene malerische Sprache. Er ist ein Künstler, der mit unseren Urängsten spielt, Pin-up-Models in gesichtslose Kreaturen verwandelt und die Malerei zur Arena des Lucha Libre macht, in der Realität und Fiktion bis zum Tod kämpfen.
Das ist genau die Art Künstler, die der Kunstmarkt liebt: ein Japaner, der den amerikanischen Expressionismus verdaut hat, der Pollock zitiert, ohne ihn beim Namen zu nennen, schwarz-weiß malt, weil das eleganter ist, und jetzt mit Pastellfarben experimentiert, weil man den Vorrat erneuern muss. Die Galerien in New York lieben ihn, von Mary Boone bis Petzel, darunter auch Blum & Poe. Kein Wunder, Gokita liefert genau das, was sie wollen: dosierten Exotismus, japanische Raffinesse gemischt mit amerikanischer Gewalt, alles verpackt in ein Narrativ über Improvisation und Zufall.
Aber lassen wir uns nicht täuschen. Hinter dieser kommerziellen Fassade verbirgt sich ein wahrer Maler. Gokita ist nicht nur ein Marketingprodukt, er ist ein Besessener der Geste, ein Oberflächennarr, ein Alchimist, der Obszönität in Poesie verwandelt. Seine Gemälde sind organisierte Schlachten zwischen Kontrolle und Chaos, zwischen Figur und ihrer Auflösung. Wenn er malt, scheint er zu versuchen, seine Motive unter Grauschichten zu ersticken, sie lebendig im malerischen Material zu begraben.
Gokitas Geschichte beginnt in den 1990er Jahren, als er sein Kunststudium abbricht, um Grafiker zu werden. Er entwirft Flyer für Tokios Clubs, gestaltet Plattencover und lebt das japanische Nachtleben. Doch der Künstler in ihm kann nicht schweigen. 2000 veröffentlicht er “Lingerie Wrestling”, eine Zeichnungssammlung, die Kultstatus erlangt. Frauen in Unterwäsche, die kämpfen, mit Kohle und Tusche gezeichnet. Es ist brutal, sexuell, witzig. Vor allem aber ist es eine Kriegserklärung an die wohlmeinende Malerei.
Seitdem verfeinert Gokita ständig sein Arsenal. Seine Pinsel sind zu Waffen der Massenvernichtung geworden. Er nimmt ein Magazinfoto, projiziert es mental auf seine Leinwand und zerstört es dann methodisch. Gesichter verschwinden unter abstrakten Flecken, Körper verdrehen sich in unmöglichen Posen, Hintergründe lösen sich in grauen Nebeln auf. Das ist Francis Bacon neu interpretiert von einem Tokyo-Otaku, Willem de Kooning mit Manga-Kultur gewürzt.
Was bei Gokita beeindruckt, ist seine elegante Brutalität. Er hat diese sehr japanische Art, Gewalt akzeptabel, fast raffiniert erscheinen zu lassen. Seine Pinselstriche sind präzise wie Schwerthiebe, seine Kompositionen ausgewogen wie Zen-Gärten. Doch unter dieser polierten Oberfläche brodelt eine dumpfe Wut, ein Verlangen, alles zu zerstören und nach eigenen Regeln wieder aufzubauen.
Das Paradox bei Gokita ist, dass er vorgibt zu improvisieren, obwohl alles in seiner Arbeit durch und durch kalkuliert wirkt. “Ich habe keine Absicht”, sagt er. Ich kann es kaum glauben! Jede Geste ist abgewogen, jeder Zufall provoziert, jede Überraschung inszeniert. Er ist ein großartiger Lügner, ein Illusionist, der so tut, als kenne er seine Tricks nicht. Er sagt uns, er male ohne nachzudenken, doch seine Bilder sind konzeptuelle Kriegsmaschinen.
Seine Beziehung zur amerikanischen Kultur ist interessant. Er ist mit Playboy und Comics aufgewachsen, mit Jazz und B-Filmen. Sein Vater arbeitete für die japanische Ausgabe von Playboy [1], und der kleine Tomoo blätterte heimlich durch diese Magazine. Diese Bilder haben ihn lebenslang geprägt. Aber statt sie bloß zu kopieren, hat er sie verdaut, verwandelt, japanisiert. Er nahm die amerikanische Vulgarität und sublimierte sie zur Eleganz Tokios.
Gokitas Frauen sind Gespenster. Sie haben ihr Gesicht verloren, aber ihren Sex-Appeal bewahrt. Sie schweben in grauartigen Zwischenwelten, irgendwo zwischen Erotik und Horror. Es sind entstellte Venusfiguren, atomisierte Aphroditen. Gokita zeigt uns, was vom Verlangen übrig bleibt, wenn man ihm sein Objekt nimmt, was von der Schönheit bleibt, wenn man ihr die Form entzieht.
Aber vorsicht, Gokita ist nicht nur ein Maler des Fehlens. Er ist auch ein geheimer Kolorist. Seit 2020 hat er wieder mit Farbe angefangen, und seine letzten Werke explodieren in Pastellfarben. Puderrosa, verblasstes Blau, kranke Grüntöne. Es ist, als hätte David Lynch beschlossen, einen japanischen Teesalon neu zu streichen. Diese Farben sind zugleich sanft und beunruhigend, verführerisch und abstoßend.
In Gokitas Malerei steckt etwas zutiefst Neurotisches. Seine Figuren scheinen alle an einer Identitätsstörung zu leiden, als hätten sie vergessen, wer sie sind. Die Familien, die er malt, gleichen Versammlungen von Gespenstern, die Paare schlendernden Duos. In “The Dead Family” (2024) zeigt er uns eine Kernfamilie, die zur Stilllebenlandschaft wird. Vater, Mutter und Kinder sind da, aber etwas stimmt nicht. Ihre Gesichter sind Schwarze Löcher, ihre Körper entstellte Puppen.
Diese Besessenheit vom Verschwinden des Gesichts ist nicht zufällig. In der japanischen Kultur ist das Gesicht der Sitz der sozialen Identität. Es zu verlieren, heißt, seinen Platz in der Welt zu verlieren. Gokita spielt mit dieser grundlegenden Angst. Seine Figuren sind Ausgestoßene, Bilderparias. Sie existieren, gehören aber nicht mehr zu unserer Realität.
Gokitas Technik ist makellos. Er benutzt Acryl und Gouache, um vollkommen glatte Oberflächen ohne Pinselspuren zu schaffen. Es ist eine industrielle, fast mechanische Malerei. Doch diese scheinbare Kälte verbirgt eine komplexe Gestik. Gokita arbeitet in Schichten, fügt hinzu und nimmt weg, baut auf und zerstört. Jedes Bild ist das Ergebnis eines erbitterten Kampfes zwischen Künstler und Medium.
Sein Verhältnis zur Kunstgeschichte ist zwiespältig. Er zitiert, ohne zu zitieren, leiht, ohne zu stehlen. In seiner Arbeit finden sich Echos von Kubismus, Surrealismus, abstraktem Expressionismus. Doch diese Referenzen sind verdaut, metabolisiert, verwandelt in etwas Anderes. Gokita ist kein Pasticheur, er ist ein Kannibale. Er verschlingt seine Meister, um sie besser wiederzugeben.
Der Einfluss des mexikanischen Wrestlings auf sein Werk verdient besondere Aufmerksamkeit. Die Lucha Libre ist ein Theater der Grausamkeit, in dem Masken die Identität der Kämpfer verbergen. Genau das tut Gokita mit seinen Figuren: Er maskiert sie, anonymisiert sie, verwandelt sie in Archetypen. Seine Gemälde sind Ringe, auf denen urtümliche Kräfte aufeinandertreffen: Eros gegen Thanatos, Figuration gegen Abstraktion, Kontrolle gegen Chaos.
Ist Gokita ein wichtiger Künstler? Diese Frage ist berechtigt. In einer von Bildern übersättigten Kunstwelt ist seine Strategie des Verschwindens vielleicht wohltuend. Er erinnert uns daran, dass Sehen auch Nichtsehen bedeutet, dass Zeigen auch Verbergen ist. Seine Gemälde sind visuelle Rätsel, die sich einer einfachen Interpretation widersetzen.
Aber lassen Sie uns nicht täuschen. Gokita spielt auch das Spiel des Marktes mit. Seine Kooperationen mit Mode und Musik, seine Ausstellungen in angesagten Galerien, all das ist Teil einer gut durchdachten Handelsstrategie. Er hat verstanden, dass man, um in der zeitgenössischen Kunstwelt zu überleben, sowohl Künstler als auch Geschäftsmann sein muss.
Was Gokita rettet, ist sein Humor. In seinen Gemälden liegt eine schwarze Komik, ein Sinn für Absurdität, der verhindert, dass man sie zu ernst nimmt. Seine entstellten Figuren haben etwas Cartoonhaftes, seine dramatischsten Kompositionen streifen das Groteske. Es ist Beckett, der Tex Avery trifft, Giacometti, der Mickey Mouse kreuzt.
Die jüngste Entwicklung Gokitas hin zur Farbe markiert vielleicht eine Wende. Nach Jahren in Grau wagt er sich nun an Pastelltöne. Ist das ein Zeichen von Reife oder eine Zugeständnis an den Markt? Schwer zu sagen. Doch diese neuen Gemälde besitzen eine unerwartete Frische, eine Leichtigkeit, die im Gegensatz zur Düsterkeit seiner Anfänge steht.
Im Panorama der zeitgenössischen japanischen Kunst nimmt Gokita eine Sonderrolle ein. Er hat nicht die Pop-Strategie von Takashi Murakami, noch den konzeptuellen Minimalismus seiner Landsleute. Er steht näher an einem Yoshitomo Nara, aber dunkler, verdrehter. Er ist ein Maler, der die Malerei annimmt, der noch an die Kraft des gemalten Bildes glaubt.
Man muss Gokita als ein Symptom unserer Zeit sehen. Seine ausgelöschten Gesichter sind vielleicht eine Metapher für unseren eigenen Identitätsverlust im digitalen Zeitalter. Seine geisterhaften Figuren spiegeln unseren Zustand als derealisierte Wesen wider, die zwischen Virtuellem und Realem schweben. Er malt Zombies für eine Zombie-Zivilisation.
Paradoxerweise offenbart Gokita das Menschliche, indem er die Gesichter auslöscht. Seine Figuren ohne Züge sind ausdrucksstärker als viele hyperrealistische Porträts. Sie sprechen von Einsamkeit, Entfremdung, unerfülltem Verlangen. Sie sind trübe Spiegel, in denen wir unsere eigenen Ängste projizieren können.
Die Stärke Gokitas liegt darin, dass er uns nicht beruhigen will. Seine Gemälde sind unbequem, verstörend, manchmal widerlich. Sie bieten uns keinen Zufluchtsort, keinen Trost. Sie konfrontieren uns mit dem, was wir lieber nicht sehen würden: unserer eigenen Leere, unserer eigenen Monstrosität. Und doch liegt Schönheit in dieser Arbeit. Eine kranke, perverse Schönheit, aber dennoch Schönheit. Die Grautöne Gokitas haben unendliche Nuancen, seine Kompositionen eine morbide Eleganz. Es ist Kunst, die weh tut, aber es ist Kunst.
Im Grunde ist Gokita ein schwarzer Romantiker. Er glaubt noch an die Malerei als Medium der Offenbarung, als Mittel, verborgene Wahrheiten zu erreichen. Seine Gemälde sind Séancen des Spiritismus, in denen er die Geister unseres kollektiven Unbewussten beschwört. Entstellte Pin-ups, tote Familien, gespenstische Wrestlerinnen: all diese Erscheinungen spuken in unserer zeitgenössischen Imagination.
Der internationale Erfolg von Gokita beweist, dass er einen sensiblen Nerv getroffen hat. Seine Bilder sprechen eine universelle Sprache, die der postmodernen Angst. New York, London, Tokio: Überall finden seine Geister Widerhall. Vielleicht ist das die Globalisierung: Wir alle haben dieselben Albträume. Doch Gokita bleibt tief japanisch. In seiner Arbeit steckt diese typisch japanische Fähigkeit, das Grauen zu ästhetisieren, das Hässliche schön zu machen. Seine Gemälde sind wie Haikus der Apokalypse, Zen-Gärten, bepflanzt mit Leichen.
Was hält man von seiner letzten Ausstellung “Gumbo”? Der Titel ist aufschlussreich. Gumbo ist der louisianische Eintopf, in den man alles Mögliche wirft. Genau das tut Gokita: Er wirft alle Abfälle unserer visuellen Kultur in den Kessel seiner Malerei und rührt so lange, bis etwas Neues entsteht.
Die Vogelscheuchen seiner letzten Serie sprechen besonders eindrücklich. Diese Wächter auf den Feldern sollen die Vögel erschrecken, doch bei Gokita wirken sie selbst verängstigt. Sie schweben durch undefinierbare Landschaften, Gespenster einer verschwundenen ländlichen Welt. Die perfekte Metapher für den zeitgenössischen Künstler: eine Vogelscheuche, die niemanden mehr erschreckt.
Die Frage ist nun: Wohin geht Gokita? Wird er weiter Farbe erforschen? Wird er zum Schwarz-Weiß zurückkehren? Wird er sich wiederholen oder sich neu erfinden? Die Zukunft wird es zeigen. Eines ist sicher: Er hat seine Epoche bereits geprägt. Seine gesichtslosen Bilder sind Ikonen unserer Zeit geworden. In einer Welt, die von Selfies und sozialen Netzwerken übersättigt ist, erinnert uns Gokita an die Kraft des Verschwindens. Seine Bilder sind Gegengifte gegen die narzisstische Überdosis der Gegenwart. Sie sagen uns: Seht her, man kann noch verschwinden, sich noch verstecken, noch geheimnisvoll sein.
Vielleicht ist das die letzte Botschaft von Gokita: In einer Welt völliger Transparenz wird Opazität subversiv. Seine maskierten Figuren sind Widerstandskämpfer, Verteidiger des Schattens. Sie verweigern es, das Spiel der Sichtbarkeit um jeden Preis mitzuspielen. Tomoo Gokita ist nicht der größte Maler seiner Generation, aber einer der notwendigsten. Er zeigt uns, was wir nicht sehen wollen, malt das, was wir lieber vergessen würden. Seine Gemälde sind Memento Mori für das Instagram-Zeitalter, Vanitas für das 21. Jahrhundert.
Also ja, hört mir gut zu, ihr Snobs: Gokita verdient eure Aufmerksamkeit. Nicht, weil er in Mode ist, nicht, weil er gut verkauft, sondern weil er etwas Essentielles berührt. Er spricht von dem, was es heißt, Mensch zu sein in einer Zeit, in der die Menschlichkeit selbst infrage steht. Gokitas Kunst ist eine Form von Widerstand. Widerstand gegen die Einfachheit, gegen die Transparenz, gegen das Offensichtliche. Seine Gemälde verlangen unsere Aufmerksamkeit, dass wir sie entziffern, dass wir uns in ihnen verlieren. In einer Welt, die sich zu schnell dreht, zwingen sie uns zum Innehalten. In einer zu lauten Welt laden sie uns zur Stille ein.
Und vielleicht ist das das wahre Talent von Gokita: die Schwätzer zum Schweigen zu bringen und die Snobs zum Nachdenken zu bringen. Im Zirkus der zeitgenössischen Kunst ist er der Akrobat, der absichtlich fällt, der Clown, der niemanden zum Lachen bringt. Er ist derjenige, der uns daran erinnert, dass Kunst nicht dazu da ist, zu gefallen, sondern zu stören. Also, ihr Snobs, wenn ihr das nächste Mal auf ein Gemälde von Gokita stoßt, nehmt euch die Zeit, es wirklich anzuschauen. Hinter diesen ausgelöschten Gesichtern, diesen verdrehten Körpern, diesen kranken Farben, steckt vielleicht ein Spiegel. Und in diesem Spiegel könntet ihr euren eigenen Geist sehen.
- “Gokitas Faszination für weibliche Darsteller ist ein weiteres prägendes Thema seiner Arbeit… Diese Inspirationsquelle kommt häufig in seinen Gemälden zum Ausdruck… Der Einfluss stammt wahrscheinlich aus der Kindheit des Künstlers, da sein Vater an der Gestaltung der japanischen Ausgabe des Playboy-Magazins beteiligt war” (Quelle: Massimo De Carlo Gallery).