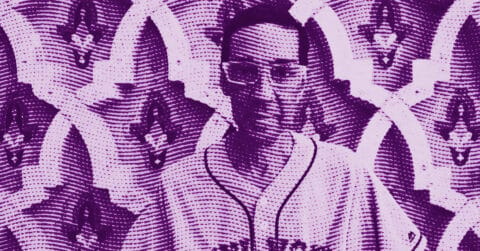Hört mir gut zu, ihr Snobs: Ulala Imai malt keine Spielzeuge. Sie malt die japanische Seele zu einer Zeit, in der Steiffs Teddybären Seite an Seite mit Charlie Brown in ohrenbetäubender Stille stehen. Diese 43-jährige Frau, geboren 1982 in Kanagawa, verwandelt Alltagsgegenstände in wahre Darsteller eines intimen Theaters, in dem sich Bild für Bild die Menschheitkomödie unserer Zeit abspielt. Als Künstlerin der dritten Generation, Tochter des westlichen Malers Shingo Imai, hat sie einen Blick von den europäischen Meistern geerbt und dabei diese japanische Sensibilität bewahrt, die leblose Dinge zum Schwingen bringt.
Von Geburt an schwerhörig, entwickelt Imai seit ihrer Kindheit eine besondere Beziehung zur visuellen Welt. “Ich habe nur die Bilder”, sagte sie in einem Interview mit dem Magazin Bunshun im Jahr 2018 [1]. Dieser Satz klingt wie ein ästhetisches und existenzielles Credo. Durch den Verlust eines Teils des Klanguniversums kompensiert sie mit einer bemerkenswerten visuellen Schärfe, die es ihr ermöglicht, das zu erfassen, was wir, die abgelenkten Hörenden, entgehen lassen. Ihre Kompositionen, die sie sorgfältig in ihrem Wohnatelier arrangiert, bevor sie sie auf Leinwand überträgt, offenbaren diese Geduld eines Tierfotografen, die sie selbst beansprucht: “Wie ein Tierfotograf warte ich ruhig auf den richtigen zärtlichen Moment” [2].
Imais Kunst wurzelt in einer shintoistischen Tradition, in der jedes Objekt, belebt oder unbelebt, eine spirituelle Essenz, ein Kami, besitzt. Dieser uralte Glaube durchdringt ihre Malerei auf subtile, aber beharrliche Weise. Wenn sie Charlie Brown und Lucy van Pelt nebeneinander auf den Zweigen eines Baumes platziert, inszeniert sie nicht einfach zwei Figuren. Sie aktualisiert eine Kosmogonie, in der die Grenzen zwischen Subjekt und Objekt verschwimmen, in der Spielzeuge Träger einer komplexen Innerlichkeit werden. “Als ich sie nebeneinander gesetzt und auf den Ästen der Bäume sitzen gelassen habe, schauten sie in die Ferne. Manchmal wirkten sie positiv, manchmal schienen sie in Erinnerungen verloren” [3].
Dieser Ansatz hat seine Wurzeln im japanischen Animismus, der Weltanschauung, wonach jeder Gegenstand eine Seele enthält. Bei Imai ist diese Philosophie kein dekorativer Folkloreaspekt, sondern eine echte künstlerische Methode. Ihre Teddybären, Chewbacca-Masken, E.T.-Puppen sind keine bloßen nostalgischen Accessoires. Sie verkörpern Fragmente kollektiven Bewusstseins, zeitgenössische Archetypen, die unsere Konsumzivilisation hervorgebracht hat und die sie instinktiv erkennt. Die Künstlerin verleiht ihnen ein beunruhigendes Innenleben und eine Präsenz, die ihren Status als hergestellte Gegenstände übersteigt.
Diese Spiritualität des Objekts bereichert sich durch eine tiefgehende psychoanalytische Dimension. Denn obwohl Imai aus dem shintoistischen Animismus schöpft, steht sie auch im Dialog mit dem freudianischen Unbewussten und seinen Mechanismen der Projektion. Ihre Kompositionen rufen jene Kindheitsmomente hervor, in denen die Grenze zwischen Realität und Imagination verschwindet, in denen Spielzeuge zu Vertrauten und Zeugen unserer ersten Gefühle werden. Das unheimliche Fremde, das von ihren Bildern ausgeht, beruht auf ihrer Fähigkeit, in uns jene archaischen Schichten der Psyche wiederzubeleben. Ihre Peanuts-Figuren, die in einem unwirklichen Laub schweben, verweisen auf jene geheimen Gärten der Kindheit, in denen wir unsere Wünsche und Ängste auf Plastik- und Stoffgefährten projizierten.
Die Künstlerin versteht es meisterhaft, das zu schaffen, was Freud als das Unheimliche bezeichnete, diese beunruhigende Vertrautheit, die entsteht, wenn das Bekannte unmerklich ins Fremde übergeht. Ihre häuslichen Stillleben, weiße Spargel, gebuttertes Toast, Kirschen in einer Schale, erscheinen auf den ersten Blick harmlos. Doch ein Detail, ein Licht, eine Komposition verstört den Blick und bringt eine Rissstelle in die Selbstverständlichkeit des Alltags. Diese Technik der leichten Verschiebung zieht sich durch ihr gesamtes Werk und verleiht ihm jene verstörende Poesie, die ihre Einzigartigkeit ausmacht.
Wenn sie “Coney Island” (2025) malt, das zwei Bären im Bademantel zeigt, die an einem verlassenen Winterstrand mit einem geschlossenen Vergnügungspark im Hintergrund sitzen, ruft Imai die ganze Melancholie des postindustriellen Amerika hervor. Diese Bären sind keine Spielzeuge mehr, sondern stumme Zeugen einer verwahrlosten Freizeitutopie. Das Bild funktioniert als Allegorie unseres zeitgenössischen Verhältnisses zum Glück, das stets versprochen, aber nie wirklich erreicht wird, schwebend zwischen Nostalgie und Ernüchterung.
Die malerische Technik von Imai, die sich ausschließlich auf Ölmalerei konzentriert, offenbart eine Meisterschaft, die sie von den großen europäischen Meistern, die sie bewundert, geerbt hat. Sie nennt gerne Manet, insbesondere dessen “Spargelbündel” (1880), Van Eyck für seine Darstellung von Licht und Transparenz, Velázquez für seine feinen Texturen. Doch sie passt dieses westliche Erbe an ihre japanische Sensibilität an und schafft einen hybriden Stil von beeindruckender Modernität. Ihre Pinselstriche, schnell und sicher, scheinen den flüchtigen Moment einzufangen, in dem die Materie mit eigenem Leben erfüllt wird.
Diese technische Virtuosität dient einem ehrgeizigen ästhetischen Projekt: das Unsichtbare sichtbar zu machen, das im Sichtbaren wohnt. Jedes von ihr gemalte Objekt wird zum Anlass einer Meditation über Präsenz und Abwesenheit, über das, was bleibt, wenn das Leben sich aus den Dingen zurückgezogen hat. Ihre Kompositionen erinnern an jene Schwebezustände, die unmittelbar dem Verlassen eines Raumes durch jemanden folgen, wenn die Gegenstände noch den Abdruck dieser verflogenen Präsenz bewahren.
Imais Werk hinterfragt auch unser heutiges Verhältnis zur Kindheit und zur Erinnerung. Mutter von drei Kindern, verwandelt sie ihr familiäres Umfeld in ein permanentes künstlerisches Labor. Ihr Wohnzimmer dient als Atelier, ihre Kinder spielen um sie herum, während sie malt. Diese bewusste Nähe zwischen Kunst und häuslichem Leben nährt eine Ästhetik des Intimen, die die traditionelle Trennung zwischen privatem Raum und Schaffensraum ablehnt. “Die unabsichtlichen Handlungen des täglichen Lebens mit der Natur und der Familie unterstützen meinen kreativen Prozess” [4], erklärt sie.
Diese Einbindung in das familiäre Alltagsleben verleiht ihren Werken eine seltene Authentizität. Wenn sie einen Bären mit einer fehlenden Ohrmuschel malt, den sie “Vincent van Dog” (2025) nennt, verfällt sie nicht in autobiographische Anekdoten, sondern berührt das Universelle der menschlichen Bedingung. Dieser verstümmelte Bär wird zur Metapher unserer gemeinsamen Verwundbarkeit, unserer Mankos, die uns ebenso definieren wie unsere Fülle.
Imais Kunst offenbart ebenfalls ein feines Verständnis für die Veränderungen der zeitgenössischen Popkultur. Ihre Bezüge zu Star Wars, Peanuts und Sesame Street sind keine bloßen dekorativen Zitate, sondern eine Archäologie der Gegenwart. Diese Ikonen der amerikanischen Popkultur, die von der japanischen Gesellschaft assimiliert und durch den Blick einer schwerhörigen Künstlerin neu interpretiert werden, erfahren eine dreifache kulturelle Übersetzung, die ihre ursprüngliche Bedeutung erheblich bereichert.
Diese Fähigkeit, Orient und Okzident, Tradition und Moderne, Schweigen und Kommunikation in Dialog zu bringen, reiht Imai in eine Linie japanischer Künstler ein, die seit Hokusai wissen, wie sie aus dem nationalen Erbe schöpfen und sich gleichzeitig für äußere Einflüsse öffnen. Aber im Gegensatz zu vielen ihrer Zeitgenossen, die ins Spektakuläre oder Konzeptuelle abgleiten, hält sie eine unerschütterliche Treue zur Malerei als bevorzugtem Ausdrucksmittel aufrecht.
Ihre Palette, dominiert von sanften und leuchtenden Tönen, evoziert diese besondere Qualität des japanischen Lichts, die nipponische Fotografen und Filmemacher zu veredeln wussten. Doch Imai verfällt niemals in dekorativen Ästhetizismus. Ihre Kompositionen, scheinbar einfach, verbergen eine bemerkenswerte narrative Komplexität. Jedes Element wird abgewogen, jedes Kräfteverhältnis kalkuliert, um jene Bedeutungseffekte zu schaffen, die den Reichtum ihres Universums ausmachen.
Die Ausstellung “CALM”, die Anfang 2025 in der Galerie Karma in New York präsentiert wird, bestätigt die künstlerische Reife von Imai. Die versammelten Werke zeugen von einer stilistischen Entwicklung hin zu größerer Weite und Monumentalität, ohne dabei die Intimität zu verlieren, die ihre Signatur ausmacht. Ihre jüngsten großformatigen Arbeiten wie “Lovers” (2025), das Charlie Brown und Lucy fast in menschlicher Größe zeigt, offenbaren ihre Fähigkeit, mit Skalierungseffekten die emotionale Wirkung ihrer Kompositionen zu intensivieren.
Diese ständige Suche nach der richtigen Emotion, ohne Pathos oder Sentimentalität, ist vielleicht Imais größte Leistung. In einer von Bildern und Lärm übersättigten Welt bietet sie eine Kunst des Schweigens und der Kontemplation, die mit besonderer Kraft nachklingt. Ihre Gemälde funktionieren wie Ruheblasen im zeitgenössischen Chaos, Räume der Meditation, in denen der Blick endlich verweilen und die Zeit finden kann, wirklich zu sehen.
Imais Kunst erinnert uns daran, dass große Malerei keine großartigen Themen braucht, um das Wesentliche zu berühren. Ein mit Butter bestrichenes Toast, ein Teddy, Cartoon-Figuren können genügen, um die Geheimnisse der menschlichen Existenz zu offenbaren, vorausgesetzt, sie werden mit jener besonderen Intensität betrachtet, die durch sensorischen Entzug in künstlerische Gabe verwandelt wird. Damit ehrt diese bemerkenswerte Frau die schönste Tradition der Malerei: das Banale in das Erhabene zu verwandeln, das Außerordentliche zu enthüllen, das im Alltäglichen schlummert, und das Sichtbare sichtbar zu machen, das wir nicht zu sehen wussten.
- Bunshun Magazin, Interview 2018, zitiert im Yokogao Magazin, “Domestic Meditations – Die sanft leuchtende Welt von Ulala Imai”, Januar 2025
- Yokogao Magazin, “Domestic Meditations – Die sanft leuchtende Welt von Ulala Imai”, von Sam Siegel, Januar 2025
- Aspen Art Museum, Interview mit Terence Trouillot, 2023
- Yokogao Magazin, “Domestic Meditations – Die sanft leuchtende Welt von Ulala Imai”, von Sam Siegel, Januar 2025